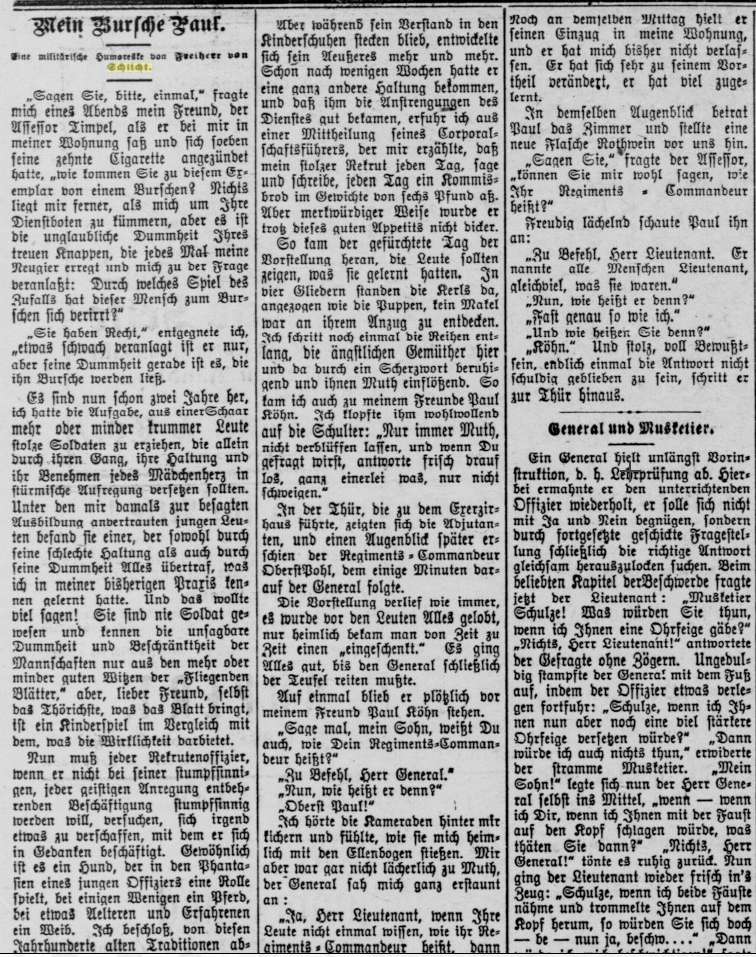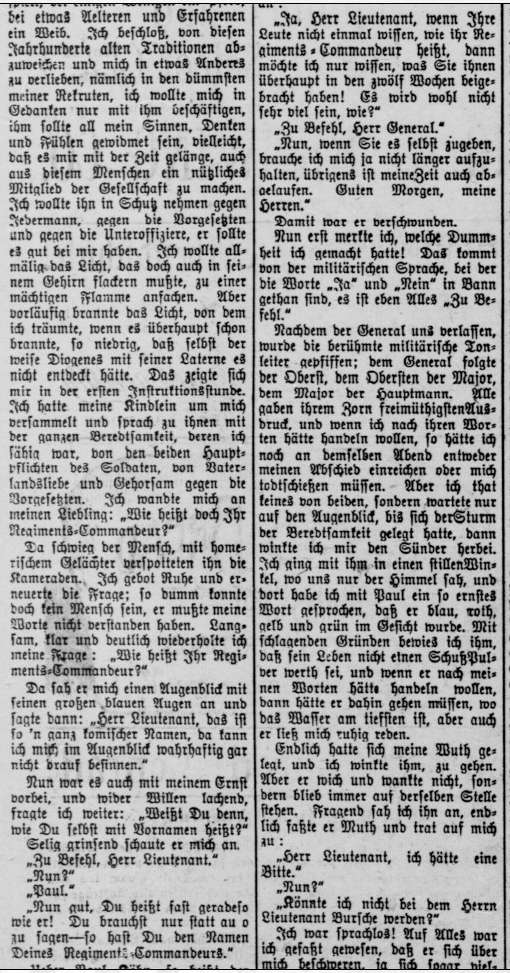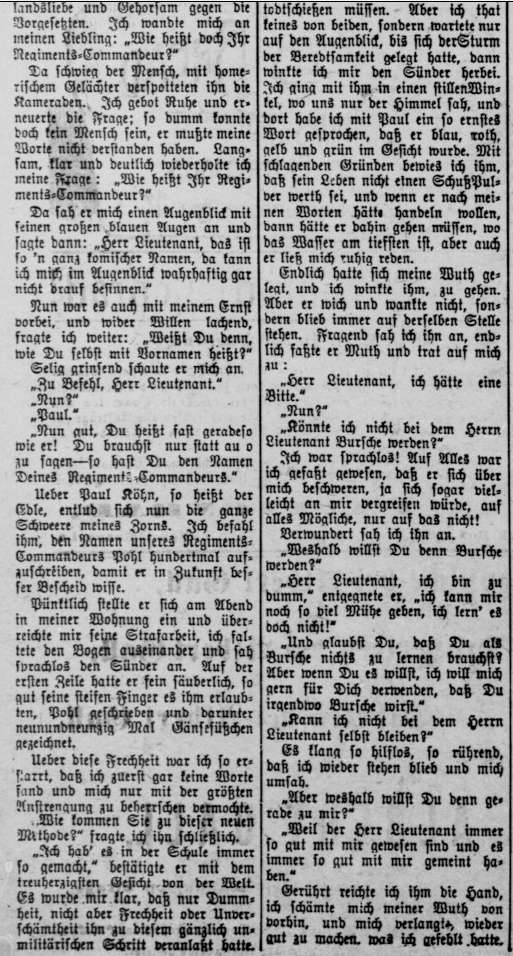Schlicht-Seite
Heitere Soldaten-Geschichte von Freiherr von Schlicht,
in: „Freie Presse für Texas” vom 13.12.1893,
(ohne Nennung des Autors),
in: „Indiana Tribüne” vom 17.12.1893,
in: „New Orleans Deutsche Zeitung” vom 7.1.1894,
(ohne Nennung des Autors),
in: „Der deutsche Beobachter” vom 24.1.1894
(in diesen vier Zeitungen unter dem Titel „Mein Bursche Paul”),
in: „Militaria”
„Sagen Sie, bitte, einmal,” fragte mich eines Abends mein Freund, der Assessor Timpel, als er bei mir in meiner Wohnung saß und sich soeben seine zehnte Cigarette angezündet hatte, „wie kommen Sie zu diesem Exemplar von einem Burschen? Nichts liegt mir ferner, als mich um Ihre Dienstboten zu kümmern, aber es ist die unglaubliche Dummheit Ihres treuen Knappen, die jedesmal meine Neugier erregt und mich zu der Frage veranlaßt: Durch welches Spiel des Zufalls hat dieser Mensch zum Burschen sich verirrt?”
„Sie haben recht,” entgegnete ich, „etwas schwach veranlagt ist er nur, aber seine Dummheit gerade ist es, die ihn Bursche werden ließ.”
Es sind nun schon zwei Jahre her, ich hatte die Aufgabe, aus einer Schar mehr oder minder krummer Leute stolze Soldaten zu erziehen, die allein durch ihren Gang, ihre Haltung und ihr Benehmen jedes Mädchenherz in stürmische Aufregung versetzen sollten. Unter den mir damals zur besagten Ausbildung anvertrauten jungen Leuten befand sich einer, der sowohl durch seine schlechte Haltung als auch durch seine Dummheit alles übertraf, was ich in meiner bisherigen Praxis kennen gelernt hatte. Und das wollte viel sagen! Sie sind nie Soldat gewesen und kennen die unsagbare Dummheit und Beschränktheit der Mannschaften nur aus den mehr oder minder guten Witzen der „Fliegenden Blätter”, aber, lieber Freund, selbst das Thörichste, was das Blatt bringt, ist ein Kinderspiel im Vergleich mit dem, was die Wirklichkeit darbietet.
Nun muß jeder Rekrutenoffizier, wenn er nicht bei seiner stumpfsinnigen, jeder geistigen Anregung entbehrenden Beschäftigung stumpfsinnig werden will, versuchen, sich irgend etwas zu verschaffen, mit dem er sich in Gedanken beschäftigt. Gewöhnlich ist es ein Hund, der in den Phantasien eines jungen Offiziers eine Rolle spielt, bei einigen Wenigen ein Pferd, bei etwas Älteren und Erfahrenen ein Weib. Ich beschloß, von dieser Jahrhunderte alten Tradition abzuweichen und mich in etwas anderes zu verlieben, nämlich in den dümmsten meiner Rekruten, ich wollte mich in Gedanken nur mit ihm beschäftigen, ihm sollte all mein Sinnen, Denken und Fühlen gewidmet sein, vielleicht, daß es mir mit der Zeit gelänge, auch aus diesem Menschen ein nützliches Mitglied der Gesellschaft zu machen. Ich wollte ihn in Schutz nehmen gegen jedermann, gegen die Vorgesetzten und gegen die Unteroffiziere, er sollte es gut bei mir haben. Ich wollte allmählich das Licht, das doch auch in seinem Gehirn flackern mußte, zu einer mächtigen Flamme anfachen. Aber vorläufig brannte das Licht, von dem ich träumte, wenn es überhaupt schon brannte, so niedrig, daß selbst der weise Diogenes mit seiner Laterne es nicht entdeckt hätte. Das zeigte sich mir in der ersten Instruktionsstunde. Ich hatte meine Kindlein um mich versamelt und sprach zu ihnen mit der ganzen Beredsamkeit, deren ich fähig war, von den beiden Hauptpflichten des Soldaten, von Vaterlandsliebe und Gehorsam gegen die Vorgesetzten. Ich wnadte mich an meinen Liebling: „Wie heißt doch Ihr Kaiser?”
Da schwieg der Mensch, mit homerischem Gelächter verspotteten ihn die Kameraden. Ich gebot Ruhe und erneuerte die Frage; so dumm konnte doch kein Mensch sein, er mußte meine Worte nicht verstanden haben. Langsam, klar und deutlich wiederholte ich meine Frage: „Wie heißt Ihr Kaiser?”
Da sah er mich einen Augenblick mit seinen großen blauen Augen an und sagte dann: „Herr Lieutenant, das ist so 'n ganz komischer Name, da kann ich mich im Augenblick wahrhaftig gar nicht drauf besinnen.”
Nun war es auch mit meinem Ernst vorbei, und wider Willen lachend, fragte ich weiter: „Weißt du denn wenigstens, wie du selbst heißt?”
Selig grinsend schaute er mich an.
„Zu Befehl, Herr Lieutenant.”
„Nun?”
„Wilhelm Köhm.”
Über Wilhelm Köhm, so hieß der Edle, entlud sich nun die ganze Schwere meines Zorns. Ich befahl ihm, den Namen unseres Kaisers hundertmal aufzuschreiben, damit er in Zukunft besser Bescheid wisse.
Pünktlich stellte er sich am Abend in meiner Wohnung ein und überreichte mir seine Strafarbeit, ich faltete den Bogen auseinander und sah sprachlos den Sünder an. Auf der ersten Zeile hatte er fein säuberlich, so gut seine steifen Finger es ihm erlaubten, „Wilhelm” geschrieben und darunter neunundneunzigmal Gänsefüßchen gezeichnet.
Über diese Frechheit war ich so erstarrt, daß ich zuerst gar keine Worte fand und mich nur mit der größten Anstrengung zu beherrschen vermochte.
„Wie kommen Sie zu dieser neuen Methode?” fragte ich ihn schließlich.
„Ich hab' es in der Schule immer so gemacht,” bestätigte er mit dem treuherzigsten Gesicht von der Welt. Es wurde mir klar, daß nur Dummheit, nicht aber Frechheit oder Unverschämtheit ihn zu diesem gänzlich unmilitärischen Schritt veranlaßt hatte.
Aber während sein Verstand in den Kinderschuhen stecken blieb, entwickelte sich sein Äußeres mehr und mehr. Schon nach wenigen Wochen hatte er eine ganz andere Haltung bekommen, und daß ihm die Anstrengungen des Dienstes gut bekamen, erfuhr ich aus einer Mitteilung seines Korporalschaftsführers, der mir erzählte, daß mein stolzer Rekrut jeden Tag, sage und schreibe, jeden Tag ein Kommißbrot im Gewichte von sechs Pfund aß. Aber merkwürdigerweise wurde er trotz dieses guten Appetits nicht dicker.
So kam de gefürchtete Tag der Vorstellung heran, die Leute sollten zeigen, was sie gelernt hatten. In vier Gliedern standen die Kerls da, angezogen wie die Puppen, kein Makel war an ihrem Anzug zu entdecken. Ich schritt noch einmal die Reihen entlang, die ängstlichen Gemüter hier und da durch ein Scherzwort beruhigend und ihnen Mut einflößend. So kam ich auch zu meinem Freunde Wilhelm Köhm. Ich klopfte ihm wohlwollend auf die Schulter: „Nur immer Mut, nicht verblüffen lassen, und wenn du gefragt wirst, antworte frisch drauf los, ganz einerlei was, nur nicht schweigen.”
In der Thür, die zu dem Exerzierhaus führte, zeigten sich die Adjutanten, und einen Augenblick später erschien der Regimentskommandeur, dem einige Minuten darauf der General folgte.
Die Vorstellung verlief wie immer, es wurde vor den Leuten alles gelobt, nur heimlich bekam man von Zeit zu Zeit einen „eingeschenkt”. Es ging alles ganz gut, bis den General schließlich der Teufel reiten mußte.
Auf einmal blieb er plötzlich vor meinem Freund Wilhelm Köhm stehen.
„Sage mal, mein Sohn, weißt du auch, wie dein Kaiser heißt?”
„Zu Befehl, Herr General.”
„Nun, wie heißt er denn?”
Keine Antwort erfolgte.
Ich hörte die Kameraden hinter mir kichern und fühlte, wie sie mich heimlich mit den Ellenbogen anstießen. Mir aber war gar nicht lächerlich zu Mute, der General sah mich ganz erstaunt an: „Ja, Herr Lieutenant, wenn Ihre Leute nicht einmal wissen, wie ihr Kaiser heißt, dann möchte ich nur wissen, was Sie ihnen überhaupt in den zwölf Wochen beigebracht haben! Es wird wohl nicht sehr viel sein, wie?”
„Zu Befehl, Herr General.”
„Nun, wenn Sie es selbst zugeben, brauche ich mich ja nicht länger aufzuhalten, übrigens ist meine Zeit auch abgelaufen. Guten Morgen, meine Herren.”
Damit war er verschwunden.
Nun erst merkte ich, welche Dummheit ich gemacht hatte! Das kommt von der militärischen Sprache, bei der die Worte „Ja” und „Nein” in Bann gethan sind, es ist eben alles „Zu Befehl”.
Nachdem der General uns verlassen, wurde die berühmte militärische Tonleiter gepfiffen; dem General folgte der Oberst, dem Obersten der Major, dem Major der Hauptmann. Alle gaben ihrem Zorn freimütigsten Ausdruck, und wenn ich nach ihren Worten hätte handeln wollen, so hätte ich noch an demselben Abend entweder meinen Abschied einreichen oder mich totschießen müssen. Aber ich that keins von beiden, sondern wartete nur auf den Augenblick, bis sich der Sturm der Beredsamkeit gelegt hatte, dann winkte ich mir den Sünder herbei. Ich ging mit ihm in einen stillen Winkel, wo uns nur der Himmel sah, und dort habe ich mit Wilhelm ein so ernstliches Wort gesprochen, daß er blau, rot, gelb und grün im Gesicht wurde. Mit schlagenden Gründen bewies ich ihm, daß sein Leben nicht einen Schuß Pulver wert sei, und wenn er nach meinen Worten hätte handeln wollen, dann hätte er dahin gehen müssen, wo das Wasser am tiefsten ist, aber auch er ließ mich ruhig reden.
Endlich hatte sich meine Wut gelegt, und ich winkte ihm, zu gehen. Aber er wich und wankte nicht, sondern blieb immer auf derselben Stelle stehen. Fragend sah ich ihn an, endlich faßte er Mut und trat auf mich zu: „Herr Lieutenant, ich hätte eine Bitte.”
„Nun?”
„Könnte ich nicht bei dem Herrn Lieutenant Bursche werden?”
Ich war sprachlos! Auf alles war ich gefaßt gewesen, daß er sich über mich beschweren, ja sich sogar vielleicht an mir vergreifen würde, auf alles Mögliche, nur auf das nicht.
Verwundert sah ich ihn an: „Weshalb willst du denn Bursche werden?”
„Herr Lieutenant, ich bin zu dumm,” entgegnete er, „ich kann mir noch so viel Mühe geben, ich lern' es doch nicht.”
„Und glaubst du, daß du als Bursche nichts zu lernen brauchst? Aber wenn du es willst, ich will mich gern für dich verwenden, daß du irgendwo Bursche wirst.”
„Kann ich nicht bei dem Herrn Lieutenant selbst bleiben?” Es klang so hilflos, so rührend, daß ich wieder stehen blieb und mich umsah.
„Aber weshalb willst du denn gerade zu mir?”
„Weil der Herr Lieutenant immer so gut mit mir gewesen sind und es immer so gut mit mir gemeint haben.”
Gerührt reichte ich ihm die Hand, ich schämte mich meiner Wut von vorhin, und mich verlangte, wieder gut zu machen, was ich gefehlt hatte. Noch an demselben Mittag hielt er seinen Einzug in meine Wohnung, und er hat mich bisher nicht verlassen. Er hat sich sehr zu seinem Vorteil verändert, er hat viel zugelernt.”
In demselben Augenblick betrat Wilhelm das Zimmer und stellte eine neue Flasche Rotwein vor uns hin.
„Sagen Sie,” fragte der Assessor, „können Sie mir wohl sagen, wie Ihr Kaiser heißt?”
Freudig lächelnd schaute Wilhelm ihn an: „Zu Befehl, Herr Lieutenant.” Er nannte alle Menschen Lieutenant, gleichviel, was sie waren.
„Nun, wie heißt er denn?”
„Ebenso wie ich.”
„Und wie heißen Sie denn?”
„Köhm.” Und stolz, voll Bewußtsein endlich einmal die Antwort nicht schuldig geblieben zu sein, schritt er zur Thür hinaus.
Die beiden Textfassungen dieser Humoreske unterscheiden sich in einigen wesentlichen Punkten:
|
Buchfassung: Titel: „Mein Bursche Wilhelm.” |
Fassung der „Indiana Tribüne” und des „Deutschen Beobachters”: Titel: „Mein Bursche Paul.” |
„Indiana Tribüne” vom 17.12.1893
Teil 1 |
Teil 4 |
Teil 7 |
Teil 2 |
Teil 5 |
Teil 3 |
Teil 6 |