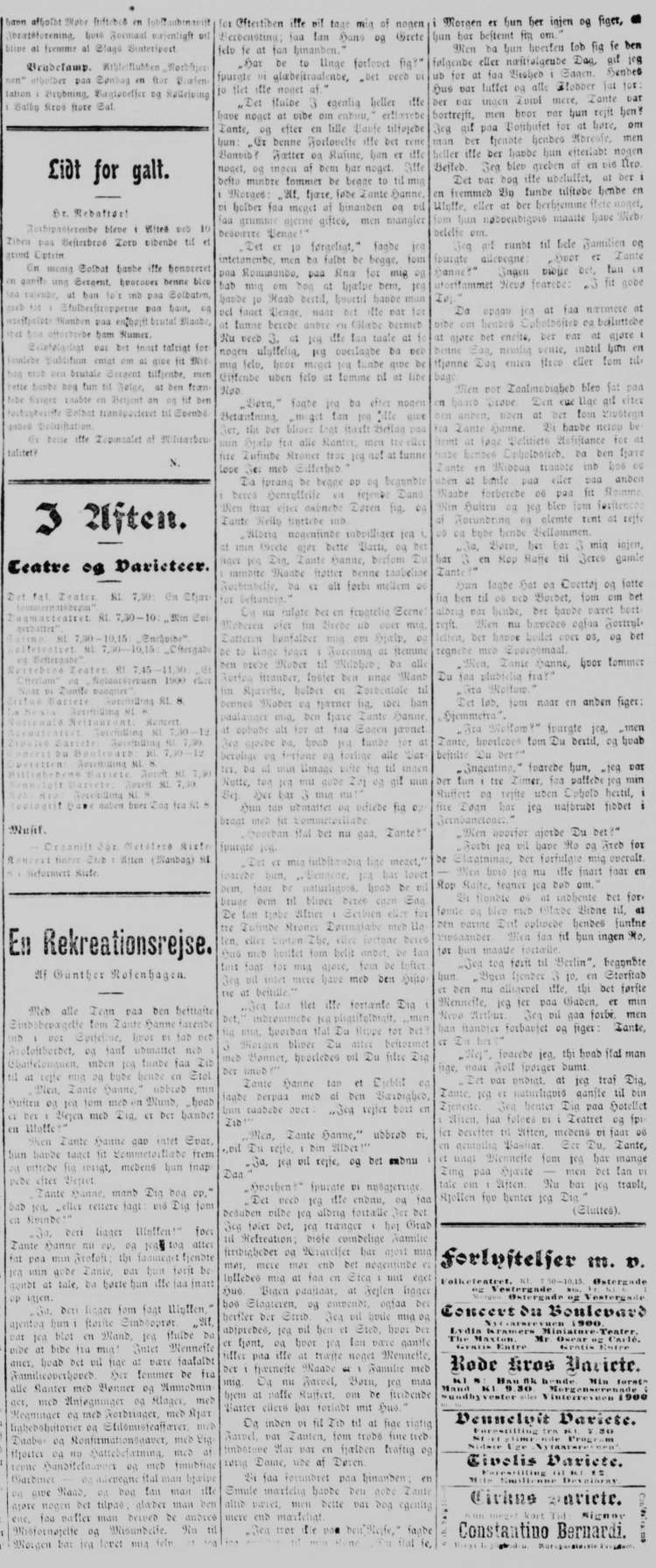
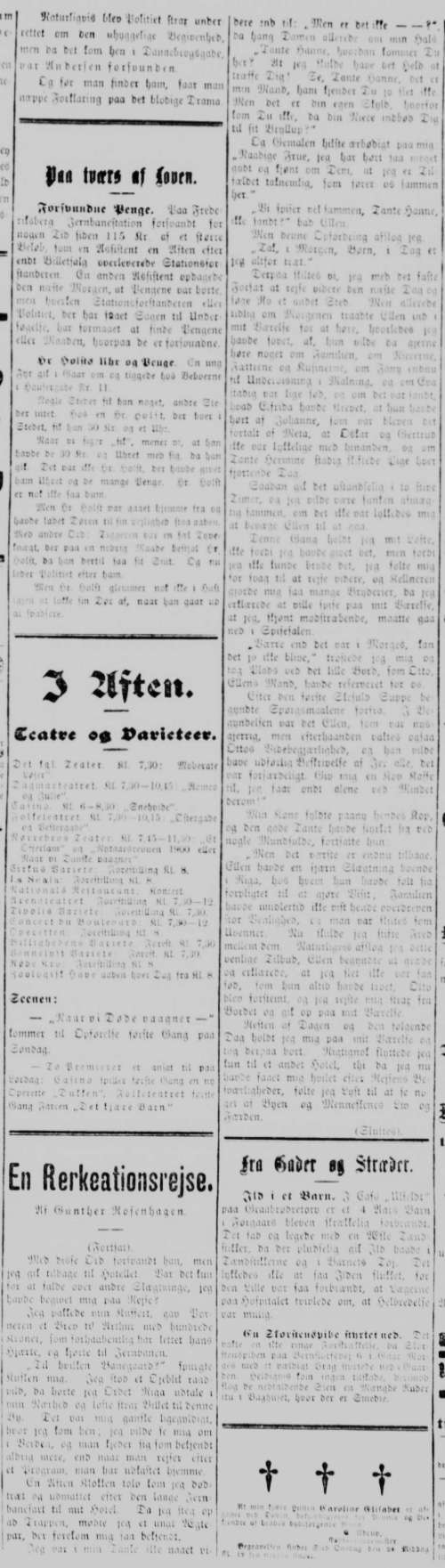
Humoreske von Graf Günther Rosenhagen
in: „Deutsche Lesehalle”,
Sonntags-Beilage des „Berliner Tageblatts”, Jahrgg. 895, Nr. 43 vom 27.Okt. 1895,
in: „Preßburger Zeitung” vom 8.12.1895,
in: „Aftonbladet” (Kopenhagen) vom 22.1. und 23.1.1900, Übersetzung ins Dänische
unter dem Titel „En Rekreationrejse”,
in: „Svenska Tidningen” vom 14.5.1919, Übersetzung ins Schwedische
unter dem Titel „Tant Hannas rekreationsresa”, und
in: „Ehestandshumoresken”.
Mit allen Anzeichen der höchsten Erregung stürzte Tante Hanna in unser Eßzimmer, in dem wir am Frühstückstisch saßen, und sank, bevor ich Zeit hatte, aufzustehen und ihr einen Stuhl anzubieten, ermattet auf einen Sessel nieder.
„Aber Tante Hanna,” riefen meine Frau und ich wie aus einem Munde, „was hast Du, ist ein Unglück passirt?”
Aber Tante Hanna antwortete nicht, sie hatte ihr Taschentuch gezogen und fächelte sich Luft zu.
„Aber Tante Hanna, ermanne Dich,” bat ich, „oder richtiger gesagt: werde zum Weib!”
„Hat sich was mit Weib!” fuhr Tante Hanna jetzt aber auf, und ich begann, mein Frühstück weiter zu verzehren; ich kenne meine gute Tante, hat sie zu sprechen angefangen, dann hört sie auch für das Erste nicht wieder auf.
„Hat sich was mit Weib!” wiederholte sie von Neuem mit der größten Erregtheit. „O, daß ich ein Mann wäre, damit ich mich wenigstens totschießen könnte, aber selbst das ist uns armen Frauen verwehrt, und doch ist dies Leben nicht mehr zu ertragen! Kein Mensch ahnt, was es heißt, das sogenannte Familienoberhaupt zu sein. Da kommen sie von allen Seiten mit Bitten und Flehen, mit Gesuchen und mit Klagen, mit Rechnungen und mit Forderungen, mit Liebesgeschichten und Scheidungsangelegenheiten, mit Kindtaufen und Konfirmationsgeschenken, mit Sterbehemden und neuem Hutbesatz, mit abgerissenen Handschuhknöpfen und mit schmutzigen Gardinen — und überall soll man rathen und helfen, und doch kann man es Keinem recht machen; erfreut man den Einen, so erregt man den Neid und die Mißgunst des Anderen. Nun habe ich mir aber heute Morgen zum unwiderruflich letzten Mal geschworen, ich kümmere mich um gar nichts mehr, mögen Hans und Grete sehen, wie sie ein Paar werden!”
„Die Kinder haben sich doch nicht etwa verlobt?” fragten wir erfreut, „davon wissen wir ja noch gar nichts.”
„Es sollte Euch ursprünglich noch geheim bleiben,” erklärte die Tante, und nach einer kleinen Pause setzte sie hinzu: „Ist diese Verlobung nicht ein Blödsinn? Vetter und Kusine, er ist nichts, und sie hat nichts. Und da kommen die Beiden heute Morgen zu mir an: sie in Thränen aufgelöst, er männlich gefaßt. „Ach liebe, süße Tante Hanna, wir haben uns so schrecklich lieb und wollen uns so schrecklich gern heirathen und haben doch so wenig Geld!”
„Das ist ja schrecklich,” sagte ich ahnungslos, und da fallen sie mir Beide wie auf Kommando zu Füßen und flehen und jammern, ich sollte ihnen doch helfen, ich hätte es ja, und wozu man es denn schließlich hätte, wenn man Anderen, die es nicht hätten, nicht eine Freude damit bereiten wollte. Ihr wißt, ich kann keinen Menschen weinen sehen, im Geiste überlegte ich schnell, wie viel ich dem zärtlich liebenden Paar geben könnte, ohne selbst Hunger leiden zu müssen.
„Kinder,” sprach ich nach einigem Bedenken, „viel kann ich Euch nicht geben, denn meine Hilfe wird viel in Anspruch genommen, aber drei- bis viertausend Mark im Jahr glaube ich Euch versprechen zu können.”
Da sprangen die Beiden, eben noch so Todestraurigen auf und führten vor mir einen Freudentanz auf. Schon aber öffnete sich die Thür, und herein stürzte Tante Nelly.
„Nie und nimmer willige ich ein, daß meine Grete diese Partie macht, und das sage ich Dir, Tante Hanna, wenn Du diese alberne Verlobung etwa dadurch unterstützen solltest, daß Du ihnen Geld zur Heirath versprichst, dann ist es aus für alle Zeiten.”
Und nun entstand der richtige Familienkampf. Die Mutter schalt mich, und die Tochter flehte mich an, ihr zu helfen, klammerte sich an den Verlobten und fiel mit diesem der gestrengen Mutter zu Füßen, der Bräutigam küßte beruhigend seine Braut, hielt seiner Schwiegermutter in spe eine donnernde Rede und bat mich, des Versprechens, das ich gegeben, zu gedenken, und ich suchte, alle Parteien zu beruhigen und zu versöhnen und zu vereinen, und als mir dies nicht gelang, ging ich in meine Schlafstube, setzte mir diesen Hut auf und floh davon. So, und nun bin ich hier.”
Erschöpft hielt sie inne und fächelte sich von Neuem Luft zu.
„Und was soll nun werden, Tante?” fragte ich.
„Ist mir ganz einerlei,” entgegnete sie, „das Geld, das ich versprochen habe, bekommen sie, was sie damit anfangen, ist ihre Sache, sie können davon heirathen oder nicht heirathen, sie können davon einen Theil der Serbischen Koupons einlösen oder sich für 3000 Mark Döringsseife mit der Eule oder Lipton-Thee kaufen, sie können für das Geld das Heim mit Diaphanien schmücken, mit Luft waschen, mit Gas kochen oder dafür Erdmannsdörfer trinken, mir soll alles recht sein. Ich will von der ganzen Geschichte nichts hören und sehen.”
„Verdenken kann ich Dir das schließlich nicht,” pflichtete ich ihr bei, „aber sage mir, wie Du das anfangen willst? Morgen schon wirst Du von Neuem mit Bitten bestürmt werden, wie willst Du dem entgehen?”
Tante Hanna schwieg einen Augenblick und sprach dann mit der ganzen Würde eines Familienoberhauptes: „Ich werde verreisen.”
„Aber Tante Hanna,” riefen wir, ”Du und verreisen!”
„Jawohl, ich werde reisen, und zwar noch heute.”
„Und wohin?” fragten wir neugierig.
„Erstens weiß ich es noch nicht, und zweitens würde ich es Euch nicht sagen. Ich fühle es, ich bedarf dringend der Erholung, dieser ewige Familienärger und diese beständigen Familienstreitigkeiten haben mich mürbe gemacht, mürber, als jemals ein Braten in meinem Hause ist. Das Mädchen behauptet, das liege am Schlächter, und umgekehrt, auch da ewiger Streit. Ich will mich erholen und zerstreuen, ich will irgendwohin, wo es schön ist, und wo ich ganz sicher bin, keinen Menschen zu finden, der auch nur im Entferntesten mit uns verwandt ist. Und nun Adieu, Kinder, ich will meine Koffer packen, die streitenden Parteien werden mein Haus jetzt hoffentlich geräumt haben — wenn nicht, so warte ich so lange vor der Hausthür und fahre eventuell einen Zug später.”
Und ehe wir noch ein Wort des Abschieds hätten sagen können, war die Tante, trotz ihrer sechzig Jahre eine selten rüstige Frau, zur Thür hinaus gegangen.
Verwundert blickten wir uns an, ein klein bischen sonderbar war die Tante immer gewesen, aber dies war denn doch eigentlich mehr als sonderbar.
„Ich glaube nicht an ihre Reise,” sagte ich endlich zu meiner Frau, „paß auf, morgen ist sie wieder hier und sagt, sie hätte sich die Sache anders überlegt.”
Als sie aber am nächsten und auch übernächsten Tage nicht zu uns kam, ging ich, um mich nach ihr umzusehen. Jedoch ihr Haus war verschlossen, die Läden und Rouleaus herabgelassen: kein Zweifel, sie war thatsächlich verreist, aber wohin? Ich ging zur Post, um mich zu erkundigen, ob man dort ihre Adresse wüßte, aber auch dort hatte sie keinen Bescheid hinterlassen, und die Beamten wußten nicht, wohin die Briefe und Zeitungen nachgesandt werden sollten. Eine gewisse Unruhe überkam mich. Es war doch nicht ausgeschlossen, daß ihr irgendwie ein Unglück zustieß, daß hier irgendwas passirte, das ihr mitgeteilt werden mußte, ihr Haus könnte abbrennen oder bestohlen werden, das Wasserrohr könnte platzen und alles ruiniren, was konnte nicht alles eintreten? Und man wußte nicht einmal, wohin man dies alles hätte melden sollen. Ich ging zu allen Verwandten und fragte überall: „Wo ist Tante Hanna?” Keiner wußte es, nur ein unverschämter Neffe antwortete: „In ihren Kleidern.”
Da gab ich es auf, Näheres über ihren Aufenthalt zu erfahren, und entschloß mich, das Einzige zu thun, was mir unter diesen Umständen übrig blieb, nämlich zu warten, bis sie entweder eines Tages schreiben würde, oder bis sie wiederkäme.
Aber unsere Geduld wurde auf eine harte Probe gestellt. Eine Woche verging nach der anderen, von Tante Hanna bekamen wir kein Lebenszeichen. Es war über ein Vierteljahr vergangen seit dem Tage, da sie zum letzten Mal bei uns gewesen war, und wir Alle glaubten, daß sie Gott weiß wo gestorben wäre. Schon wollten wir uns an die Gerichte wenden und ein Inserat in die gelesensten Zeitungen einrücken und sie als „verschollen” inseriren, als diese eines Mittags, als wir beim Kaffee saßen, unangemeldet und ohne anzuklopfen zu uns in das Zimmer trat. Meine Frau und ich selbst waren erstaunt, daß ich wie versteinert auf meinem Stuhl sitzen blieb.
„Na, Kinder, da bin ich wieder, habt Ihr noch eine Tasse Kaffee für mich?”
Sie legte Hut und Mantel ab und setzte sich zu uns an den Tisch, als wenn sie nie fort gewesen wäre. Nun löste sich auch der Bann, der uns gefangen hielt, und jetzt begann das Fragen.
„Aber, Tante Hanna, wo kommst Du denn nur so plötzlich her?”
„Aus Moskau.”
Das klang, als wenn ein Anderer sagt: „Von Hause.”
„Aus Moskau?” fragte ich fassungslos, „aber Tante, wie kamst Du denn dahin, und was hast Du denn da gemacht?”
„Nichts,” erwiederte sie, „drei Stunden bin ich nur dagewesen, da habe ich meinen Koffer gepackt und bin ohne Aufenthalt hierher gefahren, sechsundneunzig Stunden habe ich ohne Unterbrechung in der Eisenbahn gesessen.”
„Aber warum dies alles?”
„Weil ich Ruhe haben will, Ruhe vor den Verwandten, die mich verfolgten, wohin ich kam. — Wenn ich nun aber nicht bald eine Tasse Kaffee bekomme, falle ich tot um.”
Wir beeilten uns, das Versäumte nachzuholen, und mit Vergnügen sahen wir, wie das warme Getränk ihre schwachen Lebenskräfte stärkte. Dann aber ließen wir ihr keine Ruhe mehr, und sie mußte erzählen.
„Zuerst also fuhr ich nach Berlin,” begann dieselbe. „Berlin ist eine sehr schöne Stadt, na, Ihr kennt sie ja Alle. Aber Berlin ist nicht nur eine Großstadt, sondern sie ist auch eine Kleinstadt, wie der Schriftsteller Paul Lindenberg in seinem Buche auseinandersetzt. Ich habe dem Manne nie glauben wollen, und doch hat er Recht, denn denkt Euch: der erste Mensch, den ich unter den Linden sehe, ist mein Neffe Arthur. Schon will ich vorbeigehen, da bleibt er plötzlich stehen, sieht mich groß an und sagt: „Tante, Du auch hier?”
„Nein,” antwortete ich, denn was soll man auf eine so dumme Frage anders sagen; aber der gute Neffe will sich vor Lachen ausschütteln.
„Nein, Tante, das ist zu nett, daß ich Dich hier treffe, natürlich stehe ich ganz zu Deiner Verfügung. Ich hole Dich heute Abend aus Deinem Hotel ab, dann gehen wir in das Theater, soupiren irgendwo gut und erzählen uns allerlei. Weißt Du, Tante, ein so junger Mensch, wie ich, hat so manches auf seinem Herzen, — na, darüber sprechen wir heute Abend. Jetzt muß ich fort, also heute Abend um sieben Uhr hole ich Dich ab.”
Damit war er verschwunden; und fast ohnmächtig erreichte ich mein Hotel. War ich denn auf Reisen gegangen, um gleich hier anderen Verwandten in den Weg zu laufen?
Ich packte meinen Koffer, hinterließ bei dem Portier einen Brief für Arthur mit einem Hundertmarkschein, der sein Herz hoffentlich etwas erleichtert hat, und fuhr nach dem Bahnhof.
„Nach welchem?” fragte mich der Kutscher.
„Nach dem, der am weitesten fort ist,” entgegnete ich.
Dort angekommen, fragte ich mich, wo ich denn nur eigentlich hinwolle. Noch stehe ich im Nachdenken versunken, als ich plötzlich zwei Herren neben mir russisch sprechen hörte. Ich verstand nur das Wort Riga, und eine Stunde später befand ich mich auf der Reise dorthin. Mir war ganz einerlei, wo ich hinfuhr, ich wollte die Welt etwas sehen, und man langweilt sich bekanntlich nie mehr, als wenn man nach einem Programm reist, das man sich zu Hause entworfen hat.
Eines Abends um zwölf Uhr kam ich todtmüde, zerschlagen und ermattet von der langen Eisenbahnfahrt in meinem Hotel an. Ich steige die Treppe in die Höhe, da begegnet mir ein junges Ehepaar, das mir so bekannt vorkommt.
„Herr Gott, ist das nicht —” will ich denken, aber schon fliegt sie mir um den Hals.
„Tante Hanna, wo kommst Du her? Nein, aber auch, daß ich Dich hier treffen muß! Sieh, Tante Hanna, das ist mein Mann, den kennst Du ja noch gar nicht. Das ist aber Deine eigene Schuld, warum kamst Du auch nicht, wenn Deine Nichte Dich zur Hochzeit einladet?”
Und er küßt mir die Hand und sagt: „Meine gnädige Frau, ich habe schon so viel Liebes und Gutes über Sie gehört, daß ich dem Zufall dankbar bin, der uns hier zusammenführt.”
„Nicht wahr, Tante Hanna,” bat Ellen, „wir essen jetzt doch zusammen, ich bin zum Sterben hungrig.”
Aber ich lehnte ab.
„Morgen, Kinder, morgen, heute bin ich zu müde und angegriffen.”
Dann trennten wir uns, ich mit der festen Absicht, am nächsten Tage wieder abzureisen und wo anders Ruhe zu suchen. Aber schon in aller Frühe trat Ellen in mein Zimmer, um sich zu erkundigen, wie ich geschlafen hätte, ach, und dann wollte sie gern etwas von den Verwandten wissen, von den Nichten, Vettern, Basen und Kusinen, ob Fanny noch Malstunden habe, und ob Eva noch immer so süß sei wie früher, und ob Paul versetzt werde, und ob Eva noch immer keine Aussicht habe, sich zu verloben, und ob es wahr sei, was Elfriede ihr geschrieben, daß Johanna es von Meta gehört habe, daß Oskar und Gertrud nicht glücklich mit einander wären, ob Martha noch immer „das verschossene schottische” trüge, und ob Tante Hermine noch immer alle vierzehn Tage ein anderes Dienstmädchen hätte.
So ging das zwei Stunden hinter einander, und ich würde ohnmächtig geworden sein, wenn es mir nicht endlich gelungen wäre, Ella zum Fortgehen zu bewegen.
Dieses Mal hielt ich mein Versprechen, nicht weil ich es gegeben hatte, sondern weil ich es nicht brechen konnte, ich fühlte mich zu schwach, um abzureisen, und der Kellner machte mir so viele Schwierigkeiten, als ich erklärte, auf meinem Zimmer speisen zu wollen, daß ich nolens volens, wie es ja wohl heißt, in den Speisesaal hinab gehen mußte.
„Schlimmer, als es heute Morgen war, kann es ja nicht werden,,” tröstete ich mich und nahm an dem kleinen Tische Platz, den Otto, Ellens Gatte, für uns reservirt hatte.
Natürlich war das Gespräch nach dem ersten Löffel Suppe bei den Verwandten angelangt, und die Fragerei begann von Neuem. Zuerst war nur Ellen neugierig, dann begann aber auch Ottos Wissensdrang lebendig zu werden, er ist uns Allen ja noch persönlich unbekannt, wie wir ihm, und so wollte er denn wissen, wer Ernst und Fanny, und wie sie Alle heißen, seien. Kinder, es war schrecklicn, und, gebt mir noch eine Tasse Kaffee, mir wird noch schlecht allein bei der Erinnerung!”
Meine Frau füllte ihre Tasse von Neuem, und nachdem diese sich durch einige Schlucke gestärkt hatte, fuhr sie fort:
„Aber das Schlimmste kommt noch. Ellen hatte es ausfindig gemacht, daß in Riga ein weitläufiger Verwandter von ihr wohne, ein Kaufmann, dessen Name ich mich nicht mehr erinnere. Die Mütter der beiden Väter waren Kusinen zweiten Grades gewesen, und so hatte Ellen sich denn bewogen gefühlt, den lieben Verwandten einen Besuch abzustatten.
Der Empfang war mehr denn frostig gewesen, die Frau des Hauses hatte nicht gewußt, was sie mit ihrem Gast anfangen sollte, die Töchter waren kaum aufgestanden, als Ellen in das Zimmer trat, und hatten unterlassen, ihr, der verheiratheten Frau, die Hand zu küssen, kurz und gut, Ellen war über die Aufnahme, die sie gefunden, mehr denn außer sich, und ich, ich sollte den Frieden stiften. Natürlich lehnte ich dieses freundliche Anerbieten dankend ab, Ellen fing an zu weinen und erklärte, ich wäre gar nicht so süß, wie sie es sich gedacht hätte, Otto wurde verstimmt, und ich erhob mich gleich nach Tisch und ging auf mein Zimmer.
Drei Tage lag ich zu Bett und war für keinen Menschen zu sprechen, dann machte ich mich auf und floh davon. Zunächst ging ich nur in ein anderes Hotel, denn mir lag daran, nachdem ich mich nun endlich von den Anstrengungen der Reise erholt hatte, etwas von der Stadt und dem Leben und Treiben der Menschen zu sehen. Nichts Böses ahnend, verlasse ich eines Morgens mein Hotel, um etwas durch die Straßen zu schlendern, aber kaum war ich fünf Schritte gegangen, als ich wie versteinert stehen blieb. In unmittelbarer Nähe gingen Ellen und ihr Mann an mir vorüber. Beide erkannten mich, ich sah es ihren Gesichtern an, aber Beide grüßten mich nicht. Kinder, das war zu viel für mich, für eine alte Frau, deren größter Fehler von jeher ein rasender Jähzorn war. Ich ging den Beiden nach, und es kam zu einer Auseinandersetzung, die an Deutlichkeit auf beiden Seiten nichts zu wünschen übrig ließ. Als ich mein Hotel wieder erreichte, war ich tödter als todt. Wochenlang habe ich zu Bett gelegen und bin vor Wuth und Aerger so krank gewesen, daß ich glaubte, ich würde nie wieder aufstehen können. Bei Nacht und Nebel machte ich mich endlich auf und reiste weiter: nach Moskau. Ich hätte ebenso gut nach Palästina fahren können, mir war alles recht, nur nach einem Ort auf der Erde, wo ich sicher war, keinen Verwandten zu finden. Vierzig Stunden saß ich in der Eisenbahn und ließ mich durchschütteln, daß mein Unterstes nach oben kam und umgekehrt. Aber der Himmel sorgt bekanntlich dafür, daß auch die Leiden der Menschen ein Ende nehmen. Endlich waren wir am Ziel. Verzweifelt stehe ich auf dem Perron und sehe mich um, russisch kann ich nicht, französisch verstehe ich nicht, und mein Deutsch wurde nicht verstanden.
Da sagt plötzlich eine Stimme neben mir: „Wenn Du nicht Tante Hanna bist, bin ich nicht Dein Vetter Theodor.”
„Hab' Erbarmen, Herr im Himmel!” flehte ich im Stillen, „auch der noch!” und in meinem aufrichtigen Erstaunen fragte ich: „Aber Theodor, wie kommst Du denn hierher?”
„Das ist eine ganz merkwürdige Geschichte,” entgegnete er, „die erzähle ich Dir nachher. Wir frühstücken doch zusammen, ich habe einen blödsinnigen Hunger.”
Ein Gefühl der Dankbarkeit überkam mich, es war doch nett, daß er sich meiner so annahm, er kannte die Stadt nach allen Richtungen der Windrose und versprach, mir alles zu zeigen. Wenige Minuten später fuhren wir nach einem Restaurant; das Essen war gut und der Wein ausgezeichnet, aber als Theodor anfing, mir seine Lebensgeschichte zu erzählen, schmeckte mir plötzlich gar nichts mehr. Er brauchte Geld, viel Geld, er hatte sich schon immer vorgenommen, mir zu schreiben; auf sein Erbtheil hin, das er von mir bekommt, hatte der alte Junge Schulden gemacht, und nun saß ihm das Messer an der Kehle.
„Gut,” sprach ich, „lieber Theodor, das Geld gehört Dir von Rechtswegen, und Du kannst es gleich haben, aber nur unter der Bedingung, daß Du Dich sofort erkundigst, mit welchem Zug ich nach Hause fahren kann, ich verspüre plötzlich ein gewaltiges Heimweh.”
Drei Stunden später saß ich im Zug, und nun bin ich hier. Kinder, gebt mir noch eine Tasse Kaffee, damit ich wenigstens etwas von meiner Erholungsreise habe.”
Lachend erfüllten wir ihren Wunsch.
„Und wann trittst Du Deine nächste Erholungsreise an?” fragte ich sie zum Abschied.
Einen Augenblick schwieg die Tante, dann sagte sie: „Wäre ich jung, daß ich hoffen könnte, Euch Alle zu überleben, so würde ich reisen, wenn Ihr Alle todt seid. Da ich aber alt und grau bin, bleibe ich fortan zu Hause. Familienstreitigkeiten entgeht man nirgends, es sei denn, daß ein neuer Kolumbus ein neues Land entdeckt und vor demselben eine Tafel anbrächte mit den Worten: „Blutsverwandten ist der Aufenthalt hier untersagt.”
„Aftenbladet” (Kopenhagen) vom 22.1. und 23.1.1900:
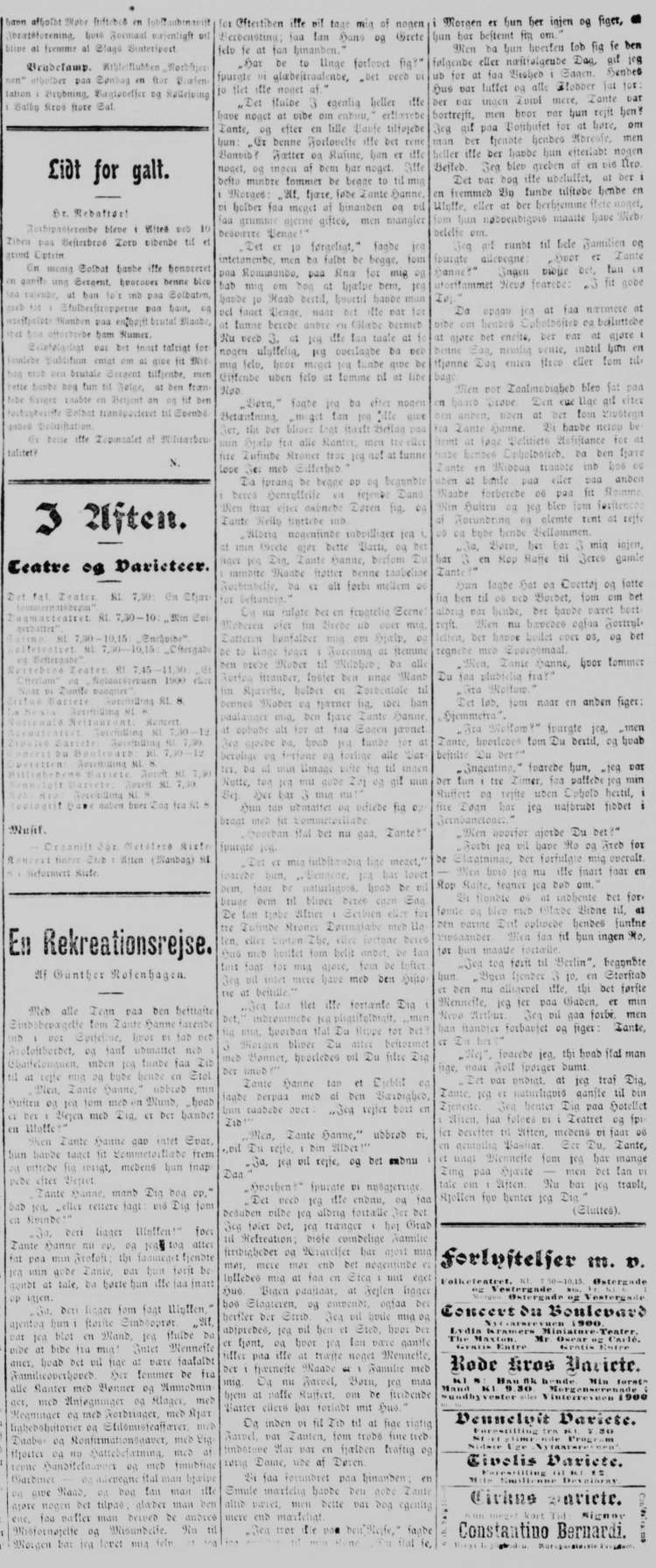
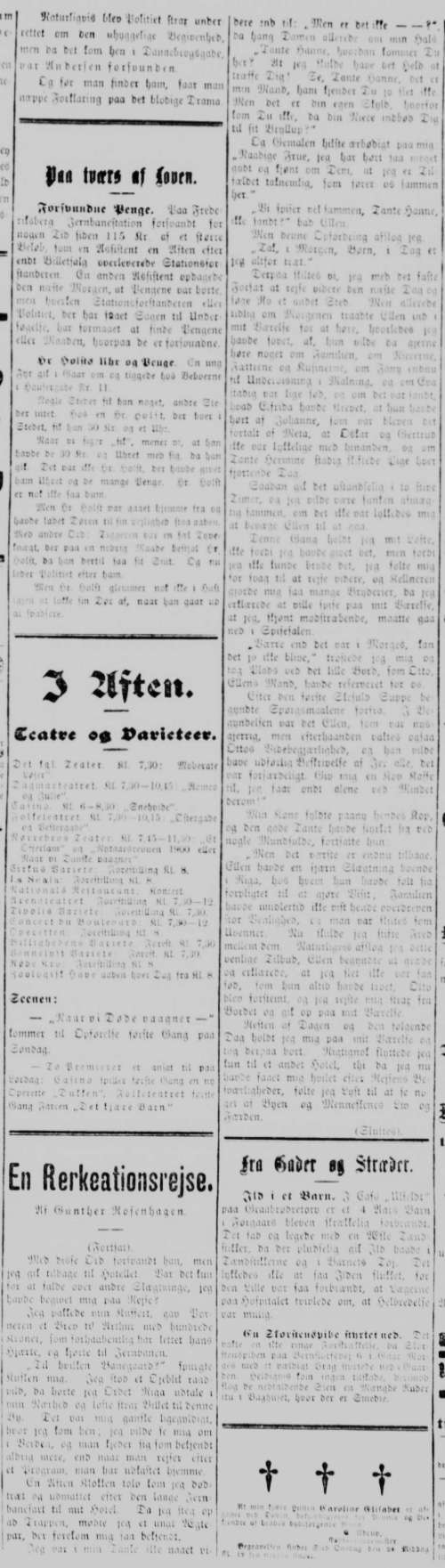
„Svenska Tidningen” vom 14.5.1919:
