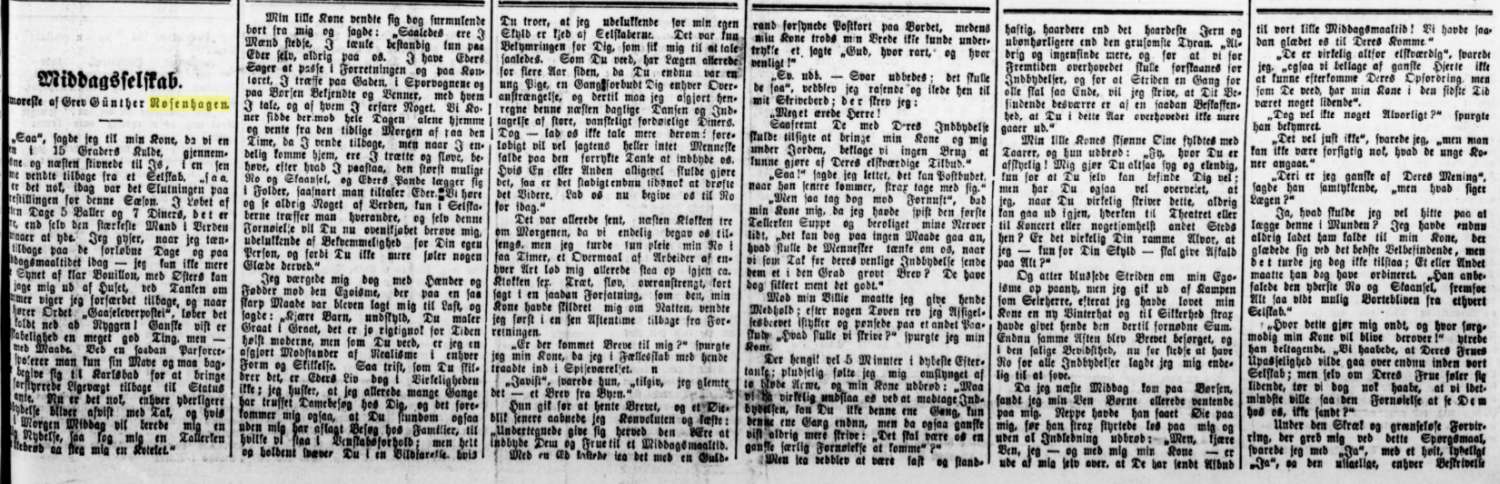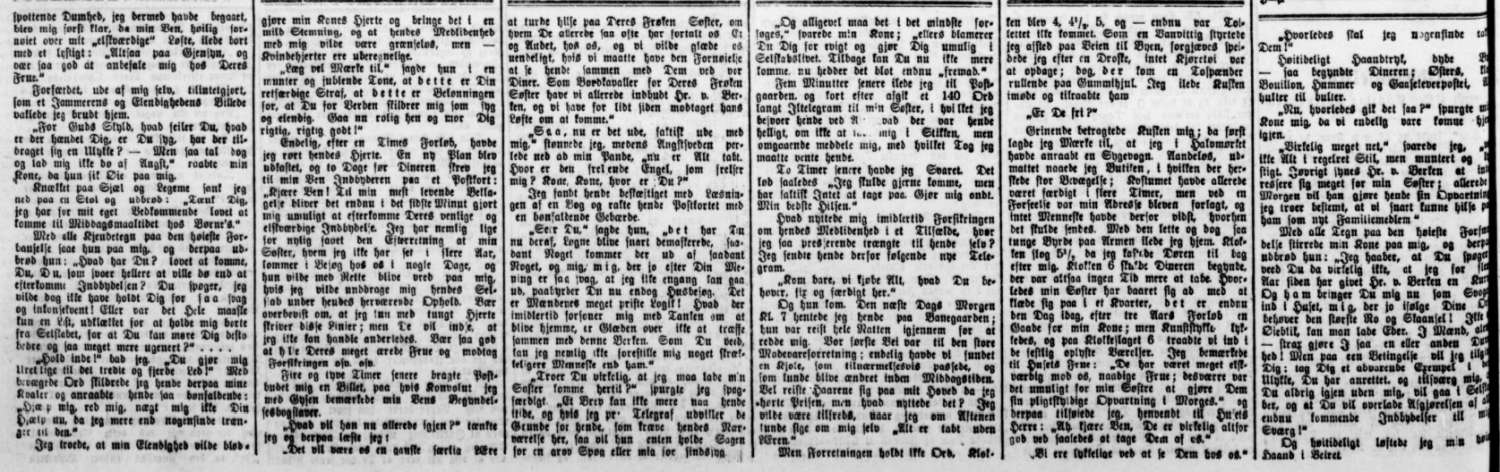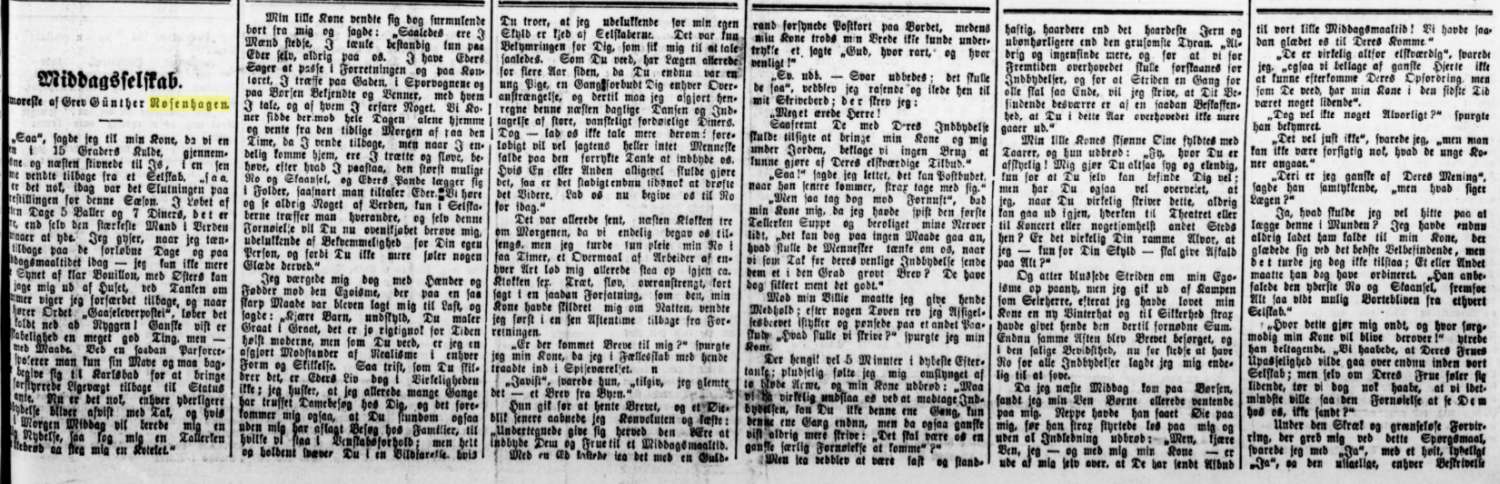
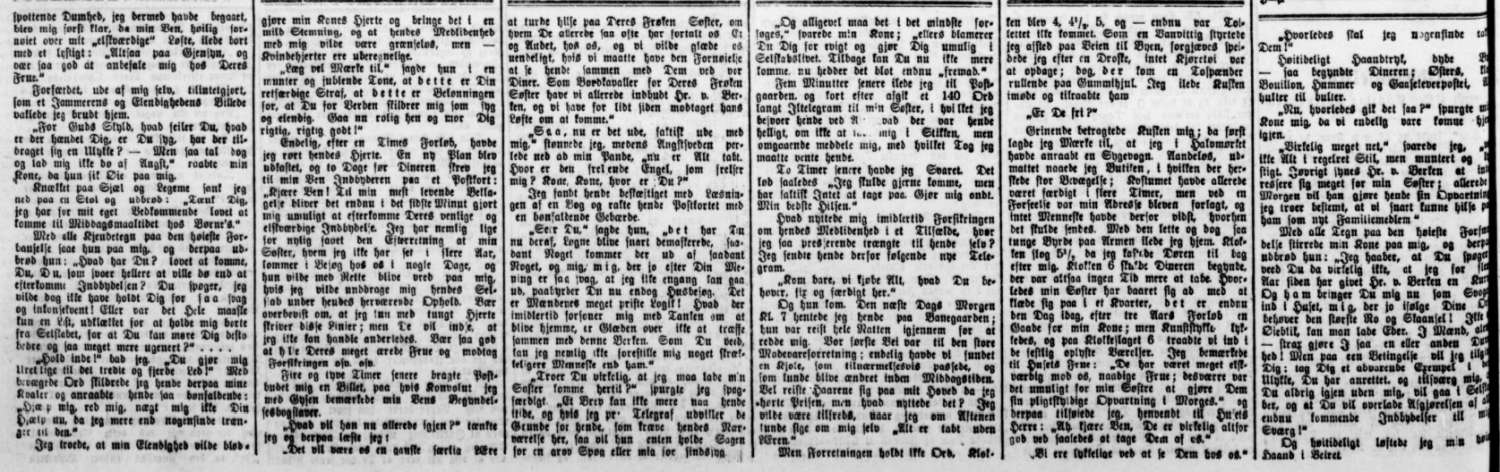
Humoreske von Graf Günther Rosenhagen.
in: „Zeitung für Stadt und Land”, (Riga), vom 13.3.1894,
in: „Leipziger Tageblatt und Anzeiger” vom 15.3.1894,
in: „Kieler Zeitung” vom 15.3.1894,
in: „Agramer Zeitung” vom 17.3.1894,
in: „Nationaltidende” vom 15.4.1894, (in dänisch unter dem Titel „Middagsselskab”),
in: „Ringsted Folketidende” vom 18.4.1894, (in dänisch unter dem Titel „Middagsselskab” — Rest fehlt),
in: „Humoresken” und
in: „Humoresken und Erinnerungen”.
„So,” sagte ich zu meiner Frau, als wir eines Abends bei fünfzehn Grad Kälte durchfroren und beinahe zu Eis erstarrt in später Stunde aus einer Gesellschaft zurückkehrten, „so, nun ist es genug, heute war Schluß der Vorstellung für diese Saison. In vierzehn Tagen fünf Bälle und sieben Diners, das ist mehr, als selbst der stärkste Mann der Welt zu leisten vermag. Mich schauderts, wenn ich an die verflossenen Tage und an das heutige Mittagessen zurückdenke, ich kann keine klar Bouillon mehr sehen, mit Austern kannst Du mich aus dem Hause jagen, bei dem Gedanken an Hummer weiche ich entsetzt zurück, und wenn ich das Wort „Gänseleberpastete” höre, bekomme ich die Gänsehaut auf dem Buckel. Gewiß ist Geselligkeit sehr nett, aber Alles mit Maßen. Bei dieser Parforcetour verdirbt man sich nur den Magen und kann hinterher wieder nach Karlsbad fahren, um das gestörte Gleichgewicht wieder auf den status quo ante zu bringen. Nun ist es genug, jede weitere Einladung wird dankend abgelehnt, und wenn Du mir morgen Mittag einen besonderen Genuß bereiten willst, dann koche mir einen Teller Milchsuppe und brate mir ein Cotelette.”
Aber schmollend wandte sich meine kleine Frau von mir ab: „So seid Ihr Männer stets, immer denkt Ihr nur an Euch, nie an uns. Ihr habt draußen im Geschäft und im Contor zu thun, Ihr trefft auf der Straße, in der Pferdebahn und an der Börse Bekannte und Freunde, mit denen Ihr sprecht und von denen Ihr etwas erfahrt. Wir Frauen sitzen den ganzen Tag allein zu Hause und warten vom frühen Morgen an auf die Stunde, da Ihr zurückkehrt, aber wenn Ihr endlich heimkommt, seid Ihr müde und abgespannt, bedürft, wie Ihr behauptet, der denkbar größten Ruhe und Schonung und Eure Stirn legt sich in Falten, sobald man Euch anredet. Wir hören und sehen nie etwas von der Welt, nur auf den Gesellschaften trifft man sich, und selbst dieses Vergnügen willst Du mir nun noch rauben, lediglich aus Bequemlichkeit für Deine eigene Person und weil Du daran keine Freude mehr empfindest.”
Aber mit Händen und Füßen wehrte ich mich gegen den mir in so schroffer Weise zur Last gelegten Egoismus. „Liebes Kind, ich bitte Dich, Du malst Grau in Grau, es ist ja zwar zur Zeit hoch modern, aber Du weißt, ich bin ein entschiedener Gegner des Realismus in jeglicher Form und Gestalt. So traurig, wie Du es schilderst, ist Euer Leben nun doch noch nicht, ich erinnere mich, schon manchmal Damenbesuch bei Dir angetroffen zu haben, auch ist es mir, als wenn Du zuweilen auch ohne mich befreundete Familien aufgesucht hättest. Ganz aber befindest Du Dich in einem Irrthum, wenn Du glaubst, daß ich lediglich meinetwegen der Gesellschaften überdrüssig bin, nur die Sorge um Dich war es, die mich also sprechen ließ. Du weißt, vor Jahren schon, als Du noch ein junges Mädchen warst, hat Dir der Arzt einmal jede Ueberanstrengung verboten, und dazu muß ich dieses fast tägliche Tanzen und das Einnehmen großer, schwerer Diners entschieden rechnen. Doch sprechen wir nicht mehr darüber, vorläufig wird auch wohl kein Mensch auf den verruchten Gedanken kommen, uns einzuladen, thäte es dennoch Einer, so ist es immer noch Zeit, das Weitere zu besprechen. Für heute laß uns schlafen gehen.”
Es war schon spät, fast drei Uhr Morgens, als wir endlich unser Lager aufsuchten, aber ich durfte nur wenige Stunden der Ruhe pflegen, ein Uebermaß von Arbeiten jeglicher Art ließ mich schon um sechs Uhr wieder aufstehen. Müde, abgespannt, überarbeitet, kurz in einer Verfassung, wie meine Frau sie mir in der Nacht geschildert hatte, kehrte ich erst in später Abendstunde aus dem Geschäft zurück.
„Sind Briefe angekommen?” fragte ich meine Frau, als ich gemeinschaftlich mit ihr das Eßzimmer betrat.
„Ja gewiß,” entgegnete sie, „verzeih, ich vergaß, ein Brief aus der Stadt.”
Sie ging, den Brief zu holen, und einen Augenblick später öffnete ich das Couvert und las:
„Die Unterzeichneten geben sich die Ehre, Sie und Ihre Frau Gemahlin zu einem Mittagessen ganz ergebenst einzuladen.”
Mir einem Fluch warf ich die goldumränderte Karte auf den Tisch, während meine Frau trotz meines Zorns ein leises: „Gott, wie schön, wie freundlich!” nicht unterdrücken konnte.
„U.A.w.g. Um Antwort wird gebeten — die soll ihnen werden,” fuhr ich wüthend fort und eilte an meinen Schreibtisch, dort schrieb ich:
„Sehr geehrter Herr!
Falls Sie mit Ihrer Einladung bezwecken sollten, meine Frau und mich unter die Erde zu bringen, so bedauern wir, von Ihrem liebenswürdigen Anerbieten keinen Gebrauch machen zu können.”
„So,” sagte ich erleichtert, „das kann der Briefbote, wenn er nachher kommt, gleich mitnehmen.”
„Aber so nimm doch Vernunft an,” bat mich meine Frau, als ich den ersten Teller Suppe gegessen und meine Nerven etwas beruhigt hatte, „das geht doch nicht, was sollen die Leute von uns denken, wenn wir ihnen als Dank für ihre freundliche Einladung einen derartig groben Brief ins Haus schicken, sie haben es doch gewiß gut gemeint.”
Ich mußte ihr wider Willen beistimmen, ich zerriß nach einiegem Zögern die Absage und sann über eine andere Ausrede nach. „Was schreiben wir denn nur?”
Wohl fünf Minuten vergingen im tiefsten Nachdenken, plötzlich fühlte ich mich von zwei weichen Armen umschlungen.
„Müssen wir denn wirklich absagen, kannst Du denn nicht dies eine Mal, nur dies eine Mal noch, aber dann auch ganz gewiß nie und nimmer wieder, schreiben: Wir kommen mit ganz besonderem Vergnügen?”
Aber ich blieb fest und standhaft, härter als das härteste Eisen und unerbittlicher als der grausamste Tyrann. „Nie und nimmermehr, und damit wir in Zukunft überhaupt mit Einladungen verschont bleiben und der Streit ein für alle Mal ein Ende hat, werde ich schreiben, Dein Befinden sei leider Gottes ein derartiges, daß Du in diesem Jahr überhaupt nicht mehr ausgingst.”
Die schönen Augen meiner kleinen Frau füllten sich mit Thränen. „Pfui, wie scheußlich Du bist! Also mich machst Du krank und elend, nur damit Du Dich wohl befindest. Aber hast Du Dir auch wohl überlegt, daß ich, wenn Du dies wirklich schreibst, nie und nimmer wieder ausgehen kann, weder ins Theater, noch in das Concert, noch sonst irgend wohin? Ist es wirklich Dein heiliger Ernst, daß ich Allem entsagen soll, nur Deinetwegen?”
Und wieder entbrannte der Streit über meinen Egoismus von Neuem, aber ich ging als Sieger aus dem Kampfe hervor, nchdem ich meiner Frau einen neuen Winterhut versprochen und ihr zur Sicherheit gleich die dafür nöthige Summe gegeben hatte. Noch an demselben Abend wurde der Brief besorgt, und in dem seligen Bewußtsein, jetzt für immer vor allen Einladungen Ruhe zu haben, legte ich mich endlich schlafen.
Als ich am nöächsten Mittag auf die Börse kam, fand ich meinen Freund Börne bereits meiner wartend. Kaum erblickte er mich, als er auch schon auf mich losstürzte: „Aber, ich bin außer mir, lieber Freund,” begann er ohne weitere Einleitung, „und mit mir meine Frau, daß Sie zu unserem kleinen Mittagessen abgesagt haben! Wir hatten uns so auf Ihr Kommen gefreut.”
„Sie sind wirklich zu liebenswürdig,” entgegnete ich, „auch wir bedauern von ganzem Herzen, Ihrer Aufforderung nicht entsprechen zu können, aber Sie wissen, meine Frau ist in der letzten Zeit etwas leidend.”
„Doch nichts Ernstliches?” fragte er besorgt.
„Das nun gerade nicht,” erwiderte ich, „aber man kann bei jungen Frauen nie vorsichtig genug sein.”
„Da bin ich ganz Ihrer Ansicht,” pflichtete er mir bei, „und was sagt der Arzt?”
Ja, was sagte der blos? Ich hatte ihn noch nie zu meiner Frau rufen lassen, die sich des besten Wohlseins erfreute, aber das durfte ich doch nicht zugeben, irgend Etwas mußte er doch verordnet haben. „Er empfahl die äußerste Ruhe und Schonung, vor allen Dingen möglichstes Fernbleiben jeder Gesellschaft.”
„Wie mir das leid thut und wie traurig meine Frau darüber sein wird,” äußerte er theilnehmend, „wir hofften, daß sich das Unwohlsein Ihrer Frau Gemahlin bis zu unserer Gesellschaft noch wieder geben würde. Aber nicht wahr, wenn Ihre Frau Gemahlin sich auch leidend fühlt, so dürfen wir doch hoffen, daß wir Sie wenigstens bei uns begrüßen werden?”
Und in dem Schrecken und in der grenzenlosen Verwirrung, die mich bei dieser Frage ergriff, antwortete ich mit „Ja”, mit einem lauten, vernehmlichen „Ja”, und die unsagbare, jeder Beschreibung spottende Dummheit, die ich damit begangen hatte, wurde mir erst klar, als mein Freund, über meine „liebenswürdige” Zusage hoch erfreut, mit einem lustigen „Na, dann auf Wiedersehen und bitte, empfehlen Sie mich Ihrer Frau Gemahlin”, davoneilte.
Entsetzt, außer mir, vernichtet, ein Bild des Jammers und des Elends, wankte ich gebrochen nach Haus.
„Um Gottes Willen, was fehlt Dir, was ist geschehen, bist Du krank, hat sich ein Unglück ereignet — aber so sprich doch und laß mich nicht vor Angst sterben,” rief meine Frau, als sie meiner ansichtig wurde.
An Leib und Seele geknickt, sank ich auf einen Stuhl: „Denk Dir, ich habe für mich bei Börne's zugesagt.”
Mit allen Anzeichen des höchsten Erstaunens blickte sie mich an: „Was hast Du? Zugesagt, Du, der Du schwurst, eher zu sterben, als die Einladung anzunehmen? Du scherzest, für so schwach und inconsequent hätte ich Dich doch nicht gehalten! Oder war das Ganze etwa nur eine List, ersonnen, um mich von der Gesellschaft fernzuhalten, damit Du Dich desto besser und ungenirter amüsiren kannst?”
„Halt ein,” bat ich, „Du thust mir Unrecht bis ins dritte und vierte Glied,” und in bewegten Worten schilderte ich ihr mein Leid. „Hilf mir,” flehte ich, „rette mich, versage mir Deine Hilfe nicht, jetzt, da ich ihrer mehr denn je bedarf.”
Ich glaubte, mein Elend würde das Herz meiner Frau weich und milde stimmen und ihr Mitleid mit mir würde grenzenlos sein. Aber Frauenherzen sind unberechenbar. „Siehst Du wohl,” frohlockte sie, „das ist Deine gerechte Strafe, das ist die Belohnung dafür, daß Du mich der Welt als krank und elend schilderst. Gehe nur ruhig hin und amüsire Dich recht, recht schön.”
Endlich,nach einer Stunde, hatte ich ihr Herz gerührt. Ein neuer Plan wurde entworfen, und zwei Tage vor dem Diner schrieb ich an meinen Gastgeber eine Karte:
„Lieber Freund!
Zu meinem lebhaftesten Bedauern wird es mir noch in der letzten Minute unmöglich gemacht, Ihrer freundlich liebenswürdigen Einladung Folge zu leisten. Soeben erhalte ich die Nachricht, daß meine Schwester, die ich seit Jahren nicht gesehen, auf einige Tage zu uns zum Besuch kommt, und mit Recht würde sie mir zürnen, wenn ich ihr während ihres hiesigen Aufenthaltes meine Gesellschaft entziehen würde. Seien Sie überzeugt, daß ich nur schweren Herzens diese Zeilen schreibe, aber Sie werden selbst einsehen, daß ich nicht anders handeln kann. Empfehlen Sie mich, bitte, Ihrer sehr verehrten Frau Gemahlin und genehmigen Sie die Versicherung etc. etc.”
Vierundzwanzig Stunden später brachte mir der Postbote ein Billet, auf dessen Couvert ich mit Schaudern die Initialen meines Freundes bemerkte.
„Was will er nun schon wieder,” dachte ich, und dann las ich:
Es wird uns eine ganz besondere Ehre sein, Ihr Fräulein Schwester, von der Sie uns schon so oft erzählt haben, bei uns begrüßen zu dürfen, und wir würden uns unendlich freuen, wenn wir sie mit Ihnen zusammen auf unserem Diner begrüßen dürften. Als Tischherrn für Ihr Fräulein Schwester haben wir bereits Herrn von Berken geladen und seine Zusage soeben erhalten.”
„So, nun ist es aus, thatsächlich aus,” stöhnte ich, während mir der Angstschweiß auf die Strin trat, „nun ist Alles aus. Wo ist der rettende Engel, der mir hilft? Frau, Frau, wo bist Du?”
Ich fand sie mit der Lectüre eines Buches beschäftigt und streckte ihr mit flehender Geberde die Karte entgegen.
„Siehst Du,” sagte sie, „das hast Du nun davon, Lügen haben kurze Beine, so was kommt von so was, und mir, die ich nach Deiner Meinung so schwach bin, daß ich nicht einmal ausgehen kann, bürdest Du nun auch noch Hausbesuch auf. Das ist die vielgerühmte Logik der Männer. Was mich aber mit dem Gedanken an das Zuhausebleiben versöhnt, ist die Freude, nicht mit diesem Berken zusammenzutreffen, Du weißt, ich kann mir keinen schrecklicheren Menschen als ihn vorstellen.”
„Und Du glaubst wirklich, daß ich meine Schwester kommen lassen muß?” fragte ich kleinlaut. „Ein Brief erreicht sie nicht mehr und wenn ich ihr telegraphisch die Gründe auseinandersetze, die ihre Gegenwart erfordern, so wird sie die Sache entweder für einen Scherz oder mich für geisteskrank halten.”
„Und dennoch muß es wenigstens versucht werden,” entgegnete meine Frau, „Du blamirst Dich sonst auf ewig und machst Dich gesellschaftlich unmöglich. Zurück kannst Du jetzt nicht mehr, jetzt heißt es nur noch „vorwärts”.”
Fünf Minuten später eilte ich zur Post und bald darauf ging ein 140 Worte langes Eiltelegramm an meine Schwester ab, in dem ich sie bei Allem, was ihr heilig war, beschwor, mich nicht im Stich zu lassen und mir umgehend mitzutheilen, mit welchem Zug ich sie erwarten dürfte.
Zwei Stunden später hatte ich die Antwort:
„Käme gerne, habe aber thatsächlich nichts anzuziehen. Thust mir leid. Besten Gruß.”
Aber was nützte mir die Versicherung ihres Mitleides, wo ich ihrer selbst so dringend bedurfte, und so sandte ich ihr ein neues Telegramm!
„Komme nur, wir kaufen Alles, was Du brauchst, fix und fertig hier.”
Und sie kam, am nächsten Morgen um sieben Uhr holte ich sie von der Bahn, sie war die Nacht durchgefahren, um mich zu retten. Unser erster Weg war zu dem größten Modewaarengeschäft, endlich hatten wir eine Robe gefunden, die annähernd paßte und die bis zum Mittag umgeändert werden konnte. Zwar sträubten sich mir meine Haare auf dem Kopf, als ich den Preis hörte, aber was nützte es? Ich wollte zufrieden sein, wenn ich am Abend von mir sagen durfte: „Alles verloren, nur die Ehre nicht.”
Aber der Confectionair hielt nicht Wort, es wurde vier, vier und ein halb, fünf Uhr, die Toilette kam nicht. Wie ein Wahnsinniger stürzte ich den Weg zur Stadt, vergebens spähte ich nach einer Droschke aus, kein Fuhrwerk war zu entdecken; doch da kam auf Gummirädern ein Zweispänner angerollte. Ich eilte ihm entgegen: „Kutscher, sind Sie frei?”
Grinsend schaute der Rosselenker mich an, da erst bemerkte ich, daß ich im Halbdunkel einen Krankenwagen angerufen hatte. Athemlos, erschöpft erreichte ich den Laden, in dem große Aufregung herrschte; das Costüm war schon seit Stunden fertig, aber durch ein Versehen war meine Adresse verlegt worden und kein Mensch wußte nun, wohin es zu senden war. Mit der leichten und doch so schweren Last auf dem Arm eilte ich nach Haus, es schlug fünfeinhalb, als ich die Thür hinter mir zuwarf. Um sechs Uhr sollte das Diner beginnen, es war also keine Zeit mehr zu verlieren. Wie meine Schwester es angefangen hat, sich in einer Viertelstunde anzuziehen, das ist meiner Frau noch heute, nach drei Jahren, ein Räthsel. Aber das Kunststück gelang, und mit dem Glockenschlag sechs Uhr betraten wir die festlich erleuchteten Räume.
„Sie waren so liebenswürdig, meine gnädige Frau — meine Schwester, der es leider unmöglich war, heute Morgen ihre pflichtschuldige Aufwartung zu machen — ah, mein lieber Freund, wirklich zu gütig von Ihnen, sich unserer so anzunehmen.”
„Wir sind glücklich, Sie bei uns zu sehen.”
„Wie soll ich Ihnen jemals danken?”
Feierlicher Händedruck, tiefe Verbeugung, dann begann das Diner: Austern, klare Bouillon, Hummer und Gänseleberpastete, Alles in und durcheinander.
„Nun, wie war es?” fragte mich meine Frau, als wir endlich heimkehrten.
„Wirklich sehr nett,” erwiderte ich, „zwar nicht Alles ganz stilgerecht, aber heiter und lustig. Uebrigens scheint Herr von Berken sich sehr für meine Schwester zu interessiren, morgen schon will er seine Aufwartung machen, ich glaube, ich glaube, wir können ihn bald als neues Familienmitglied begrüßen.”
Mit allen Anzeichen des höchsten Entsetzens starrte meine Frau mich an.
„Ich hoffe, Du scherzest — weißt Du es denn wirklich nicht, daß ich Herrn von Berken vor Jahren einen Korb gegeben habe — und den bringst Du mir jetzt als Schwager in das Haus — mir, die ich nach Deinen Worten der größten Ruhe und Schonung bedarf? Nicht einen Augenblick kann man Euch Männer allein lassen, sofort macht Ihr irgend eine Dummheit. Aber unter eine Bedingung will ich Dir verzeihen: Nimm Dir ein warnendes Beispiel an dem Unglück, das Du angerichtet hast und schwöre mir, daß Du nie wieder ohne mich auf Gesellschaften gehen willst und daß Du die Entscheidung über alle noch kommenden Einladungen mir überlassen willst. Schwöre!”
Und feierlich erhob ich meine Rechte.
„Nationaltidende” vom 15.4.1894: