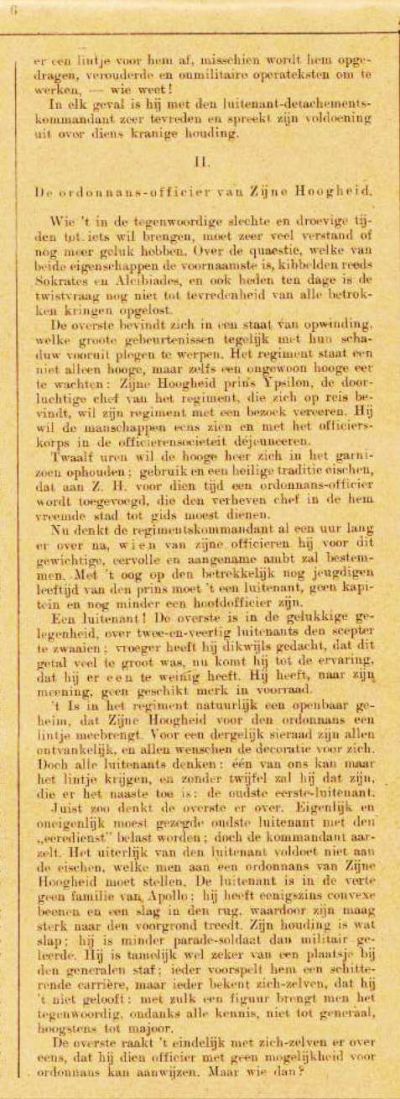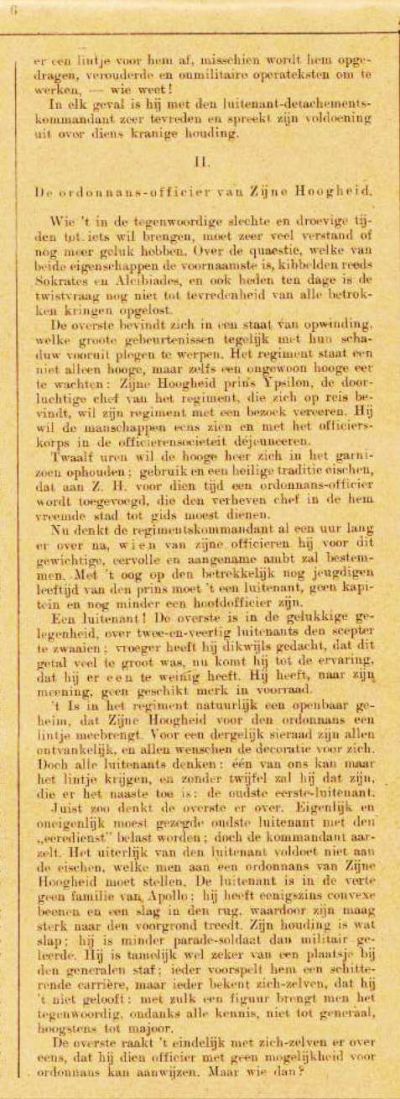


Von Freiherr v.Schlicht (Dresden).
in: „Frankfurter Zeitung und Handelsblatt” vom 26.11.1900,
in: „Neue Hamburger Zeitung” vom 1.12.1900,
in: „Indiana-Tribüne” vom 11.2.1901
(unter dem Titel: „Der Ordonnanz-Offizier”),
in: „Haagsche courant” vom 25.11.1901
(unter dem Titel „Twee militaire schetsen - De ordonnanz-offizier van Zijne Hoogheid”) und
in: „Der grobe Untergebene”
Wer es bei den heutigen schlechten und traurigen Zeiten zu etwas bringen will, muß entweder sehr viel Verstandoder noch mehr Glück haben – darüber, welche dieser beiden Eigenschaften die wichtigere sei, stritten sich schon Sokrates und Alcibiades und auch heute ist diese Streitfrage noch nicht zur Zufriedenheit aller betheiligten Kreise erledigt.
Der Herr Oberst befindet sich in jener Erregung, die große Ereignisse gleichzeitig mit ihrem Schatten vorauszuwerfen pflegen. Dem Regiment steht nicht nur eine hohe, sondern sogar eine ungewöhnlich hohe Ehre bevor: Se. Hoheit Prinz Ypsilon, der erlauchte Chef des Regiments, der sich auf einer Reise befindet, will seinem Regiment einen Besuch abstatten. Er will sich die Mannschaften ansehen und mit dem Offizierkorps zusammen im Kasino frühstücken.
Zwölf Stunden will der hohe Herr sich in der Garnison aufhalten, und der Brauch und die alte Tradition verlangt es, daß Seiner Hoheit für diese Zeit ein Ordonnanz-Offizier kommandirt wird, der dem hohen Chef in der ihm fremden Stadt gewissermaßen als Fremdenführer dienen kann.
Nun denkt der Herr Oberst seit einer Stunde schon darüber nach, wen von seinen Offizieren er zu diesem wichtigen, ehrenvollen und angenehmen Amt bestimmen soll. Dem Alter des verhältnißmäßig noch jungen Prinzen entsprechend muß es ein Leutnant, kein Hauptmann und noch weniger ein Stabsoffizier sein. Ein Leutnant! Der Herr Oberst ist in der glücklichen Lage, über zweiundvierzig Leutnants das Szepter zu schwingen, früher hat er oft geglaubt, das wäre viel zu viel, jetzt kommt er zu der Erkenntniß, daß er einen zu wenig hat. Er hat nach seiner Ansicht nichts Passendes auf Lager.
Es ist im Regiment ein offenes Geheimniß, daß Se. Hoheit für den Ordonnanz-Offizier eine Ordensauszeichnung mitbringt. Für einen derartigen Schmuck sind Alle empfänglich und Alle wünschen sich, daß ihnen die Dekoration zu Theil werde, aber alle Leutnants sagen sich: Einer von uns kann den Orden nur erhalten, und ohne jeden Zweifel erhält ihn derjenige, der, um mit Fritz Reuter zu sprechen, der nächste dazu ist: nämlich der älteste Oberleutnant.
Genau ebenso denkt auch der Herr Oberst, eigentlich und uneigentlich müßte der Herr „Ober" zu dem Ehrendienst kommandirt werden, aber der Herr Oberst zögert: Das Äußere des Herrn Leutnants entspricht in keiner Weise den Anforderungen, die man an den Ordonnanzoffizier Seiner Hoheit stellen muß. Der Herr „Ober" ist weit davon entfernt, mit Apoll verwandt oder verschwägert zu sein; er hat ganz bedeutende O-Beine, er hat ein sehr hohles Kreuz und infolge dessen einen nicht unbedeutend hervorstehenden Magen. Seine Haltung ist lasch und schlaff, er ist weniger Frontsoldat als militärischer Gelehrter. Er hat die Akademie mit dem denkbar besten Erfolge besucht, die Einberufung in die „große Bude", in den Generalstab, ist ihm sicher, Jeder prophezeit ihm, daß er eine glänzende Carrière machen wird, aber Jeder sagt sich: so recht glaube ich es doch nicht – mit der Figur bringt man es heutzutage trotz aller Kenntnisse nicht bis zum kommandirenden General, kaum bis zum Major und Bataillonskommandeur.
Der Herr Kommandeur ist sich endlich darüber einig, daß er den ältesten „Ober" unter keinen Umständen bestimmen kann, nein, der geht nicht, aber vielleicht der Zweit- oder der Dritt- oder der Viert-Älteste.
Der Herr Oberst läßt von Neuem die ganze Schaar seiner Leutnants vor seinem geistigen Auge vorbeipassiren; es sind hübsche, vornehme Gestalten, tüchtige Köpfe darunter, aber äußerlich ist kein Einziger frei von Schuld und Fehle. Kein Untergebener ist nach Ansicht seiner Vorgesetzten so gerade gewachsen, daß er nicht noch gerader sein könnte.
Plötzlich springt der Herr Oberst wie elektrisirt in die Höhe und in seinen Mienen ist zu lesen: Heureka, ich hab's; wenn ich den Göttern auch keinen Hahn opfern kann, so werde ich ihnen ein Trankopfer bringen und mich nachher im Kasino an einer Flasche Sekt erfreuen, denn es ist ein weit verbreiteter Irrthum, daß dieses edle Getränk nur für die jungen Leutnants und für die Fähnriche bestimmt ist.
Der Herr Oberst wendet sich an seinen Adjutanten: „Bitte, telegraphiren Sie doch einmal sofort an den Direktor der Militär-Turnanstalt in Berlin und bitten Sie in meinem Namen, den dort kommandirten Leutnant Emberg von unserem Regiment auf drei Tage nach hier zu beurlauben, damit er bei Seiner Hoheit die Stelle als Ordonnanz-Offizier übernehmen kann."
In den zwei Jahren, die der Adjutant seinem Herrn nun schon als Tintenspion dient, hat er es sich im Laufe der Zeit ganz abgewöhnt, sich über irgend ein Wort, über irgend einen Entschluß und Befehl seines Vorgesetzten zu wundern - er hat das „sich wundern" als zeitraubende und doch völlig überflüssige Thätigkeit erkannt und demgemäß aufgegeben, denn ein Adjutant thut nur in den seltensten Fällen, und auch dann nur mit Widerstreben, mehr, als er unbedingt muß. Aber als der Herr Oberst von dem Leutnant Emberg spricht, vergißt der Adjutant für einen Augenblick seine guten Vorsätze und macht ein sehr erstauntes Gesicht.
„Halten Sie das Geschäft nicht auf, sondern telegraphiren Sie," mahnt der Kommandeur.
„Zu Befehl, Herr Oberst," lautet die Antwort und wenig später geht das Telegramm in die Welt.
Am Nachmittag kommt die Antwort, daß der Urlaub „ausnahmsweise, unter Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse, in der sicheren Erwartung, daß in Zukunft kein ähnliches Ersuchen an die Direktion der Turnanstalt gerichtet werde," bewilligt worden sei.
„Diese ganzen Zusätze hätte die Direktion sich schenken können," denkt der Oberst, „die Hauptsache ist, daß ich meinen Leutnant habe."
Und er hat ihn: am nächsten Vormittag meldet sich der Herr Leutnant Emberg auf dem Regimentsbureau.
Der Herr Oberst betrachtet den jungen Offizier, der vor ihm steht, mit zärtlichen, beinahe verliebten Blicken. Leutnant Emberg ist keine beauté, aber er hat ein frisches, offenes Gesicht und vor allen Dingen eine wahrhaft klassisch schöne Figur. Wie er so dasteht: Hacken zusammen, die schlanken und dabei doch muskulösen Beine leicht nach hinten durchgedrückt, den Bauch hineingezogen, die Brust heraus, den Kopf in die Höhe, die beiden Ohren in gleicher Höhe, die Nase haarscharf über der Knopfreihe, das Kinn leicht an die Binde herangenommen, ohne dabei ein Doppelkinn zu machen, ist er die lebende und die lebendige Illustration zu dem Wort: „Er ersetzt die ihm fehlenden geistigen Kenntnisse durch eine untadelhaft stramme Haltung."
Denn mit den geistigen Kenntnissen ist es bei dem guten Emberg nicht weit her. Er führt im Regiment den Beinamen: „Monsieur le boeuf ", und nicht ganz ohne Grund; er hat auf dem Gebiete der geistigen Thorheiten schon die schwierigsten Sachen mit der größten Leichtigkeit vollbracht, und jeden Andern hätten die Vorgesetzten heruntergemacht, daß er for ever spurlos in der Versenkung verschwunden wäre. Aber mit Emberg wurde eine Ausnahme gemacht. Wenn die Vorgesetzten ihn zu sich heranriefen, um ihm ihre Ansicht in nicht mißzuverstehender Art und Weise auseinderzusetzen, nahm der junge Offizier eine so tadellos stramme, korrekte, militärische Haltung an, daß er dadurch seinen geistigen Defekt völlig verdeckte und die Vorgesetzten zu der Überzeugung brachte: der Emberg ist doch einer der tüchtigsten Leutnants im Regiment.
Noch immer ruhen die Blicke des Herrn Oberst bewundernd auf dem jungen Offizier, dann ertheilt er ihm seine Instruktion und schließt mit den Worten: „Machen Sie uns Ehre!"
Das geschieht. Der hohe Chef des Regiments ist mit dem ihm zugetheilten Ordonnanzoffizier außerordentlich zufrieden; er dankt dem Herrn Oberst, daß dieser ihm gerade diesen Offizier zugetheilt hat, er überreicht Emberg persönlich den Orden und scheidet von ihm mit den Worten: „Ich hoffe, daß wir uns in unserem Leben noch weiter begegnen werden."
Emberg hofft es auch, und seine Hoffnung geht in Erfüllung; nach einem Vierteljahr wird er zunächst auf drei Jahre zum persönlichen Adjutanten Seiner Hoheit ernannt. Über das, was nach den drei Jahren wird, zerbricht Emberg sich nicht den Kopf – hat er es soweit gebracht, wird er es auch schon weiter bringen.
Er denkt an seinen schon lange verstorbenen Vater, der ebenfalls den bunten Rock getragen hatte. Wäre es nach den geistigen Fähigkeiten gegangen, so hätte der es nach der Ansicht seiner Kameraden höchstens bis zum Oberleutnant bringen müssen, da aber auch er die große Gabe besaß, die fehlenden geistigen Fähigkeiten durch eine tadellos stramme, militärische Haltung zu ersetzen, brachte er es bis zum General.
Am besten ist es, wenn stramme Haltung und geistige Fähigkeiten vereint sind, fehlt aber das Eine, so ist es das Beste, wenn der Geist fehlt, denn die Vorgesetzten sind Menschen, und der Mensch sieht in den meisten Fällen bekanntlich nur das – was er sieht
„Haagsche courant” vom 25.11.1901: