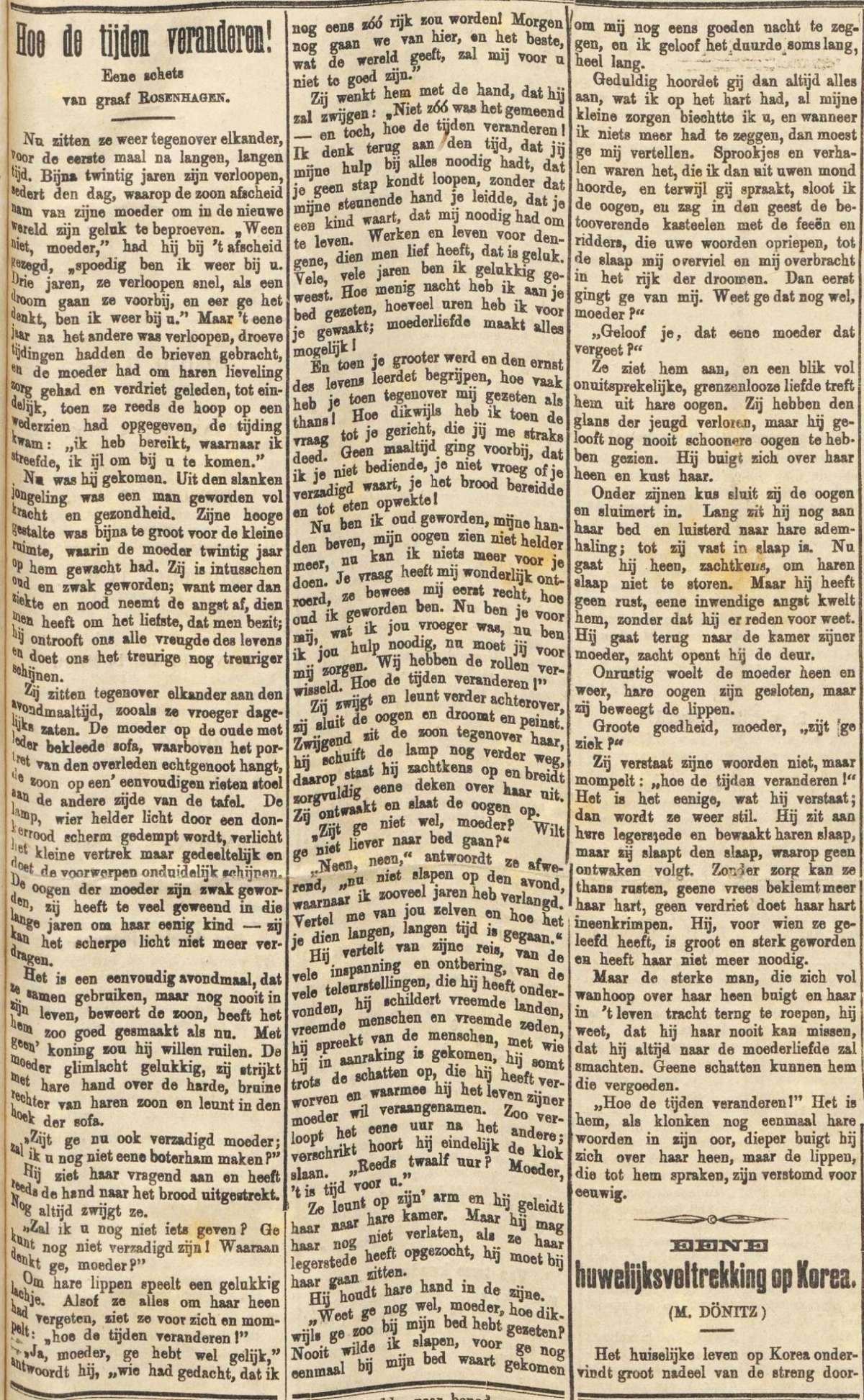
Skizze von Graf Günther Rosenhagen.
in: „Deutsche Lesehalle”, Nr. 8, 25.2.1894, Seite 63.
(Sonntags-Beilage zum Berliner Tageblatt.),
in: „Nieuwsblad van het Noorden” vom 11.3.1894 (unter dem Titel: „Hoe de tijden veranderen!”),
in: „Teplitz-Schönauer Anzeiger” vom 25.4.1894,
in: „Frederiksborg Amts Avis” vom 13.7.1895, (in dänisch unter dem Titel: „Tiderne skifter”),
in : „Thisted Amts Tidende” vom 17.7. und 18.7.1895 (in dänisch unter dem Titel: „Tiderne skifter”)
Nun sitzen sie sich wieder gegenüber, zum ersten Mal nach langer, langer Zeit. Fast zwanzig Jahre sind verflossen seit dem Tage, an dem der Sohn Abschied nahm von der Mutter, um drüben in der neuen Welt sein Glück zu versuchen.
„Weine nicht, Mutter,” hatte er bei dem Abschied gesagt, „bald bin ich wieder bei Dir. Drei Jahre, sie vergehen so schnell, schneller als ein Traum sind sie vorüber, und ehe Du es denkst, bin ich wieder bei Dir.”
Aber ein Jahr nach dem andern war vergangen, gar trübe Nachrichten hatten die Briefe gebracht, und die Mutter hatte sich um ihren Liebling gesorgt und gegrämt, bis endlich, als sie schon auf ein Wiedersehen zu hoffen aufgehört hatte, die Nachricht kam: „Ich habe erreicht, wonach ich gestrebt, ich eile zu Dir.”
Nun war er gekommen. Aus dem schlanken Jüngling war ein Mann geworden, strotzend von Kraft und Gesundheit, eine große, hohe Gestalt, fast zu groß für den kleinen Raum, in dem die Mutter zwanzig Jahre auf ihn gewartet hatte. Sie ist alt und schwach geworden inzwischen, mehr als Krankheit und Noth zehrt die Sorge um das Liebste, was man hat, sie raubt uns alle Freuden des Lebens und läßt das Traurige noch trauriger erscheinen.
Sie sitzen sich am Abendbrodtisch gegenüber, wie sie so oft früher täglich gesessen haben. Die Mutter auf dem alten mit Leder bezogenen Sopha, über dem das Bild des verstorbenen Gatten, mit einem Lorbeerkranz geschmückt, hängt, der Sohn auf einem einfachen Rohrstuhl an der anderen Seite des Tisches. Die Lampe, deren helles Licht durch einen dunkelrothen Schirm gedämpft wird, erhellt die Stube nur spärlich und läßt die Gegenstände nur undeutlich erscheinen. Die Augen der Mutter sind schwach geworden, sie hat zu viel geweint in den langen Jahren um ihr einziges Kind – sie kann das grelle Licht nicht mehr vertragen.
Es ist ein einfachen Abendbrod nur, das sie zusammen verzehren, aber noch nie in seinem Leben, behauptet der Sohn, hat es ihm auch nur annähernd so gut geschmeckt wie heute. Mit keinem Könige möchte er tauschen. Glücklich lächelt die Mutter, sie streicht mit ihrer Hand über die harte, braune Rechte ihres Sohnes und lehnt sich in die Ecke zurück.
„Bist Du auch satt, Mutter, soll ich Dir nicht noch ein Butterbrod zurechtmachen?”
Er sieht sie fragend an und hat schon die Hände nach dem Brod ausgestreckt. Noch immer schweigt sie.
„Soll ich Dir nicht noch irgend etwas geben, Du kannst doch noch nicht satt sein, Mutter? Woran denkst Du, Mutter?”
Ihre Lippen umspielt ein glückliches Lächeln, wie weltvergessen blickt sie vor sich hin und murmelt: „Wie sich die Zeiten ändern!”
„Ja, Mutter, Du hast Recht,” entgegnete er, „wer hätte das gedacht, daß ich noch einmal so reich werden würde! Morgen noch ziehen wir von hier fort, und das Schönste, das die Welt besitzt, soll mir für Dich gerade gut genug sein.”
Sie winkt ihm mit der Hand, zu schweigen: „Nicht so war es gemeint – und doch, wie sich die Zeiten ändern! Ich denke zurück an die Zeit, da Du meiner Hilfe bei Allem bedurftest, da Du keinen Schritt gehen konntest, ohne daß meine leitende Hand Dich führte, da Du ein Kind warst, das meiner zum Leben bedurfte. Arbeiten und sich mühen dürfen und zu können für den, den man liebt, das ist Glück. Viele, viele Jahre bin ich glücklich gewesen. Wie manche Nacht habe ich an Deinem Lager gesessen, wie viele Stunden habe ich für Dich durchwacht, Mutterliebe ermöglicht Alles!
Und als Du größer wardst und anfingst, den Ernst des Lebens zu verstehen, wie oft hast Du mir da so gegenüber gesessen wie jetzt! Wie oft habe ich damals dieselbe Frage an Dich gerichtet, wie Du soeben an mich. Keine Mahlzeit verging, bei der ich Dir nicht die Speisen vorlegte, Dich nicht fragte, ob Du auch gesättigt seiest, Dir das Brod bereitete und Dich zum Essen nöthigte!
Nun bin ich alt geworden, meine Hände zittern, mein Blick ist getrübt, nun kann ich nichts mehr für Dich thun. Wunderbar berührt mich Deine Frage, sie zeigt mir erst, wie alt ich geworden bin. Nun bist Du mir, was ich Dir früher war, jetzt bedarf ich Deiner Hilfe, jetzt mußt Du für mich sorgen. Wir haben die Rollen vertauscht. Wie sich die Zeiten ändern!”
Sie schweigt und lehnt sich tiefer zurück in die Kissen, sie schließt und träumt und sinnt. Schweigend sitzt der Sohn ihr gegenüber, er rückt die Lampe noch weiter fort, dann steht er leise auf und breitet sorgsam eine Decke über seine Mutter. Sie erwacht und schlägt die Augen auf.
„Ist Dir nicht wohl, Mutter? Willst Du nicht lieber schlafen gehen?”
„Nein, nein,” wehrt sie ab, „nur jetzt nicht schlafen an dem Abend, den ich seit so vielen Jahren ersehnt. Erzähle mir von Dir und wie es Dir ergangen in der langen, langen Zeit.”
Er berichtet von seiner Fahrt, von den vielen Anstrengungen und Entbehrungen, von den vielen Enttäuschungen, die er erlitten, er schildert fremde Länder, fremde Leute und fremde Sitten, er spricht von den Menschen, mit denen er in Berührung gekommen ist, er zählt stolz seine Schätze auf, die er errungen, und mit denen er jetzt das Leben seiner Mutter verschönern will. So verrinnt eine Stunde nach der andern, erschrocken hört er endlich den Schlag der Uhr: „Schon Zwölf? Mutter, es ist Zeit für Dich.”
Sie stützt sich auf seinen Arm, und er führt sie hinüber in ihre Kammer. Aber er darf sie noch nicht verlassen, als sie das Lager aufgesucht hat, er muß noch bei ihr sitzen. Er hält ihre Hände in den seinen.
„Weißt Du wohl noch, Mutter, wie oft Du so bei mir an meinem Lager gesessen hast? Nie wollte ich einschlafen, bevor Du nicht noch einmal an mein Bett gekommen warst, um mir noch einmal „gute Nacht” zu sagen, und ich glaube, es dauerte manchmal gar lange, lange Zeit. Geduldig hörtest Du dann immer Alles an, was ich auf dem Herzen hatte, alle meine kleinen Sorgen beichtete ich Dir, und wenn ich nichts mehr zu sagen wußte, dann mußtest Du mir erzählen. Märchen und Geschichten waren es, die ich da aus Deinem Munde hörte, und während Du zu mir sprachst, schloß ich die Augen und sah im Geist die Zauberschlösser mit den Feen und Rittern, die Deine Worte heraufbeschworen, bis der Schlaf mich überfiel und mich hinüberführte in das Reich der Träume. Dann erst gingst Du von mir.Wei0t Du wohl noch, Mutter?”
„Glaubst Du, daß eine Mutter das vergißt?”
Sie sieht ihn an, und ein Blick unaussprechlicher, grenzenloser Liebe trifft ihn aus ihren Augen, sie haben den wundervollen Glanz der Jugend verloren, aber noch nie glaubt er schönere Augen gesehen zu haben. Er beugt sich über sie und küßt sie.
Unter seinem Kuß schließt sie die Lider und schläft ein. Lange sitzt er noch an ihrem Lager und horcht auf ihre Athemzüge, bis sie fest entschlummert ist. Dann geht auch er, leise, um ihren Schlaf nicht zu stören. Aber er findet keine Ruhe, eine innere Angst quält ihn, er kann sie sich nicht erklären. Er geht zurück in das Zimmer der Mutter, leise öffnet er die Thür.
Unruhig wirft sich die Mutter in den Kissen hin und her, ihre Augen sind geschlossen, aber sie bewegt die Lippen.
„Um Gottes Willen, Mutter, bist Du krank?”
Sie versteht seine Worte nicht, sie spricht vor sich hin: „Wie sich die Zeiten ändern!” Es ist das Einzige, was er versteht, dann wird sie wieder still. Er sitzt an ihrem Lager und bewacht ihren Schlaf, aber sie schläft den Schlaf, aus dem es kein Erwachen giebt. Ohne Sorgen kann sie jetzt ruhen, keine Furcht quält sie mehr, kein Kummer bedrückt mehr ihr Herz. Der, für den sie gelebt, ist groß und stark und bedarf ihrer nicht weiter.
Aber der starke Mann, der sich verzweiflungsvoll über ihr Lager wirft und sie in das Leben zurückzurufen versucht, weiß, daß er sie nicht entbehren kann, daß er ewig und ewig sich nach der Mutterliebe sehnen wird. Keine Schätze können ihm die ersetzen.
„Wie sich die Zeiten ändern!” Es ist ihm, als klängen noch einmal ihre Worte an sein Ohr, tiefer beugt er sich zu ihr herab, aber die Lippen, die zu ihm sprachen, sind verstummt auf ewig.
„Nieuwsblad van het Noorden” vom 11.3.1894:
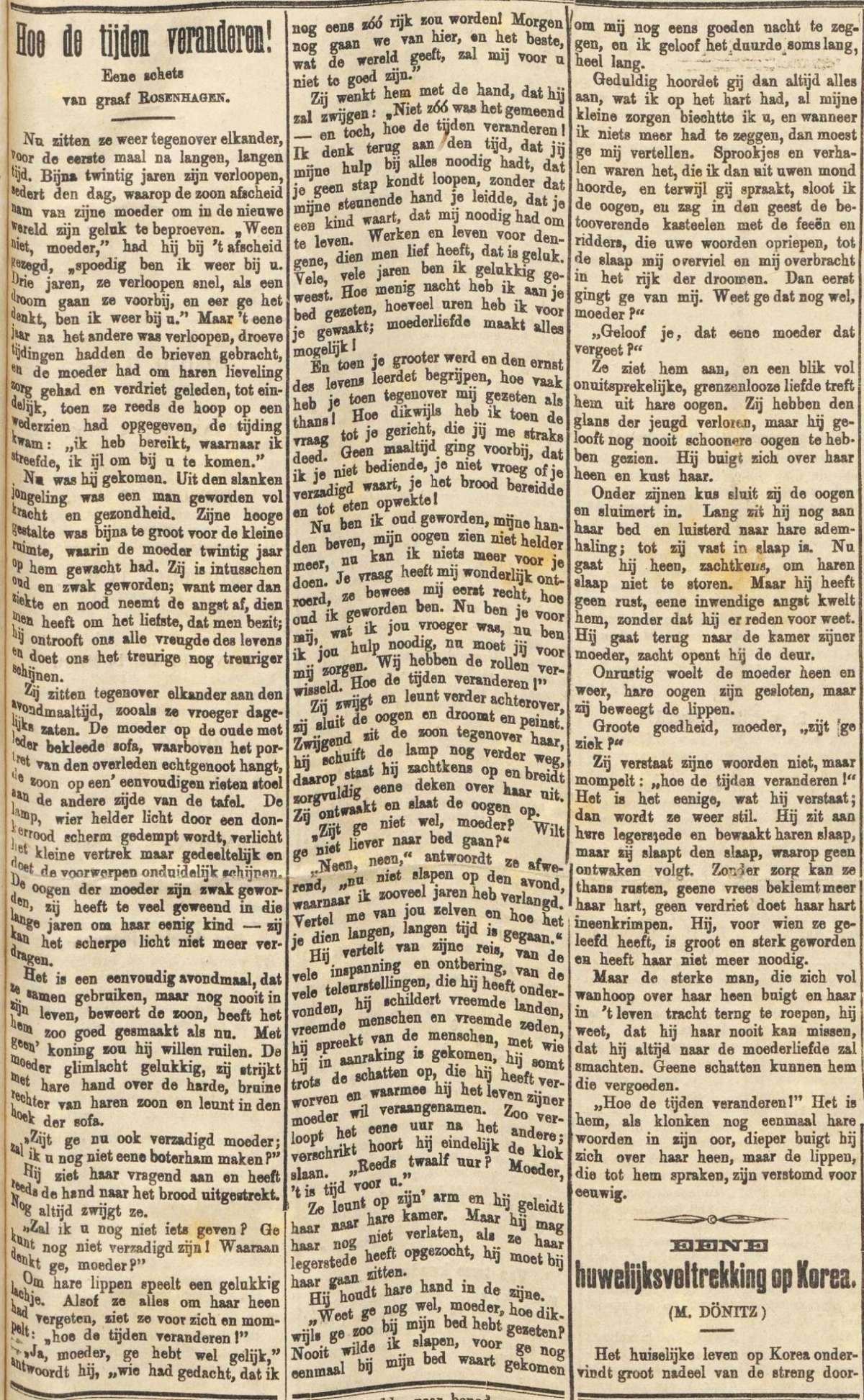
„Thisted Amts Tiderne” vom 17.7 und 18.7.1895
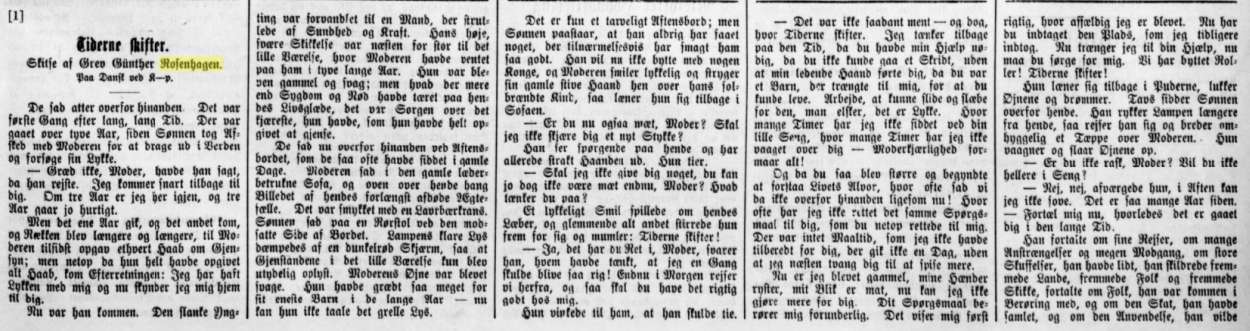
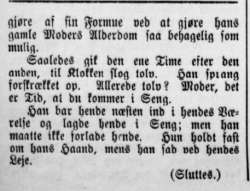
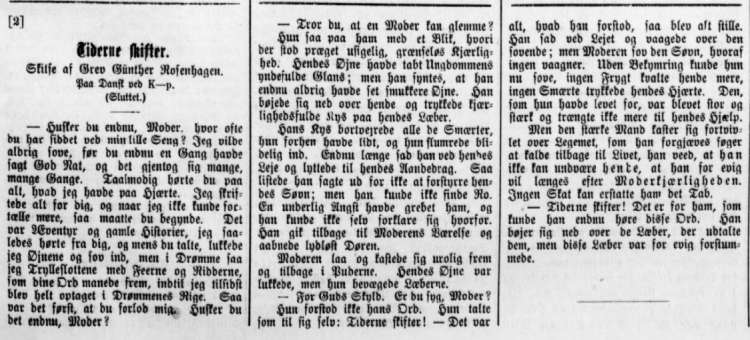
![]()
zu Schlichts Seite
© Karlheinz Everts