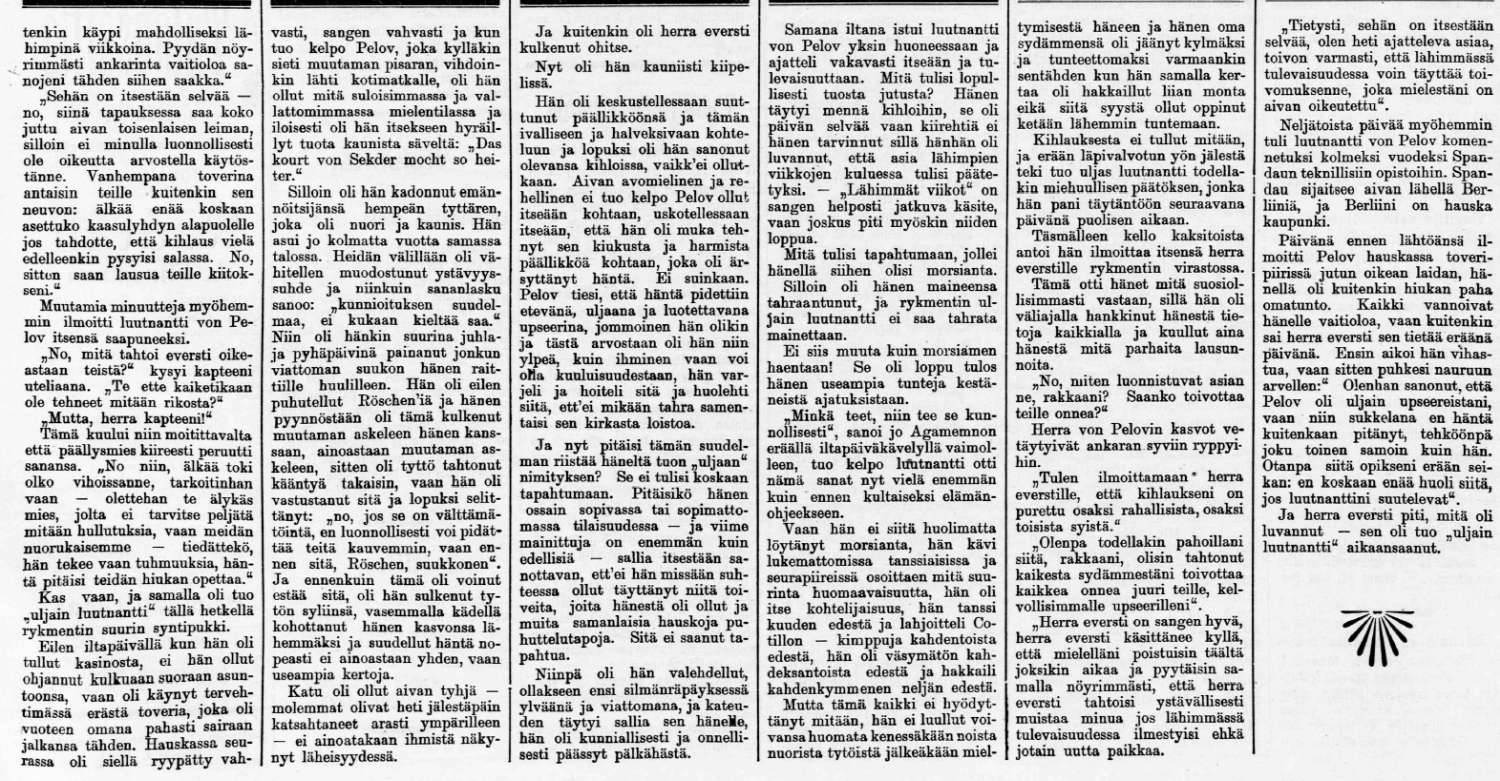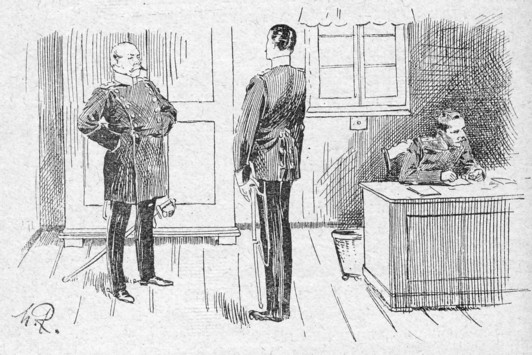
Humoreske von Freiherr von Schlicht.
in: „Indiana TribŁne” vom 2.3.1906,
in: „Kansan Lehti” vom 21.1.1904 unter dem Titel „Uljain luutnantti” und
in: „Excellenz kommt!”
„Guten Morgen!”
„Guten Morgen, Herr Oberst!”
Der Regimentsadjutant, der in dem Bureau bei der Arbeit saß, hatte das Eintreten des Kommandeurs überhört und sprang nun schnell von seinem Stuhl auf, um seinem „Chef” die pflichtschuldige Verbeugung zu machen und ihm bei dem Ausziehen des Paletots zu helfen. Aber der Herr Oberst lehnte dankend ab: „Bitte, bitte, lassen Sie sich nicht stören, machen Sie nur ruhig weiter. Ist etwas besonderes vorgekommen?”
„Nein, Herr Oberst, nur unwichtige Schreiben.”
Der Adjutant hatte seinen Platz wieder eingenommen und wartete darauf, daß der Kommandeur sich ebenfalls an seinen Schreibtisch setzen sollte, damit er ihm einige Unterschriften vorlegen könnte. Aber das geschah nicht. Der Herr Oberst trat ans Fenster, sah auf den Kasernenhof hinunter und trommelte mit den Fingern auf das Fensterbrett.
Neugierig las der Adjutant in den Mienen seines Vorgesetzten; da mußte irgend etwas nicht in Ordnung sein, der Herr Oberst war schlechter Laune, das war klar — wer täglich mit einem anderen zusammenarbeitet, weiß bald, was bei dem eine jede Bewegung zu bedeuten hat.
Das Trommeln auf dem Tisch bedeutet nichts gutes — es war das zweithöchste Stadium oberstlicher Erregung, das höchste Stadium war, wenn der Kommandeur pfiff — dann machte sich der Adjutant stets so schnell wie möglich dünne und hatte plötzlich notwendig mit dem im Nebenzimmer sitzenden Schreiber zu thun.
„Ah, da ist er ja,” sagte in diesem Augenblick der Kommandeur.
„Wer?” wollte der Adjutant unwillkürlich fragen, aber zur rechten Zeit schluckte er das Wort noch hinunter, denn Untergebene dürfen nie fragen, sondern sich nur fragen lassen.
Und jetzt pfiff der Oberst.
Mit einem Aktenbündel verschwand der Adjutant im Nebenzimmer, um erst nach einigen Minuten zurückzukehren.
Der Herr Oberst pfiff noch.
Abermals verschwand der Adjutant und dieses Mal blieb er ungeführ fünf Minuten fort. Endlich trat er wieder ein.
Und der Herr Oberst pfiff immer noch.
Da gab der Adjutant das Verschwinden auf, setzte sich an seinen Platz und wartete der Dinge, die da kommen würden.
Vorher aber warf er noch einen neugierigen Blick auf den Kasernenhof. Der wimmelte von Rekruten, Unteroffizieren, Offizieren, Hauptleuten und Stabsoffizieren.
Wer war der „er”, von dem der Herr Oberst gesprochen hatte — wer hatte ihn zu diesem Pfeifen-Solo veranlaßt?
Der Adjutant mit seinem Unterthanenverstande wußte es nicht, und das war sehr traurig, denn ein Adjutant muß alles wissen.
Der Herr Oberst trat an den Schrank, in dem die geheimen Akten liegen, schloß denselben auf und entnahm ihm ein Aktenbündel.
„Personalia”, las der Adjutant auf dem Umschlag; Personalia heißt auf gut deutsch „die Konduite” — das bedeutete nichts gutes.
Endlich schien der Herr Oberst den gefunden zu haben, den er suchte, aufmerksam las er den Qualifikationsbericht, schüttelte den Kopf, stieß ein verächtliches „Pah” hervor und pfiff wieder ein gar lustig Lied.
Dem Adjutanten wurde unheimlich zu Mute.
„Bitte, schicken Sie doch die Ordonnanz auf den Kasernenhof hinunter, ich wünsche den Lieutenant von Pelow sofort hier auf dem Bureau zu sprechen.”
„Nanu, was hat denn der verbrochen?” dachte der Adjutant, sprach dann sein: „Zu Befehl, Herr Oberst” und ging, um die Ordonnanz zu instruieren.
Einen Augenblick später stand der Gerufene vor dem Kommandeur.
Diskret wollte sich der Adjutant zurückziehen.
„Bitte, bleiben Sie nur, ich habe mit dem Herrn Lieutenant keine Geheimnisse zu besprechen.”
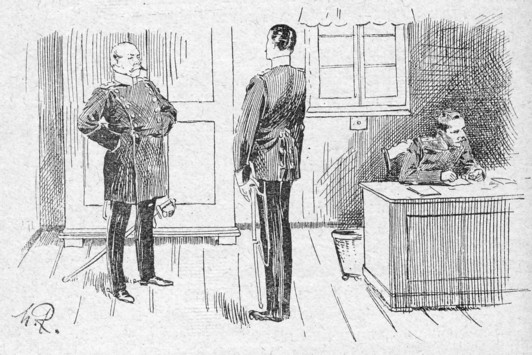
Der Herr Oberst ging mit großen Schritten im Zimmer auf und ab, und der arme Lieutenant von Pelow, der in seiner ganzen männlichen Schönheit hochaufgerichtet in tadellosester strammer Haltung dastand, schielte heimlich nach dem Adjutanten hinüber, um Aufklärung zu erbitten. Der aber zuckte nur mit den Achseln. „Zwar heiße ich nicht Hase, doch weiß ich von nichts.”
Endlich blieb der Kommandeur vor dem Schlachtopfer stehen und sagte mit donnernder Stimme: „Sie also sind der tüchtigste Lieutenant meines Regiments?!”
Verwundert blickte Herr von Pelow seinen Vorgesetzten an, der höhnisch auflachte: „Sie wundern sich darüber? Das freut mich, denn ich habe mich auch darüber gewundert, als ich dieses Urteil über Sie in der mir von meinem Herrn Vorgänger hinterlassenen Konduite las. Ich selbst kenne Sie ja noch zu wenig, ich habe das Regiment noch zu kurze Zeit, um ein feststehendes Urteil über Sie zu haben. Das aber kann ich Ihnen sagen: Von meinem tüchtigsten Lieutenant erwarte ich andere Leistungen, als ich sie gestern Abend von Ihnen zu bewundern Gelegenheit hatte.”
Dunkelrot färbten sich die Wangen des Offiziers; allmählich begann es ihm klar zu werden, warum augenblicklich statt seiner der Hauptmann unten auf dem Kasernenhof die Rekruten exerzierte.
„Sie sollten sich schämen, Herr Lieutenant.”
„Weißt du denn so genau, daß ich das nicht schon thue,” dachte der Lieutenant im stillen, „rot bin ich doch schon und röter als rot kann doch selbst ein Rotkehlchen nicht werden, geschweige denn ein Lieutenant,” laut aber sagte der Lieutenant — gar nichts.
Das ist nicht zuweilen, sondern fast immer die beste Antwort, die man als Untergebener seinen Vorgesetzten geben kann.
„Wie kommen Sie dazu, auf offener Straße in voller Uniform ein Mädchen zu küssen? Ich bitte um Antwort.”
„Warum küssen sich die Menschen? |
So ähnlich hat ja schon der Kater Hiddigeigei über diese ernste Frage meditiert und Hiddigeigei war klug, viel klüger als der arme Lieutenant, der vergebens über eine Antwort nachsann, die er schließlich auch in diesem Falle schuldig blieb — es war ja auch dicht vor dem ersten.
„Davon, daß Sie mich gestern Abend nicht begrüßt haben, will ich gar nicht sprechen, obgleich es nicht nur mein Recht, sondern auch meine Pflicht ist, von Ihnen einen Gruß zu verlangen — Sie hätten mich erkennen können, denn Sie standen unter der hell brennenden Laterne. Das hätten Sie aber als tüchtigster Lieutenant des Regiments eigentlich wissen können, daß man sich in solchen Situationen, wie die, in der Sie sich befanden, nicht gerade unter einen Kronleuchter stellt. Nicht wahr, oder ist das zu viel verlangt?”
Dieser „Kronleuchter” war nun eine ganz gewaltige militärische Hyperbel, denn, dem Ausgehen nahe, hatte eine schwache Gasflamme im Abendwinde gezittert; trotzdem stimmte der Herr Lieutenant seinem Kommandeur bei: geeignet war der Platz gerade nicht gewesen.
„Und nicht einmal betrunken waren Sie,” fuhr der Herr Oberst fort,„wenigstens habe ich Ihnen nicht das Geringste angemerkt und mich außerdem im Kasino durch einen Einblick in Ihr Tischbuch davon überzeugt, daß Sie gestern Mittag nur eine halbe Flasche Mosel getrunken haben. Davon pflegen erwachsene Menschen in der Regel nicht benommen zu werden, oder können Sie keinen Wein vertragen?”
„Zu Befehl Herr Oberst.”
Trotz des Ernstes der Situation konnte der Lieutenant ein leises Lächeln nicht unterdrücken, zumal ihm in diesem Augenblick der Adjutant einen verständnisinnigen Blick zuwarf: Beide gedachten einer vor kurzem stattgehabten langen und schweren Sitzung.
„Wer war denn die Dame, die Sie gestern Abend in Ihre Arme schlossen? Kennen Sie dieselbe?”
Es lag ein unendlich wegwerfender Ton in dem Ausdruck, mit dem der Herr Oberst das Wort „Dame” sprach.
Das reizte den Offizier. „Ich bitte sehr um Verzeihung, Herr Oberst, es ist eine Dame.”
Das klang sehr kurz und energisch, trotzdem lachte der Herr Oberst spöttisch auf: „Gewiß, gewiß, was man leichthin ,Dame' nennt — wohl gar Ihr sogenanntes Fräulein Braut? Was?”
„Zu Befehl, Herr Oberst, meine Braut, meine wirkliche Braut.”
Der Mensch kann viel vertragen, ehe er in Ohnmacht fällt, sonst hätten in diesem Augenblick alle drei auf der Erde gelegen. Der Herr Oberst, sein Adjutant und Lieutenant von Pelow.
Der Kommandeur war starr, daß er nichts von der Verlobung seines Unterthans wußte, der Adjutant ließ vor Verwunderung die Feder fallen — am erstauntesten von allen aber war der gute Lieutenant selbst über seine Verlobung, von der er bis zu diesem Augenblick gar nichts gewußt hatte.
„Aber das ist mir ja ganz neu,” sagte schließlich der Herr Oberst, „davon haben Sie mir ja noch gar keine Mitteilung gemacht!”
„Zu Befehl, Herr Oberst, die Sache ist auch vorläufig noch geheim — aus Gründen, die anzuführen ich mir zu erlassen bitte, haben wir an eine Veröffentlichung noch nicht denken können, ich hoffe, daß dies aber in den nächsten Wochen möglich sein wird. Ich bitte ganz gehorsamst, bis dahin über meine Worte geneigtest Stillschweigen bewahren zu wollen.”
„Das ist ja ganz selbstverständlich — nun, dann nimmt die ganze Angelegenheit ja ein völlig anderes Gesicht an, dann steht es mir natürlich nicht zu, Ihr Verhalten zu ktitisieren. Den Rat möchte ich Ihnen als älterer Kamerad denn doch geben: stellen Sie sich nie wieder unter die Gasflamme, wenn Sie wollen, daß die Verlobung vorläufig noch geheim bleiben soll. Nun, dann danke ich Ihnen sehr.”
Wenige Minuten später meldete Lieutenant von Pelow sich wieder „zur Stelle”
„Nun, was wollte der Oberst denn von Ihnen?” fragte neugierig der Hauptmann. „Sie haben doch hoffentlich nichts ausgefressen?”
„Aber, Herr Hauptmann!”
Das klang so vorwurfsvoll, daß der Häuptling sich beeilte, seine Worte zurückzunehmen. „Nun ja, seien Sie nur nicht böse, ich meinte ja nur — Sie sind ja ein verständiger Mann, bei dem man vor Thorheiten sicher ist, aber unser Jüngster — wissen Sie, der macht nichts wie Dummheiten, den sollten Sie nur etwas in die Lehre nehmen.”
Ach, und dabei war der „tüchtigste Lieutenant” augenblicklich der größte Sündenbock im Regiment.
Gestern Nachmittag, als er aus dem Kasino gekommen war, hatte er seine Schritte noch nicht gleich nach Hause gelenkt, sondern hatte einen Kameraden besucht, der mit einem schlimmen Fuß krank darniederlag. In fröhlicher Gesellschaft war da stark gezecht worden, sehr stark, und als der gute Pelow, der gar manchen Tropfen vertragen konnte, sich endlich auf den Heimweg machte, war er in der seligsten, ausgelassensten Stimmung gewesen und heiter hatte er vor sich die schöne Melodie hergebrummt: „Das kommt vom Sekt, der macht so heiter.”
Da war ihm seiner Wirtin holdes Töchterlein begegnet, jung und hübsch. Drei Jahre wohnte er nun schon in demselben Hause. Es hatte sich allmählich ein freundschaftliches Verhältnis zwischen ihnen entsponnen und eingedenk des Wortes: „Einen Kuß in Ehren kann niemand verwehren,” hatte er ihr zuweilen an hohen Fest- und Feiertagen einen unschuldigen Kuß auf die frischen Lippen gedrückt. Er hatte Röschen gestern angesprochen und auf seine Bitte hin war sie ein paar Schritte mit ihm gegangen, nur ein paar Schritte, dann hatte sie umkehren wollen, er aber hatte widersprochen und dann endlich erklärt: „Nun, wenn es sein muß, kann ich Sie natürlich nicht länger aufhalten, vorher aber, Röschen, einen Kuß.” Und ehe sie es hatte verhindern können, hatte er sie in die Arme geschlossen, mit der Linken ihr Gesicht zu sich emporgehoben und ihr nicht einen, sondern schnell mehrere Küsse gegeben.
Die Straße war ganz leer gewesen — beide hatten sich hinterher ängstlich umgesehen — kein Mensch war in der Nähe.
Und dennoch war der Herr Oberst vorbeigegangen.
Nun saß er schön in der Tinte.
Er hatte sich in der Unterredung über seinen Kommandeur und dessen spöttisches, höhnisches Wesen geärgert und schließlich hatte er sich als verlobt ausgegeben, ohne es zu sein. Ganz offen und ehrlich aber war der gute Pelow doch nicht, sich selbst gegenüber, wenn er sich vorlog, er hätte das nur aus Mut [recte wohl: Wut. D.Hrsgb.] und Zorn über den Kommandeur, von diesem gereizt, gethan. Ach nein, Pelow wußte, daß er den Ruf eines hervorragend tüchtigen, soliden Offiziers, der er auch wirklich war, besaß, und auf diesen Ruf war er so stolz, wie nur immer ein Mensch auf sein Renommee sein kann, er hütete und pflegte es und sorgte dafür, daß kein Fleck den hellen Schein trübe.
Und nun sollte dieser Kuß ihm den Nimbus der „Tüchtigkeit” rauben? Nie und nimmermehr. Sollte er sich bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit — und der letzteren giebt es mehr als der ersteren — sagen lassen, daß er in keiner Art und Weise die Hoffnungen erfüllt habe, die man in ihn gesetzt, und ähnliche schöne Redensarten mehr? Ds gab es nicht.
So hatte er gelogen, um für den ersten Augenblick groß und rein dazustehen, und der Neid mußte es ihm lassen, er hatte sich mit Anstand und Geschick aus der Patsche gezogen.
An demselben Abend saß Lieutenant von Pelow einsam in seinem Zimmer und dachte ernsthaft über sich und seine Zukunft nach. Was sollte aus der Geschichte werden? Er mußte sich verloben, das war ja klar, zu übereilen brauchte er den Schritt nicht, denn er hatte ja davon gesprochen, daß in den nächsten Wochen die Angelegenheit zur Entscheidung kommen würde. — „Die nächsten Wochen” sind ein sehr dehnbarer Begriff, aber einmal mußten auch sie ein Ende nehmen.
Was dann, wenn er bis dahin keine Braut hatte?
Dann war er blamiert, und blamieren dar sich der tüchtigste Lieutenant des Regiments nicht.
Also auf zur Brautschau, das war das Resultat mehrstündigen Nachdenkens.
„Was man thut, soll man ordentlich thun,” sagte schon Agamemnon auf einem Nachmittagsspaziergang zu seiner Frau, und der gute Lieutenant nahm dies Wort fortan noch mehr als sonst zur goldenen Lebensregel.
Aber eine Braut fand er deshalb doch nicht, er gab sich auf den zahllosen Bällen und Gesellschaften die größte Mühe, er war die Liebenswürdigkeit selbst, er tanzte für Sechs und verschenkte Cotillon-Bouquets für Zwölf, er war unermüdlich für Achtzehn und machte den Hof für Vierundzwanzig.
Aber es half alles nichts, bei keinem der jungen Mädchen glaubte er auch nur eine Spur von Interesse für sich entdecken zu können, und sein eigenes Herz war, wohl weil er sich zu vielen auf einmal gewidmet und daher keine näher kennen gelernt hatte, kalt und gefühllos geblieben.
Mit dem Verloben war es nichts, und nach einer durchwachten Nacht faßte der tüchtigste Lieutenant einen wahrhaft männlichen Entschluß, den er am nächsten Mittag zur Ausführung brachte.
Pünktlich um zwölf Uhr ließ er sich im Regimentsbureau bei dem Herrn Oberst melden.
Huldvollst empfing ihn dieser, denn in der Zwischenzeit hatte er sich eingehend nach ihm erkundigt und überall nur das Beste von ihm gehört.
„Nun, wie stehen Ihre Sachen, mein Lieber? Darf ich Ihnen gratulieren?”
Herr von Pelow legte sein Gesicht in tief ernste Falten.
„Ich komme, um dem Herrn Oberst zu melden, daß teils aus pekuniären, teils aus anderen Gründen meine Verlobung zurückgegangen ist.”
„Das thut mir aber aufrichtig leid, mein Lieber, ich hätte gerade Ihnen, meinem tüchtigsten Offizier, von ganzem Herzen alles Glück gewünscht.”
„Der Herr Oberst sind sehr gütig, der Herr Oberst werden es begreiflich finden, daß ich gerne für einige Zeit von hier fort möchte, und ich möchte eben den Herrn Oberst ganz gehorsamst bitten, wenn demnächst vielleicht einmal ein Kommando frei werden sollte, meiner freundlichst gedenken zu wollen.”
„Aber gewiß, ganz selbstverständlich, ich werde mir die Sache nachher gleich überlegen, ich hoffe bestimmt, schon in der allernächsten Zeit Ihren Wunsch, den ich vollständig begreiflich finde, erfüllen zu können.”
Vierzehn Tage später war Lieutenant von Pelow auf drei Jahre zu den technischen Instituten in Spandau kommandiert. Spandau liegt dicht bei Berlin, und Berlin ist ein schönes Städtchen.
Am Tage vor seiner Abrise gab Pelow im lustigen Kameradenkreise die wahre Geschichte zum Besten, er hatte doch ein etwas schuldbeladenes Gewissen. Alle schwuren strengste Diskretion, dennoch erfuhr sie eines Tages der Herr Oberst. Zuerst wollte er zornig werden, dann aber lachte er laut auf: „Daß Pelow mein tüchtigster Offizier war, habe ich ja gewußt, für so tüchtig hätte ich ihn aber doch nicht gehalten; das soll ihm erst mal einer nachmachen. Eine Lehre will ich mir aber doch daraus ziehen: Nie mehr werde ich mich darum kümmern, wenn meine Lieutenants küssen.”
Und daß der Herr Oberst hielt, was er versprochen — daran war „der tüchtigste Lieutenant” schuld.
„Kansan Lehti” vom 21.1.1904: