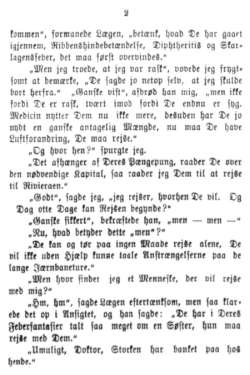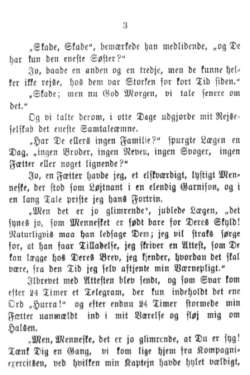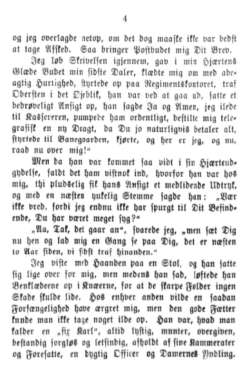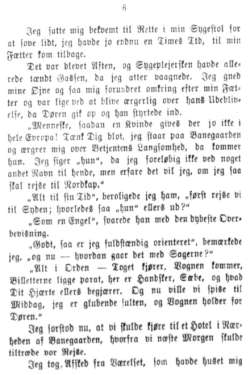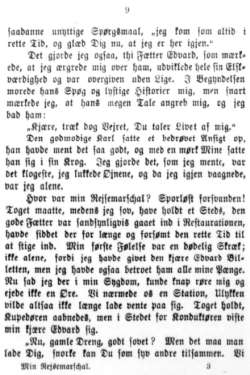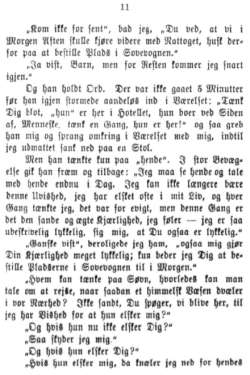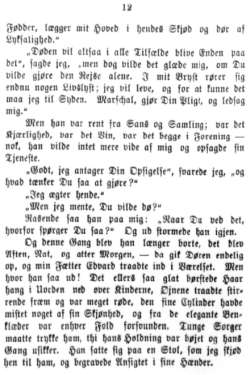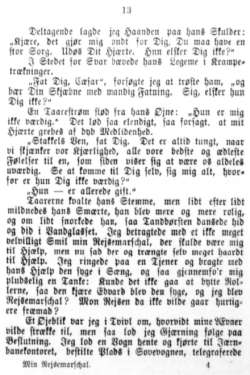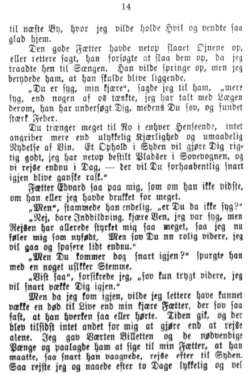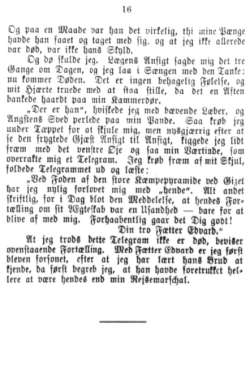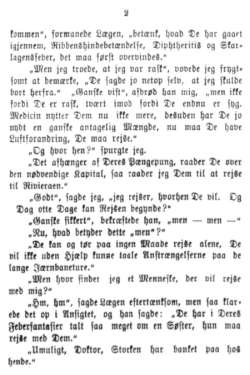
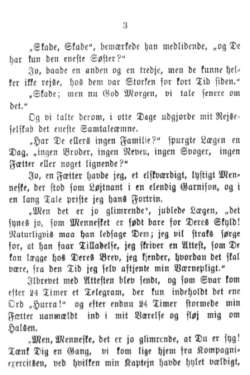
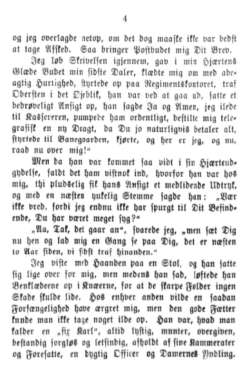

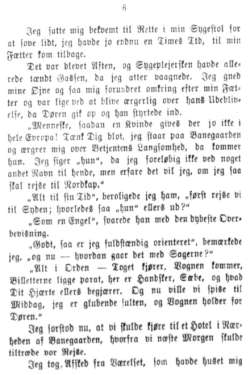


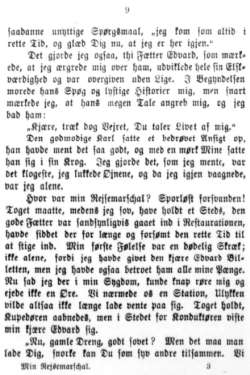

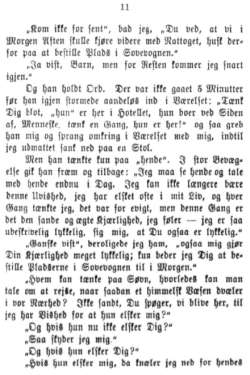
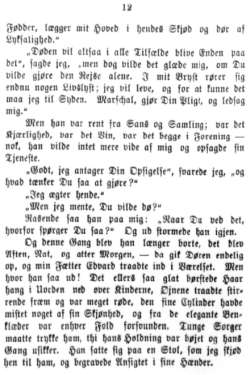
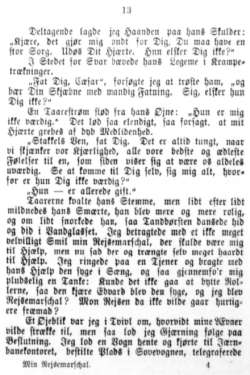
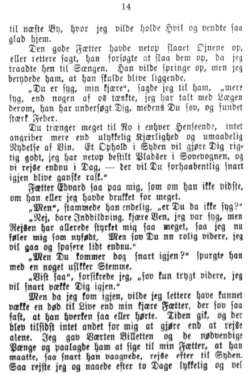

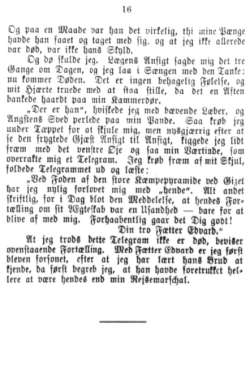
Humoreske von Freiherr von Schlicht.
in: „Deutsche Lesehalle”, Sonntags-Beilage zum Berliner Tageblatt, Nr. 10, 10.3.1895, Seite 73,
in: „Oedenburger Zeitung” vom 4.4.1895 bis 17.4.1895,
in: „Bornholms Tidende” vom 7.9.1895 bis 13.9.1895,
in: „Humoresken” und
in: „Humoresken und Erinnerungen”.
Zwölf Wochen hatte ich im Krankenhaus gelegen, zwölf lange Wochen hatte ich weiter nichts zu sehen bekommen, als die nackten Wände meiner Krankenstube, die barmherzige Schwester und meinen Arzt, dessen beständiges Kopfschütteln, wenn er meinen Puls fühlte, mich fast noch mehr als mein Leiden an den Rand des Grabes zu bringen drohte. Am Anfang hatte ich wie alle Kranken den Arzt mit Fragen bestürmt, wann ich wieder gesund sein werde, aber schließlich es aufgegeben, nachzuforschen, denn entweder bekam ich gar keine Antwort, oder sie lautete „bald”, und das Wort „bald” ist bekanntlich ein sehr dehnbarer Begriff.
Um so größer war daher mein Erstaunen, als der Doktor eines Morgens, nachdem er mich, wie immer kopfschüttelnd, als wäre er ein Chinese, untersucht hatte, das große Wort gelassen aussprach: „In acht Tagen werden Sie das Krankenhaus verlassen können.”
Mit einem Jubelschrei wollte ich aus dem Bett springen und dem Arzt um den Hals fallen, doch ermattet sank ich in die Kissen zurück.
„Sachte, sachte, lieber Freund, soweit sind Sie noch lange nicht,” mahnte der Jünger Aeskulaps, „bedenken Sie, was Sie Alles durchgemacht haben, Rippenfellentzündung, Diphteritis und Scharlach, das soll erst mal überwunden sein.”
„Aber ich denke, ich bin gesund,” wagte ich schüchtern zu bemerken, „Sie sagten doch eben selbst, ich sollte fort von hier.”
„Gewiß,” unterbrach er mich, „aber nicht, weil Sie gesund, sondern weil Sie krank sind. Medizin nützt Ihnen nun nicht mehr, die haben Sie ja auch in hinreichenden Quantitäten genossen, nun müssen Sie Luftveränderung haben, Sie müssen reisen.”
„Und wohin?” fragte ich.
„Das hängt zunächst von Ihrem Geldbeutel ab; verfügen Sie über das nöthige Kleingeld, so rathe ich Ihnen, fahren Sie nach der Riviera.”
„Gut,” sprach ich, „ich fahre, wohin Sie wollen. Und heute in acht Tagen kann die Reise losgehen?”
„Allerdings,” bestätigte er, „aber — aber —”
„Nun, was heißt in diesem Falle „aber”?”
„Sie können und dürfen auf keinen Fall allein reisen. Sie würden die Strapazen der langen Eisenbahnfahrt ohne Hilfe nicht ertragen.”
„Aber wo bekomme ich einen Menschen her, der mit mir fährt?”
„Hm, hm,” machte der Doktor nachdenklich, dann aber sein Gesicht freudig aufleuchten lassend, setzte er hinzu: „Sie haben in Ihren Fieberphantasien so viel von einer Schwester gesprochen, wie wäre es, wenn die mit Ihnen führe?”
„Unmöglich, Doktor, bei der hat der Storch angeklopft.”
„Schade, schade,” bemerkte er mitleidig, „und Sie haben nur die eine Schwester?”
„Nein, noch eine zweite und dritte, die können aber auch nicht fort, bei denen war erst kürzlich der Storch.”
„Schade, schade; nun guten Morgen, wir sprechen weiter darüber.”
Und wir sprachen weiter darüber, acht Tage hindurch bildete meine Reisebegleitung das einzige Gesprächsthema.
„Haben Sie denn sonst Niemand, der Ihnen anverwandt und zugethan ist?” fragte eines Tages der Arzt, „keinen Bruder, keinen Neffen, keinen Enkel, keinen Vetter oder etwas Aehnliches?”
Ja, einen Vetter hatte ich, einen liebenswürdigen, lustigen Menschen, der als Lieutenant in einer elenden Garnison stand, und in längerer Rede pries ich seine Vorzüge.
„Aber das ist ja famos,” jubelte der Doktor, „es scheint ja, als wenn der Mensch extra für Sie geboren ist! Natürlich muß der Sie begleiten; dafür, daß er Urlaub bekommt, werde ich schon sorgen, ich stelle ein Attest über Sie aus, ds wir Ihrem Brief beilegen, kenne das aus der Zeit, da ich mein Jahr abdiente, wollen wir schon machen.”
Der Eilbrief mit dem beiliegenden Attest ging ab, und als Antwort kam nach vierundzwanzig Stunden ein Telegramm, das nichts enthielt als das Wort „Hurrah”; und nach weiteren vierundzwanzig Stunden stürmte mein Vetter unangemeldet in mein Zimmer und flog mir um den Hals.
„Aber Mensch, das ist ja famos, daß Du krank bist! Denke Dir mal, wir kamen gerade von dem Kompagnieexerziren, bei dem mich mein Hauptmann riesig „angeheult” hatte, nach Haus, und ich überlegte gerade, ob es nicht vielleicht doch besser wäre, den Abschied zu nehmen. Da bringt mir der Postbote Deinen Brief.
Ich durchfliege das Schreiben, drücke dem Stephansjünger in der Freude meines Herzens den letzten Thaler in die Hand, ziehe mich mit affenartiger Geschwindigkeit um, stürze auf das Regimentsbüreau, erfasse den Oberst in dem Augenblick, als er fortgehen will, mache ein todestrauriges Gesicht, er sagt Ja und Amen, ich eile zum Zahlmeister, pumpe den Knecht ordentlich an, denn Du bezahlst ja doch natürlich Alles, bestelle mir telegraphisch einen neuen Civilanzug, stürze nach dem Bahnhof, und voilà, da bin ich, und nun verfüge über mich!”
Aber als er in seinem Herzensgruß so weit gekommen war, mochte ihm wohl einfallen, weshalb er bei mir sei, denn sein Gesicht nahm plötzlich einen mitleidsvollen Ausdruck an, und fast mit kläglicher Stimme sprach er: „Sei nicht böse, daß ich mich noch nicht nach Deinem Befinden erkundigt habe, Du bist schwer krank gewesen?”
„Na, danke, es geht so,” antwortete ich, „nun aber setze Dich hin und laß Dich einmal ansehen, es sind fast zwei Jahre, daß wir uns zuletzt trafen.”
Ich deutete mit der Hand auf einen Stuhl, und er nahm mir gegenüber Platz, aber während er sich hinsetzte, zog er vorsichtig die Beinkleider am Knie in die Höhe, damit die scharfen Falten ja keinen Schaden erlitten.
Bei jeem Anderen würde ich mich über solche Eitelkeit geärgert haben, aber dem guten Vetter konnte man nichts übel nehmen. Er war, was man ein „lieber Kerl” nennt, immer lustig, heiter, ausgelassen, immer sorglos und leichtsinnig, beliebt bei den Kameraden und bei seinen Vorgesetzten, ein tüchtiger Offizier und großer Damenfreund. Nichts hatte sich scheinbar an ihm verändert, nur seine Zungenfertigkeit war noch größer geworden als früher.
„So, und nun weihe mich in meine Pflichten ein,” begann er, „Du bedarfst der Hilfe und Unterstützung während der Fahrt? Wann fahren wir denn?”
„Morgen Mittag. Vorher aber mußt Du mir noch allerlei besorgen, und damit Du auch nichts vergißt und Dich hier in der fremden Stadt zurecht findest, habe ich es Dir hier aufgeschrieben.”
„Gewiß, gewiß,” stimmte er mir bei, „wird Alles schönstens besorgt. Kein Fürst hat einen besseren Reisemarschall als Du in mir!”
Ich gab ihm die nöthige Anweisung, und wir reichten uns zum Abschied die Hand, aber schon in der Thür wandte er sich noch einmal um:
„Und dann — was ich noch sagen wollte — hast Du nicht etwas Geld für mich?”
„Aber natürlich,” lachte ich, „verzeih, daß ich nicht daran dachte, ich glaubte, weil Du den Zahlmeister angepumpt —”
„Futsch,” unterbrach er mich traurig, „Alles futsch, Du weißt nicht, wie theuer das Leben ist.”
Ich gab ihm eine Summe Geldes und wiederholte nochmals: „Also zuerst Rundreisebillet, dann Droscke bestellen, genau erkundigen, wann der Z ug fährt und von welchem Bahnhof, dann Alles, was noch auf dem Zettel steht, als da ist: Seife, Handschuhe, Halstuch —”
„Wird Alles besorgt, in einer Stunde bin ich wieder bei Dir,” und fort war er.
Ich setzte mich in meinem bequemen Krankenstuhl zurecht, um ein wenig zu schlafen, ich hatte ja fast noch eine Stunde Zeit, bis mein Vetter wiederkam.
Es war Abend geworden, und die Schwester hatte bereits das Gas angezündet, als ich wieder erwachte. Ich rieb mir die Augen und sah mich verwundert nach meinem Vetter um, und schon wollte ich über sein Ausbleiben ärgerlich werden, als sich die Thür öffnete und mein Reisemarschall in das Zimmer stürzte.
„Mensch, solch Weib giebt es ja in Europa nicht wieder! Denk Dir nur, ich stehe auf dem Bahnhof und ärgere mich über die Schwerfälligkeit des Schalterbeamten, da kommt sie. Ich sage „sie”, denn vorläufig weiß ich ihren anderen Namen noch nicht, aber erfahren werde ich ihn, und wenn ich ihretwegen nach dem Nordkap fahren sollte.”
„Alles zu seiner Zeit,” beruhigte ich ihn, „erst fahren wir hübsch nach dem Süden; wie sah „sie” denn aus?”
„Wie ein Engel,” erwiederte er mit dem Brustton der tiefsten Ueberzeugung.
„Na, dann bin ich völlig orientirt,” bemerkte ich, „und nun — was machen die Besorgungen?”
„Alles erledigt — der Zug fährt, die Droschke kommt, die Billets liegen bereit, hier sind Handschuhe, Seife und was Dein Herz sonst noch begehrt. Und nun wollen wir Mittag essen, ich habe einen Mordshunger, die Droschke steht vor der Thür.”
Aber ich lehnte ab, dagegen war ich damit einverstanden, daß wir jetzt in ein Hotel fuhren, nahe dem Bahnhof, von dem wir am nächsten Morgen unsere Reise antreten mußten.
Ich nahm Abschied von dem Zimmer, das mich ein Vierteljahr beherbergt, und eine halbe Stunde später stiegen wir in dem Hotel ab. Kaum hatten wir die Schwelle überschritten, als mein Reisemarschall mir heftig den Arm drückte:
„Du, das ist sie,” flüsterte er mir leise zu, und mit der Geschwindigkeit eines Rennpferdes pflog er die steile Treppe hinan, auf der zwei Damen um die Ecke bogen.
„Wenn Ihnen ein Zimmer im dritten Stock recht ist —” bemerkte der Portier, „sonst ist Alles besetzt.”
Ich willigte ein, aber vergebens sah ich mich nach einem hilfreichen Arm um; da kam mein Vetter auch schon wieder die Treppe heruntergesaust:
„Schade, das war sie nicht &mdash, war nur ihr Hut, genau solchen hatte sie auch auf — ich sage Dir, denn er stand ihr zum Küssen,” dann aber bot er mir ritterlich den Arm, und vorsichtig wie eine Mutter ihr Kind geleitete er mich die Treppe hinauf, packte mich zu Bett und ging dann noch etwas spazieren.
Als ich am nächsten Morgen um acht Uhr erwachte, kam Vetter Eduard gerade von seinem Spaziergang zurück; nur der Himmel wußte, in welchen Cafés und Restaurants er die ganze Nacht durchgekneipt hatte, aber er sah so frisch und sauber aus, als wenn er eben ein Bad genommen hätte.
„Guten Morgen, Vetter, na, gut geschlafen? Weißt Du, ich schnarche so entsetzlich, und da glaubte ich, ich würde Dich doch nur stören,” begrüßte er mich, „übrigens, ich habe mich vorsichtshalber doch lieber noch mal erkundigt, der Zug geht bereits in einer halben Stunde.”
Erschrocken fuhr ich in die Höhe. „In einer halben Stunde, wie sollen wir denn da mitkommen?”
„Viel Zeit,” tröstete er mich, „ich stehe immer erst eine Viertelstunde vor dem Dienst auf und bin noch nie in meinem Leben zu spät gekommen. Geht Alles, nur nicht zaghaft sein, laß mich nur machen.”
Er setzte die elektrische Glocke in Bewegung, darauf eine Schaar von Kellnern zusammenlief. „So, Kinder, nun man los. Sie bringen sofort Frühstück — Sie helfen meinem Vetter beim Anziehen — Sie packen den Koffer — Sie pfeifen eine Droschke — Sie bringen sofort die Rechnung, und ich gebe Euch Allen ein gutes Trinkgeld.”
Das letzte Wort wirkte, und als wir auf dem Bahnhof ankamen, hatten wir noch eine Minute Zeit. „Siehst Du, das ist vornehm,” triumphirte mein Vetter, „das ist eben die Kunst eines Reisemarschalls, nie zu spät, aber auch nie mit dem hohen Herrn zu früh zu kommen.”
Wir erhielten in einem fast noch leeren Kupee zwei gute Plätze, und die Reise konnte losgehen, aber kaum hatten wir uns niedergelassen, als mein Vetter, wie von der Tarantel gestochen, in die Höhe sprang. „Herr Gott, die Rundreisebillets liegen ja noch am Schalter.”
Er warf den Schaffner, der sich ihm entgegenstellte, zur Seite und raste dann, daß Alles ihm erschrocken auswich. Triumphirend erschien er gerade in dem Augenblick wieder, als der Zug sich in Bewegung setzte, und die Mahnrufe der Beamten und das Schelten eines Polizisten nicht achtend, sprang er auf das Trittbrett, öffnete die Thür und nahm seinen Platz mir gegenüber wieder ein.
„Na weißt Du,” bemerkte ich, „dies Mal wärest Du aber doch beinahe zu spät gekommen, und was dann?”
„Was dann?” erwiederte er, „warum sich mit solchen unnützen Fragen quälen, ich kam wie immer rechtzeitig, und nun freue Dich, daß ich hier bin.”
Das that ich auch, denn Vetter Eduard, der mir anmerkte, daß ich mich über sein Verhalten ärgerte, entwickelte seine ganze Liebenswürdigkeit und war von einer Ausgelassenheit sonder Gleichen. Anfangs machten seine Scherze und lustigen Geschichten mir Vergnügen, aber nur zu bald merkte ich, daß mich das Zuhören und das viele Sprechen angriff, und so bat ich denn: „Liebster, halte den Athem an, Du redest mich todt.”
Der gute Kerl machte ein ganz trauriges Gesicht, er hatte es so gut gemeint, und mit betrübter Miene setzte er sich in seine Ecke. Ich that das Klügste, was ich thun zu können glaubte, ich schloß die Augen, und als ich wieder erwachte, war ich allein.
Wo war mein Reisemarschall? Spurlos verschwunden! Der Zug mußte, während ich schlief, irgendwo gehalten haben, der gute Vetter war wahrscheinlich in die Restauration gegangen, hatte dort zu lange gesessen und das rechtzeitige Einsteigen versäumt. Meine erste Empfindung war die eines tödtlichen Schreckens: nicht allein, daß ich dem lieben Eduard die Billets gegeben, hatte ich ihm auch mein ganzes Geld anvertraut. Nun saß ich da mit meiner Krankheit, konnte mich kaum rühren und besaß nicht einen Pfennig. Wir näherten uns einer Station, das Unglück sollte also nicht mehr lange auf sich warten lassen. Der Zug hielt, die Kupeethür ward geöffnet, aber anstatt eines Schaffners erschien mein lieber Eduard.
„Nun, alter Junge, gut geschlafen? Das muß Dir aber der Neid lassen, schnarchen kannst Du wie sieben Andere zusammen. Wir sind Alle in ein Nebenkupee geflohen und haben einen Skat gespielt, fünf Mark habe ich schon gewonnen, wenn das so weitergeht, werde ich noch ein steinreicher Mann. Aber Kind, was hast Du denn, wie siehst Du denn nur aus?”
„Max, bleibe bei mir,” citirte ich, „ich habe mich so geängstigt Deinet- und meinetwegen.”
„Aber natürlich, selbstverständlich, ich will die drei letzten Ronden ansagen, auf der nächsten Station komme ich zu Dir.”
Nach einer halben Stunde stieg er wieder bei mir ein, und ohne weitere Zwischenfälle erreichten wir München, wo wir für einen Tag bleiben wollten, denn nur allmälig, in kleinen Tagereisen, sollte ich fahren.
Wir fuhren in das Hotel, und hier ließ ich mir vorsichtshalber mein Billet und den größten Theil meines Geldes wiedergeben. Der liebe Vetter war außer sich: „Dein Geld sollst Du haben, meinetwegen auch meinen Skatgewinn, aber Dein Billet erhältst Du nicht, das zeugt von einem Mangel an Vertrauen, den ich mir nicht gefallen lassen kann. Keine Mutter kann besser für ihr neugeborenes Kind sorgen als ich für Dich, warum mußt Du Dein Billet haben?”
„Lediglich zu meiner Beruhigung,” antwortete ich, „es wäre doch immerhin möglich, daß einem von uns ein Unglück zustößt, Du kannst sterben, oder ich kann todtbleiben, was dann? Dann haben wir wenigstens eine Legitimation bei uns.”
Nach langem Reden setzte ich meinen Willen durch, und Vetter Eduard, der sich über mich halbtodt geärgert hatte, bestellte zur Versöhnung eine Flasche Mosel, von der er mir zur Strafe nichts abgab. Dann ging er „spazieren”, nur auf ein Stündchen, höchstens anderthalb.
„Komm nicht so spät,” bat ich, „Du weißt, morgen Abend wollen wir mit dem Nachtzug weiterfahren, denkst Du auch daran, Plätze im Schlafwagen zu reserviren?”
„Aber natürlich, Kind, natürlich, außerdem komme ich sofort wieder.”
Und er hielt Wort. Noch keine fünf Minuten waren vergangen, da stürmte er schon wieder athemlos zu mir ins Zimmer: „Denk Dir nur, „sie” ist hier im Hotel, sie wohnt nebenan, Mensch, denk Dir mal, sie ist hier!” und mich umfassend, sprang er mit mir im Zimmer herum, bis ich auf einen Stuhl sank.
Aber er dachte nur an „sie”. In großer Erregung ging er im Zimmer auf und ab: „Ich muß sie sehen und sprechen, und zwr noch heute. Nicht länger ertrage ich diese Ungewißheit, ich habe oft geliebt in meinem Leben, und jedesmal dachte ich, es wäre für ewig, dieses Mal aber ist es die wahre und echte Liebe, die ich in meinem Busen hege, ich bin so unbeschreiblich glücklich, sage mir, daß auch Du glücklich bist.”
„Gewiß,” bestätigte ich ihm, „auch mich macht Deine Liebe namenlos glücklich; nun aber besorge, bitte, die Plätze für den Schlafwagen zu der morgigen Reise.”
„Wer kann an Schlafen denken, wie kann man von Reisen sprechen, wenn ein solches himmlisches Geschöpf in unserer Nähe weilt? Nicht wahr, Du scherzest, wir bleiben hier, bis ich Gewißheit habe, ob das Götterweib mich liebt?”
„Und wenn sie Dich nicht liebt?”
„Dann schieße ich mich todt.”
„Und wenn sie Dich liebt?”
„Wenn sie mich liebt, dann kniee ich nieder zu ihren Füßen, bette meinen Kopf in ihren Schooß und sterbe vor Glückseligkeit.”
„Gestorben wird also auf alle Fälle,” bemerkte ich, „nur ganz nach Belieben, aber ich würde mich sehr freuen, wenn Du diesen Schritt wenigstens vorläufig allein thun wolltest. In meiner Brust regt sich etwas wie Lebenslust; ich will leben, und damit ich es kann, muß ich an die Riviera. Marschall, thue Deine Pflicht und begleite mich.”
Aber der Reisemarschall war außer Rand und Band; war es Liebe, war es der Moët und Chandon, war es beides zusammen — genug, er wollte von mir nichts mehr wissen und kündigte mir seine Dienste.
„Gut, ich nehme Deine Demission an,” antwortete ich, „und was gedenkst Du zu thun?”
„Ich heirathe sie.”
„Aber ich denke, Du willst sterben?”
Wüthend sah er mich an: „Wenn Du das weißt, warum fragst Du denn erst?” und wieder stürmte er davon.
Und dieses Mal blieb er länger aus, es ward Abend, Nacht und wieder Morgen, — da endlich öffnete sich die Thür, und mein lieber Vetter trat in das Zimmer. Aber wie sah er aus! Das sonst so glatt gebürstete Haar hing wirr um seine Schläfen, die Augen traten starr hervor und waren stark geröthet, der tadellose Cylinder hatte beträchtliche Einbußen an seiner Schönheit erfahren, und aus den eleganten Beinkleidern war jegliche Falte verschwunden. Schwere Sorgen mußten ihn bedrücken, denn seine Haltung war gebeugt und sein Gang unsicher. Er ließ sich auf einen Stuhl nieder, den ich ihm hinschob, und vergrub sein Gesicht in beide Hände.
Theilnehmend legte ich die Recht auf seine Schulter: „Liebster, Du jammerst mich, wie Du selber einen Jammer zu haben scheinst. Und nun schütte Dein Herz aus. Sie liebt Dich nicht?”
Statt aller Antwort erbebte sein Körper in konvulsivischen Zuckungen.
„Fasse Dich, Cäsar,” versuchte ich ihn zu trösten, „und trage Dein Geschick mit männlicher Fassung. Sag, sie liebt Dich nicht?”
Ein Thränenstrom entquoll seinen Augen: „Sie ist meiner nicht werth.” Das klang so elend, so verzagt, daß tiefes Mitgefühl mein Herz ergriff.
„Armer Freund, fasse Dich. Es ist immer schwer, wenn wir unsere Liebe, das Heiligste, was wir zu vergeben haben, einem Wesen schenken, das sich hinterher als unserer unwürdig erweist. Erleichtere Dein Gemüth, sage mir Alles, warum ist sie Deiner nicht werth?”
„Sie — ist schon verheirathet.” Thränen erstickten seine Stimme, aber allmälig legte sich sein Schmerz, er wurde ruhiger und ruhiger, und nach wenigen Minuten schnarchte er, daß die Zahnbürste im Wasserglas hin- und hertanzte. Mit nicht gerade wohlwollenden Blicken betrachtete ich meinen Reisemarschall, der mir eine Hilfe sein sollte, nun aber selbst der Unterstützung bedürftig mir gegenüber saß. Ich klingelte einem Kellner und brachte mit seiner Hilfe den Kranken zu Bett, und dabei durchfuhr mich plötzlich ein Gedanke. Wie wäre es, wenn die Rollen plötzlich getauscht würden, wenn der liebe Eduard der Kranke und ich der Reisemarschall wäre? Ob wir dann nicht besser vorwärts kämen?
Einen Augenblick zweifelte ich, ob mein Können wohl dem Sollen entspräche, dann aber ließ ich dem Entschluß die That folgen. Ich ließ mir eine Droschke kommen, fuhr nach dem Büreau der Eisenbahn, bestellte mir Plätze im Schlafwagen, telegraphirte nach der nächsten Stadt, in der ich die zweite Rast zu machen gedachte, und kehrte dann frohlockend heim.
Der gute Vetter hatte gerade die Augen aufgeschlagen oder, richtiger gesagt, versucht, sie aufzuschlagen, als ich an sein Lager trat. Er wollte aufspringen, doch ich winkte ihm, liegen zu bleiben.
„Du bist krank, mein Lieber,” sprach ich zu ihm, „kränker, als wir Beide glauben, ich habe mit dem Arzt gesprochen, der Dich, während Du schliefst, untersucht und starke Fiebersymptome festgestellt hat. Du bedarfst dringend der Ruhe und Schonung; nichts greift mehr an, als unglückliche Liebe und übermäßiger Sektgenuß. Ein Aufenthalt im Süden wird Dir sehr wohl thun, ich habe soeben Plätze im Schlafwagen belegen lassen und heute noch fahren wir nach der Riviera, wo Du Dich hoffentlich bald wieder ganz erholen wirst.”
Vetter Eduard sah mnich an, als wisse er nicht genau, ob er oder ich zu viel getrunken habe.
„Aber,” stotterte er endlich, „ich denke, Du bist krank?”
„Einbildung, lieber Freund, ich war krank, aber die bisherige Reise hat mich schon so gestärkt, daß ich mich wie neugeboren fühle. Nun aber schlaf ruhig weiter, ich will noch etwas spazieren gehen.”
„Kommst Du auch wieder?” fragte er mit etwas unsicherer Stimme.
„Gewiß,” bestärigte ich, „schlafe nur unbesorgt, ich werde Dich schon wecken.”
Aber eher hätte ich am Nachmittag einen Todten erwecken können als meinen lieben Vetter; der schlief so fest, daß er nichts sah und nichts hörte. Die Zeit drängte, und so blieb mir denn nichts Anderes übrig, als allein zu reisen. Ich händigte dem Wirth das Rundreisebillet und das nöthige Kleingeld ein und trug ihm auf, meinem Vetter zu sagen, er möchte, wenn er aufgestanden, ein bischen nach der Riviera kommen, ich sei schon vorangegangen. Dann fuhr ich davon und langte nach zwei Tagen glücklich an meinem Reiseziel an. Vierundzwanzig Stunden später traf auch der liebe Vetter ein. Er war auf mich so böse, daß er mir nicht einmal die Hand reichte, als wir uns begrüßten.
„Weißt Du's übrigens schon?” fragte ich ihn; „„sie” ist hier.”
„Welche „sie”?”
„Nun, ich denke, es giebt nur eine „sie”!”
„Aber die kennst Du doch gar nicht?”
„Allerdings nur von Ansehen. Ich traf sie in München im Hotel und heute Morgen auf der Promenade, und ich glaube mich nicht zu irren, wenn ich sage, daß sie „sie” ist.”
Er packte mich am Arm: „Komm, führe mich zu ihr.”
„Aber ich weiß ja gar nicht, wo sie wohnt.”
„Wir werden sie schon finden.”
Aber wir suchten vergebens, und als meine Kräfte anfingen, nachzulassen, suchte Eduard allein weiter. „Spätestens in einer halben Stunde hole ich Dich zum Essen ab.”
Ich ging nach Hause und legte mich nieder, aber Stunde auf Stunde verrann, ohne daß der liebe Vetter sich wieder sehen ließ. Es wurde Abend, Nacht und wieder Morgen, und noch immer stellte Eduard sich nicht ein. Eine lebhafte Unruhe ergriff mich; ich begann zu fürchten, daß ihm ein Unglück zugestoßen, und meine Zweifel wurden fast zur Gewißheit, als drei Tage und drei Nächte verflossen waren, ohne daß ich die leiseste Nachricht von ihm erhielt. Ich lebte in der tödtlichsten Aufregung, ein heftiges Fieber warf mich von Neuem nieder, und besorgt schüttelte der Doktor den Kopf, wenn er meinen Pulsschlag fühlte. Ich fühlte es nur zu gut, wie nahe ich meinem Ende sei, und das Gefühl des vollständigen Verlassenseins trug nicht dazu bei, mein Befinden zu bessern.
Von Vetter Eduard fehlte noch immer jede Spur. Ich hatte die Behörden benachrichtigen lassen, und seit acht Tagen spielte der Telegraph nach allen Richtungen, Eduard wurde gesucht, als wäre er der größte Raubmörder. Und beinahe war er es wirklich: denn die Börse hatte ich ihm nach den ersten fünf Minuten des Wiedersehens eingehändigt, und wenn ich noch nicht todt war, so war das ganz gewiß nicht seine Schuld. Denn ich sollte sterben. Das Gesicht des Arztes verkündete mir das alle Tage dreimal, und ich lag im Bett mit dem Gedanken: nun kommt der Tod. Das ist ein niederträchtiges Gefühl, — und mein Herz drohte mir still zu stehen, als es eines Abends mit harten Fingern an mein Zimmer klopfte.
„Das ist er,” flüsterte ich mit bebenden Lippen, und der Angstschweiß trat auf meine Stirn. Dann kroch ich unter die Decke, um mich nicht erwischen zu lassen, neugierig aber, den gefürchteten Gast von Angesicht zu Angesicht zu sehen, blinzelte ich mit dem linken Auge und erblickte meine Wirthin, die mir ein Telegramm überreichte. Ich kroch aus meinem Versteck hervor, entfaltete das Papier und las:
„Am Fuße der Riesenpyramiden von Gizeh habe ich mich soeben mit ihr, der Göttlichen, verlobt. Alles Andere schriftlich, nur für heute noch die Mittheilung, daß „ihr” Gerede von ihrer Vermählung eine Lüge war, um mich los zu werden. Hoffentlich geht es Dir gut!
Dein treuer Vetter Eduard.”
Daß ich trotz des Telegramms nicht gestorben bin, beweist die obige Geschichte. Mit Vetter Eduard habe ich mich erst versöhnt, nachdem ich seine Braut kennen gelernt hatte; da allerdings begriff ich es, daß er es vorgezogen hatte, lieber ihr, als mein Reisemarschall zu sein.
„Bornholms Tidende” vom 7., 9., 11. und 13.9.1895: