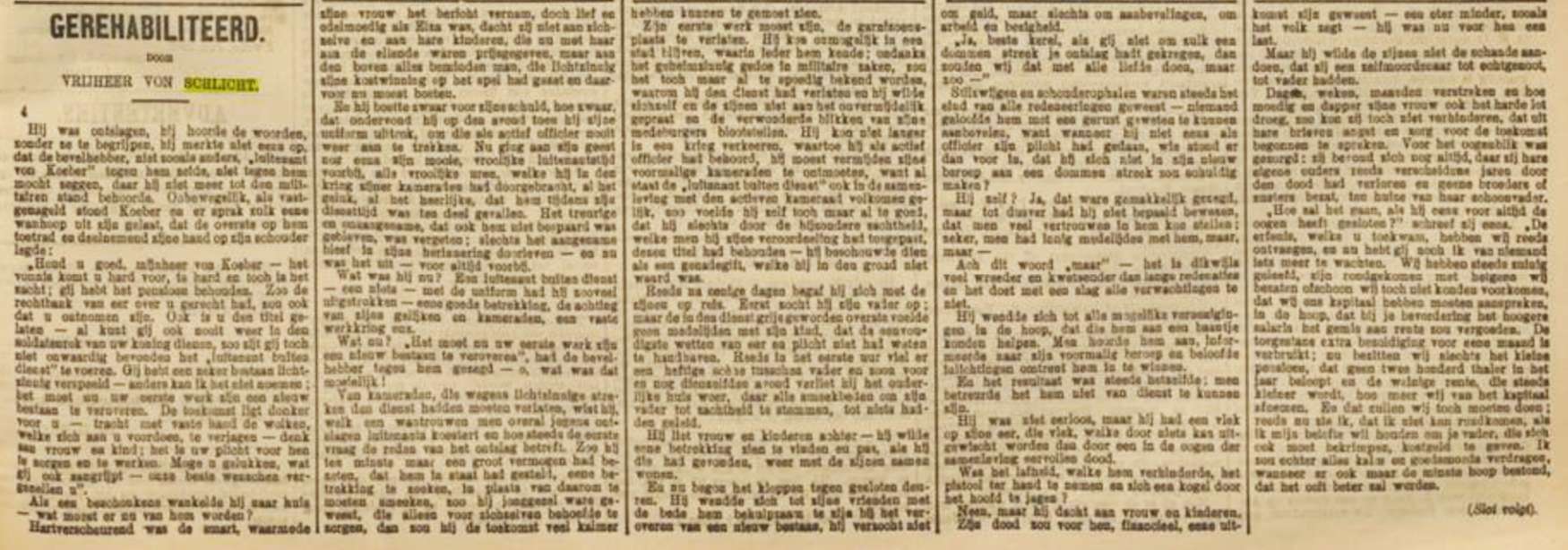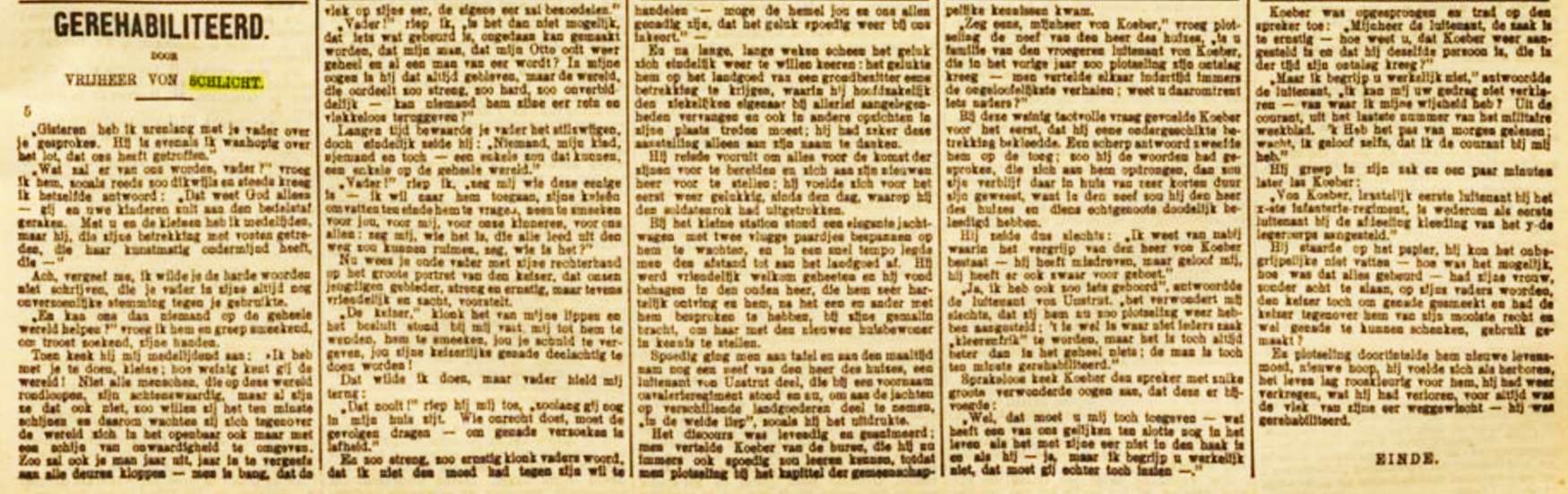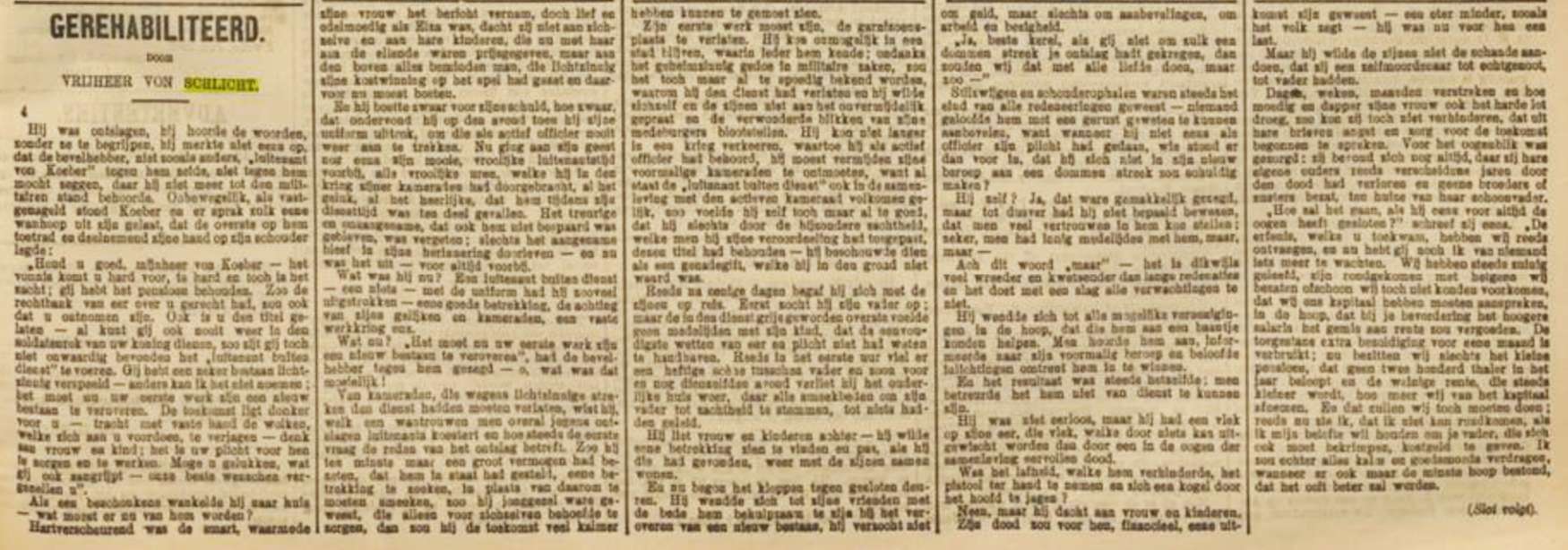
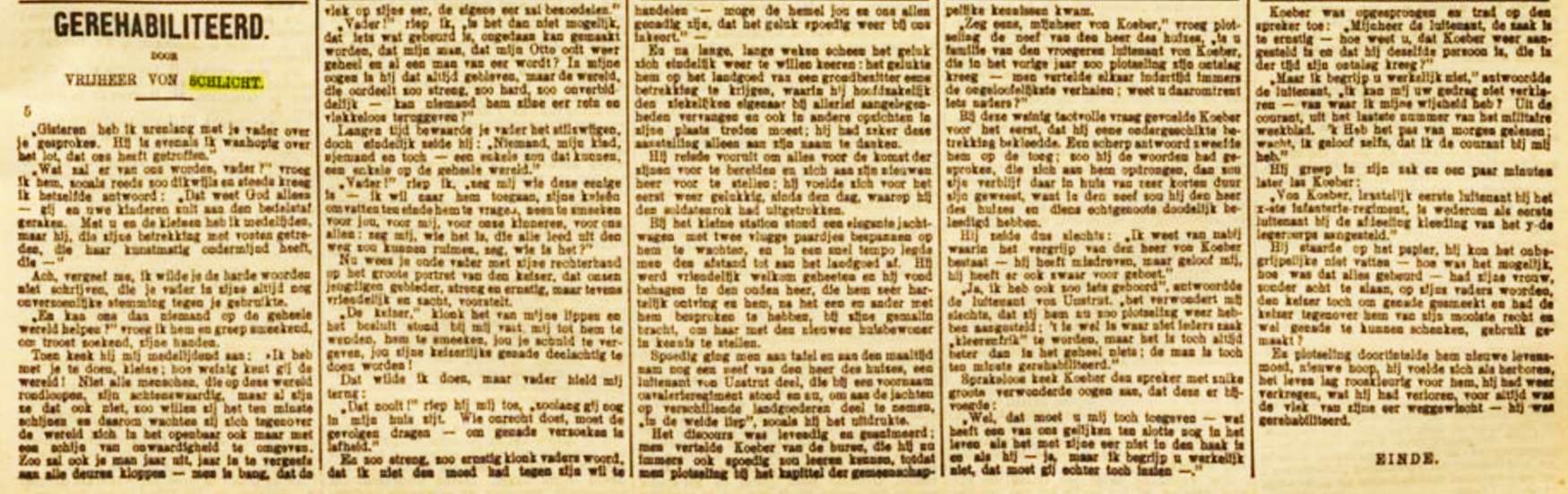
Erzählung von Freiherrn von Schlicht.
in: „Provinciale Drentsche en Asser courant” vom 31.7.1907 bis 6.8.1907 und
in: „Um Ehre.”.
Es war, um mit Shakespeare zu sprechen, etwas faul im Staate Dänemark — das merkten alle, selbst die Fähnriche, die, weder Fisch noch Vogel, sich um gar nichts anderes auf der Welt als nur um ihren Dienst zu kümmern haben.
Um zwei Uhr wurde jeden Mittag im Kasino gegessen; um dreiviertel auf zwei Uhr erschien plötzlich und unvermutet der Herr Oberst, gefolgt von denjenigen Herren, die nicht am gemeinsamen Mittagstisch teilnahmen, und wünschte die Herren Stabsoffiziere und Hauptleute einen Augenblick zu sprechen. Die Herren zogen sich in das Billardzimmer zurück, in dem immer diejenigen Unterredungen stattfanden, die keinen Zeugen brauchten — dort war man am sichersten, nicht gestört zu werden. Trotzdem wurden heute noch die Thüren verschlossen, und der Unteroffizier, der die Ordonnanzen unter sich hatte, wurde dafür verantwortlich gemacht, daß keiner seiner dienenden Geister sich den nach dem Billardzimmer führenden Thüren nähere.
Inzwischen warteten die Herren Leutnants darauf, daß endlich die Suppe aufgetragen würde. Um einhalb vier Uhr hatten die meisten von ihnen schon wieder Dienst, zu dem einige einen Weg von einer halben Stunde und darüber hatten; alle Augenblicke sahen sie nach der Uhr; die gute Sitte verlangte es, daß sie auf die älteren Herren der Tischgesellschaft warteten.
Endlich — es war fast einhalb drei Uhr — öffneten sich die nach dem Speisesaal führenden Thüren, und die Herren erschienen. Sie nahmen ihre Plätze ein, und gleich darauf wurde die Suppe aufgetragen.
Nicht wie sonst herrschte bei Tisch eine heitere, lebhafte Unterhaltung und fröhliches Lachen und Scherzen — die Hauptleute steckten die Köpfe zusammen und tuschelten leise miteinander. Der Paragraph der Tischordnung, der da besagte, daß jede geheimnisvolle Unterhaltung, weil unkameradschaftlich und kränkend für den Nachbar, mit drei Mark Geldstrafe geahndet werde, schien für heute außer Kraft getreten zu sein.
Sobald eine Speise serviert war, erklang das „Ordonnanzen hinaus” des Tischältesten — aber diese Vorsicht war unnötig, selbst die Herren Leutnants, die die Ohren spitzten, um ein Wort der Unterhaltung aufzufangen und so zu erfahren, was denn eigentlich los sei, hörten weiter nichts als zuweilen ein „Unglaublich — wie kann er aber auch — wer hätte das von ihm gedacht” und ähnliche Redensarten.
Selbst das Parolebuch, das nach Tisch, als die Lichter auf den Tisch gestellt waren, den Herren vorgelegt wurde, und das sonst alles Wissenswerte zu enthalten pflegte, brachte den Neugierigen keine Aufklärung, und sie mußten zum Dienst gehen, ohne ihren Wissensdurst gestillt zu haben.
Was war geschehen?
Sorgfältig wurde das Geheimnis von den Eingeweihten gehütet und bewahrt; mehrere Tage vergingen, ohne daß man etwas erfuhr.
„Aber wo steckt denn Koeber eigentlich?” fregte eines Mittags ein älterer Sekondeleutnant bei Tisch seinen Nachbar und, als dieser ihm keine Antwort zu geben vermochte, seinen ihm gegenübersitzenden Bataillonskommandeur. „Er pflegt doch sonst jede Woche einmal hier zu essen; ich habe ihn seit einer Ewigkeit nicht gesehen.”
„Er wird wohl von seiner Gattin keine Erlaubnis bekommen haben, auszugehen,” versuchte der Herr Major, der eingefleischteste aller Junggesellen, zu scherzen: „verheiratet sein ist gut, ledig sein aber ist besser.”
„Koeber unter dem Patoffel?” lachte der Sekond, „ds glauben der Herr Major doch selbst nicht. Wollen wir nicht einmal hinschicken und ihn fragen lassen, ob er nicht zu einem Lachs herkommen wolle?”
Der Herr Major riet ab und versuchte, das Gespräch auf ein anderes Thema zu bringen, als aber der Leutnant trotzdem einer Ordonnanz den Befehl gab, nach Tisch einmal zu Herrn von Koeber zu gehen, sagte der Herr Major:
„Thun Sie mir persönlich den Gefallen und schicken Sie die Ordonnanz nicht hin.”
Und plötzlich wußte der Leutnant, daß dort etwas nicht in Ordnung sein, und er machte ein so erschrockenes, angsterfülltes Gesicht, daß der Herr Major, tief aufatmend, ein halb anklagendes, halb tröstendes „Ja — ja” hervorstieß.
Niemand hatte es zuerst gesagt, aber auf einmal wußten sie es alle: „Koeber ist nicht, wie einige Kameraden erzählt hatten, beurlaubt, sondern er ist bis auf weiteres vom Dienst dispensiert.”
Vom Dienst dispensiert — jeder, der einmal den bunten Rock angehabt hat, weiß, was das bedeutet, ein undefinierbares Etwas ist mit diesem Wort verbunden, es bewirkt, daß man einen Kameraden, dem man soeben noch freundschaftlich die Hand gedrückt hat, scheu und verlegen von der Seite ansieht. Vom Dienst dispensiert wird der Offizier — Krankheitsfälle und Beurlaubungen natürlich ausgenommen — nur dann, wenn er irgend etwas gethan hat, das mit dem Begriff, den das Wort „Offizier” umschließt, nicht in Einklang zu bringen ist. Niemand hatte gesagt, daß Koeber weder krank noch beurlaubt sei, aber eine innere Stimme sagte allen, daß hier ein anderer Grund vorliege; plötzlich wußten alle, daß es sich bei der sogenannten Stabsoffiziersparole, bei der auch die Hauptleute zugegen sind, nur um ihn gehandelt haben könne.
Vom Dienst dispensiert — jeder wußte, welche Folgen dies Wort in sich schließt.
Noch wußte niemand, um was es sich handelte, was vorgefallen war, bis man plötzlich erfuhr, er habe wissentlich eine falsche dienstliche Meldung erstattet.
Aber das war ja gar nicht möglich, gar nicht denkbar; von jedem anderen hätte man es vielleicht geglaubt, aber von Koeber? Nie und nimmermehr. Und doch mußte etwas Wahres an dem Gerücht sein, aber die Verdachtsmomente mußten sehr schwerer, ernstwiegender Natur sein. Zaudert der Richter schon, ehe er einen bisher völlig Unbescholtenen in Untersuchungshaft nehmen läßt, so zögert ein Regimentskommandeur noch länger, ehe er einen Offizier, einen ihm gesellschaftlich Gleichstehenden, der mit ihm denselben Rock trägt, der wie er ein Träger der Ehre ist, vom Dienste dispensiert.
Einige Regimentskameraden kannten Koeber noch von der Zeit, da sie mit ihm zusammen im Kadettencorps gewesen waren. Schon mit seinem zehnten Jahr war er dort eingetreten — sein Vater, ein pensionierter Oberst, hielt es für ganz selbstverständlich, daß sein Sohn denselben Beruf ergreife wie er — alle Koebers waren Offiziere gewesen und hatten für ihren obersten Kriegsherrn auf den Schlachtfeldern kämpfen, bluten und sterben dürfen. Gab es etwas schöneres? So wanderte auch der junge Koeber, fast noch ein Kind, ins Kadettencorps, um dort diejenigen Tugenden gleichsam eingeimpft zu erhalten, die den Offizier ausmachen: unwandelbare Liebe und Treue gegen den Kaiser, rastlosen Eifer und treueste Pflichterfüllung, nie schwankende und nie wankende Ehrenhaftigkeit in Wort und That. Als einziges Kind war Koeber zu Haus von der Mutter verzogen und verhätschelt worden, und selbst des Vaters gelegentliche Zornausbrüche über die „Weiber-Erziehung” hatten daran nichts zu ändern vermocht. So kam es, daß er sich zuerst im Corps sehr elend und verlassen fühlte, an Heimweh litt und schon in den ersten Tagen die Stunden bis zu den Ferien zählte. Vergebens waren die Worte der Lehrer und Erzieher, die Mitleid mit ihm fühlten, als sie sahen, wie unglücklich er war. Was ihre Worte aber nicht erreichten, das gelang der Kameradschaft — das Bewußtsein, gleiches Geschick mit vielen anderen zusammen zu tragen, gleiches Leid, gleiche Freuden zu teilen, das gemeinsame Band, das sie alle umschlang, ließen ihn von Tag zu Tag mit freudigeren Augen in die Zukunft schauen. Er lernte schon damals die Kameradschaft kennen und schätzen nach ihrem ganzen Wert, und er nahm sich vor, sie zu hegen und zu pflegen, soviel in seinen Kräften stünde. So kam es, daß er nicht nur in seiner Kompagnie, sondern bei allen, die ihn kennen lernten, sich der größten Beliebtheit erfreute.
Die Zeit ging dahin; an Beschäftigung fehlte es ihm nie. Er war ein fleißiger Schüler, doppelt fleißig, weil ihm das Lernen schwerer wurde als so vielen seiner Kameraden, und gar manchen Abend, wenn der Offizier vom Dienst den Schlafsaal revidiert hatte, um sich zu überzeugen, ob auch alles in den Betten sei, lag er noch stundenlang wach und sagte im Geiste das Pensum für den morgigen Tag auf. Und wenn er bei einer Stelle stockte, nahm er das Buch unter dem Kopfkissen hervor, erhob sich von seinem Lager und trat zu der niedrig brennenden Gasflamme, um die Regel oder den Lehrsatz zu überlesen. In Fleiß und Aufmerksamkeit hatte er stets die beste Zensur, während die Nummern in den anderen Fächern oft hinter den Erwartungen des Vaters zurückblieben. Die Selekta blieb ihm so verschlossen; nicht als Offizier, sondern als Portepeefähnrich trat er in der Armee ein, in demselben Regiment, in dem auch sein Vater seine militärische Laufbahn begonnen hatte, der eine schwere Verwundung auf dem Schlachtfeld von Gravelotte ein Ende bereitet hatte. Mit offenen Armen war der junge Koeber aufgenommen und herzlich bei dem ersten gemeinsamen Mittagessen begrüßt worden.
Da war es auch, wo er erfuhr, auf welche Art und Weise der Vater seinen Abschied erhalten hatte.
Es war bei einer Besichtigung gewesen, bei der sein Vater als Oberstleutnant und etatsmäßiger Stabsoffizier das Regiment vorgestellt hatte. Alles ging vorzüglich — da hörte er, wie der kommandierende General, der die Offiziere seines Armeecorps noch nicht kannte, da er erst seit kurzem seine Charge bekleidete und von einem anderen Corps hierher versetzt worden war, zu seiner Umgebung äußerte: „Der Oberstleutnant reitet ja aber ganz abscheulich: das ist ja ein miserabler Anblick.”
Der Tadel wurde so laut gesprochen. daß der, dem er galt, ihn hören mußte.
Dann kam die Kritik, und als der Oberstleutnant mit seinen berittenen Offizieren herangesprengt war, sprach Se. Excellenz: „Ich habe Sie, Herr Oberstleutnant, um Verzeihung zu bitten, daß ich mir vorhin ein Wort des Tadels über Sie erlaubte. Von meinem Adjutanten ist mir inzwischen gemeldet worden, wie heldenmütig Sie auf dem Schlachtfeld gekämpft haben, wie Sie verwundet weiterstürmten, bis mehrere Kugeln Ihren Körper beinahe zerfetzten! Ich wäre unwürdig des Rockes, den ich trage, wenn ich Ihnen nicht meine Bewunderung und Hochachtung aussprechen wollte, daß Sie Ihre großen körperlichen Schmerzen, die das Reiten Ihnen verursacht, mit solcher eisernen Energie überwinden, um Ihren Untergebenen auch hierin ein leuchtendes Vorbild zu sein. Ich werde Sr. Majestät, unserem allergnädigsten Herrn, über Sie Meldung erstatten.”
Wenige Tage später war sein Vater unter Vorpatentierung von mehr als einem Jahr zum Oberst und Regimentskommandeur befördert worden — dennoch erbat er seinen Abschied, der ihm erst auf abermaliges Ersuchen seinerseits huldvollst gewährt wurde.
Nie hatte sein Vater ihm davon erzählt, denn treueste Pflichterfüllung und Gewissenhaftigkeit bis zum letzten Atemzug war in seinen Augen etwas Selbstverständliches, über das man kein Wort zu verlieren brauchte.
Und der Sohn gelobte sich, seines Vaters würdig zu werden.
Wie im Corps erfreute er sich auch im Regiment bald allseitiger Beliebtheit; er war gewissenhaft und tüchtig im Dienst, fleißig und strebsam, nach Kräften bemüht, sein Wissen und Können stets zu vervollkommnen, ehrgeizig, ohne dabei ein Streber zu sein, ein lustiger, heiterer Gesellschafter, der trotz seiner nicht hohen Zulage alles mitmachte und niemals einen Pfennig Schulden besaß, ein liebenswürdiger, überall gern gesehener Kamerad.
Vor ungefähr fünf Jahren, als er Premierleutnant geworden war, hatte er geheiratet, und seine Frau und zwei Knaben, ein Zwillingspaar, bildeten für ihn den Inbegriff aller Seligkeit, und je länger er verheiratet war, desto zärtlicher wurde er als Gatte, desto liebevoller wurde er als Vater; denn, so pflegte er zu sagen, das wahrhaft Gute lernt man erst mit der Zeit kennen und schätzen. Ihm fehlte nichts zu seinem Glück, und obgleich es in seinem Hause nur sehr einfach zuging, da er, wie er selbst lachend sagte, in der Wahl seines schwiegerväterlichen Geldbeutels sehr unvorsichtig gewesen war, verkehrten die Kameraden nirgends so gern wie bei ihm.
Koeber war bald zum Hauptmann dran, er war der älteste Leutnant im Regiment, und als solcher hatte er schon oft für beurlaubte oder erkrankte Kompagniechefs deren Kompagnie geführt. Er war ungefähr fünfzehn Jahre im Dienst, nie hatte er zu einer begründeten Klage Veranlassung gegeben, er war den jüngeren Kameraden stets ein leuchtendes Vorbild gewesen, an den sie sich wandten, wenn sie einen Rat brauchten.
Und nun war er vom Dienst dispensiert, weil er wissentlich eine falsche dienstliche Meldung erstattet hatte, weil er — mit anderen Worten — einen Vorgesetzten auf Befragen in dienstlichen Angelegenheiten belogen hatte!
„Von allen Vergehen ist Lügen das gemeinste. Wir sind alle keine Engel und können straucheln, zuweilen auch fallen, aber wer ein Unrecht begeht, muß auch den Mut haben, für dasselbe einzutreten. Wer es nicht thut, wer da leugnet und lügt, der ist feige; na, meine Herren, und was die Feigheit für uns ist, das brauche ich Ihnen wohl nicht erst zu sagen.”
So hatte er einmal gesprochen, als er die Leutnants zusammenberufen hatte, um einen jüngeren Kameraden zu ermahnen, und nun hatte er selbst gelogen, sich des gemeinsten Vergehens, wie er selbst es annnte, schuldig gemacht.
Bei einem Appell war es geschehen, wie sie von Zeit zu Zeit von den Regimentsbekleidungskommissionen angesetzt werden, damit diese sich von dem Zustand und der Beschaffenheit der teils in den Händen der Mannschaften, teils auf den Kompagniekammern befindlichen Garnituren überzeugen können. Es wurde die Besichtigung der vierten Garnitur befohlen, die sich bei der Kompagnie, die Koeber für einen Hauptmann führte, der seinen Abschied eingereicht hatte, und für den er zum Kompagniechef befördert werden sollte, in der denkbar schlechtesten Verfassung befand. Ueberall wurde die kurze, noch zur Verfügung stehende Zeit benutzt, um die Sachen möglichst gut in stand zu setzen. Zur befohlenen Zeit traten wenige Tage später die Mannschaften des Regiments auf dem Kasernenhof zum Appell an.
Als letzte Kompagnie wurden Koebers Leute besichtigt.
„Ich melde ganz gehorsamst hundertundzwanzig Mann in dem befohlenen Anzug zur Stelle.”
Der Herr Oberst legte dankend die Hand an die Mütze und schritt dann die Front ab. Verschiedentlich kam ein „Sehr gut — sehr gut” über seine Lippen, und dann berief er die Hauptleute zu sich.
„Meine Herren, was ich von den Anzügen der Leute gesehen habe, hat mich im großen und ganzen befriedigt; was ich auszusetzen hatte, habe ich den betreffenden Herren Kompagniechefs an Ort und Stelle gesagt. Ich erkenne an, daß die Kompagnien fleißig gearbeitet haben. Viel ist gethan, viel ist aber noch zu thun übrig. Besonders loben will ich Sie, Herr von Koeber; der Anzug ist bei Ihnen vorzüglich, mustergültig; ich wünschte, daß die Röcke bei allen Kompagnien in derselben tadellosen Verfassung wären; dann hätte ich mir manche tadelnde Bemerkung sparen können. Tadeln zu müssen, ist nie angenehm, meine Herren; das ist unangenehm für beide Teile, für Sie und für mich. Ich danke Ihnen sehr, meine Herren.”
Die Hauptleute waren entlassen, und Koeber, dessen Leute schon fortgetreten waren, schickte sich an, nach seiner nur wenige Minuten von der Kaserne entfernt liegenden Wohnung zu gehen, als er sich plötzlich angerufen hörte.
Er wandte sich um und sah einen Hauptmann, Herrn von Zastrow, auf sich zukommen, dessen Wohnung dicht neben der von Koebers lag.
„Wollen der Herr Hauptmann mit nach Haus gehen?” fragte Koeber.
„Vielleicht nachher,” gab dieser zur Antwort; „vorher aber möchte ich Sie etwas fragen, und zwar dienstlich, wie ich überhaupt jetzt dienstlich mit Ihnen spreche.”
Koeber nahm die Hacken zusammen und legte die Hand an die Mütze.
„Sie werden es ebgreifen” sprach Herr von Zastrow, „daß wir Hauptleute den uns ziemlich unverblümt ausgesprochenen Tadel des Herrn Obersten nicht mit besonderer Freude angehört haben, zumal der Vorwurf nach unserer Meinung ziemlich ungerecht war. Ich glaube — und ich spreche zugleich im Namen der anderen Herren —, daß Sie nicht ganz kameradschaftlich an uns gehandelt haben: waren es wirklich die Röcke der befohlenen Garnitur, die Ihre Leute angezogen hatten?”
„Zu Befehl, Herr Hauptmann.”
„Herr Leutnant von Koeber, ich frage Sie dienstlich als Ihr Vorgesetzter.”
„Zu Befehl, Herr Hauptmann.”
„Dann ist es mir unverständlich,” fuhr Herr von Zastrow fort; „ich habe, während Sie mit dem Kommandeur sich bei dem hintersten Gliede befanden, einige Röcke im ersten Gliede aufknöpfen lassen und in denselben den Stempel III., also den der besseren Garnitur, entdeckt.”
Herr von Koeber erbleichte ein wenig: „Davon ist mir nichts bekannt, Herr Hauptmann; vielleicht haben die Leute sich in der Eile vergriffen und den falschen Rock angezogen.”
„Schwerlich,” gab Herr von Zastrow zur Antwort. „Auf Befragen erielt ich die Antwort, es wäre den Leuten befohlen worden, den dritten Rock anzulegen — ich bitte Sie, sofort Recherchen anstellen zu wollen, wer diesen Befehl gegeben hat, und mir bis heute nachmittag um vier Uhr eine den Sachverhalt aufklärende Meldung zu schicken, die ich gleichzeitig mit meiner Meldung dem Regimentskommandeur zustellen kann.”
„Zu Befehl, Herr Hauptmann.”
„Dann danke ich Ihnen sehr.”
Damit war Koeber entlassen, und vergebens bemühte er sich, zu Hause angekommen, die Erregung, in der er sich befand, zu verbergen. Nicht wie sonst galt seine erste Frage, wenn er die Schwelle überschritten hatte, seinen Kindern, und nur flüchtig küßte er die Lippen seiner Frau, die sie ihm zum Willkommensgruß bot.
Aengstlich blickte sie zu ihm empor: „Aber Otto, was hast du nur heute?”
Aergerlich wandte er sich von ihr ab: „Was ich habe? Laß doch die dummen Fragen; du weißt doch, daß ich so etwas nicht liebe. Daß ich mich geärgert habe, kannst du dir wohl denken; das .worüber' geht dich nichts an; außerdem würdest du es nicht begreifen; was versteht ihr Frauen vom Dienst und von allem, was damit zusammenhängt.”
Er ging in sein Ankleidezimmer, um sich umzuziehen, und feuchten Auges blickte seine Frau ihm nach: unfreundlich hatte er noch nie mit ihr gesprochen; es war das erste Mal, daß er ihr nicht sein Herz ausgeschüttet hatte, ihr nicht sagte, was ihn bedrückte.
Schweigend saßen die Gatten sich bei Tisch gegenüber, und während er sonst seinen Kaffee in ihrer Gesellschaft zu trinken pflegte, stand er heute sofort auf, nachdem er den letzten Bissen gegessen hatte, und befahl, ihm den Kaffee in sein Zimmer zu bringen; er habe zu arbeiten und wünsche nicht gestört zu werden.
Er hatte sich an seinen Schreibtisch gesetzt, um die verlangte Meldung zu schreiben, aber eine Viertelstunde nach der andern war verstrichen, ehe er die passenden Worte fand.
Es galt, die Schuld zu verbergen, den Schuldigen zu schützen.
Und der Schuldige war er selbst.
Er selbst hatte den Befehl gegeben, die schlechten Röcke der befohlenen Garnitur gegen solche der nächstbesseren umzutauschen.
Was hatte ihn dazu veranlaßt?
Er wußte, wie sehr der Kommandeur auf gute Anzüge hielt, er wollte, dicht vor der Beförderung stehend, einem Tadel, noch dazu einem unverdienten, entgehen, denn er hatte die Sachen in dem Zustand, in dem sie sich befanden, übernommen — die Verantwortung dafür traf nicht ihn, sondern seinen Vorgänger.
Es war eine Thorheit, mehr als das, es war eine fast kindische Dummheit, die er begangen hatte, und deren Folgen er nun tragen mußte. Darüber, worin diese bestehen würde, täuschte er sich nicht. Nun galt es, dieselben abzuwehren, seine Schuld als einen Irrtum, ein Versehen hinzustellen.
Er durfte seine Schuld nicht eingestehen — das war es auch gewesen, was ihn veranlaßt hatte, dem Hauptmann nicht die Wahrheit zu sagen.
Und doch wäre alles gut gewesen, wenn er zu Herrn von Zastrow gesprochen hätte: „Herr Hauptmann, ich habe gefehlt; die jedem Soldaten innewohnende Furcht, bei einer Besichtigung, mag sie sein, welcher Art sie wolle, schlecht abzuschneiden, hat mich veranlaßt, gegen den Befehl zu handeln.”
Ungeschehen wäre die That durch dies Bekenntnis nicht geworden, aber Herr von Zastrow würde sich damit begnügt haben, den jüngeren Kameraden ernsthaft zur Rede zu stellen, und ihn veranlaßt haben, die anderen Herren Kompagniechefs um Verzeihung zu bitten — damit wäre die Sache für die Kameraden aus der Welt gewesen; schwerlich würden sie darauf bestanden haben, daß die Angelegenheit dem Kommandeur mitgeteilt werden müsse.
Einen Augenblick dachte Koeber daran, noch jetzt seine Schuld offen und ehrlich zu bekennen, aber gleich verwarf er den Gedanken wieder: wenn er gestand, so mußte er entweder die Folgen tragen, oder er mußte dieselben dadurch abzuwenden suchen, daß er jetzt noch die seinetwegen Getadelten um Verzeihung bat. Er hatte gesehen, wie Herr von Zastrow, nachdem er ihn entlassen, zu den Hauptleuten getreten war, wahrscheinlich um ihnen den Erfolg seiner Unterredung mitzuteilen. Er glaubte, die Urteile zu kennen, die über ihn gefällt worden waren; die Stimmung gegen ihn würde jetzt nicht die beste sein; es war ungewiß, ob er jetzt noch Verzeihung erhalten würde — zu bitten, ist stets eine Demütigung, doppelt, wenn man der Gefahr einer Ablehnung ausgesetzt ist. Sein Stolz lehnte sich dagegen auf.
Und wenn er die Folgen auf sich nahm? Er wurde heiß und kalt bei dem Gedanken — nicht seinetwegen, aber er hatte Weib und Kinder, von denen jedes Leid und Ungemach fernzuhalten von jeher sein ganzes Streben gewesen war.
Stundenlang saß er an seinem Schreibtisch und grübelte und sann . . .
„Herr Hauptmann von Zastrow läßt den Herrn Leutnant um die Meldung bitten.”
Er wandte sich um — sein Bursche, dessen Eintritt er überhört hatte, stand hinter ihm.
Er sah nach der Uhr: schon fünf — um eine Stunde hatte er die ihm gestellte Frist überschritten.
Er ergriff die Feder und schrieb nach kurzem Besinnen: „Ich vermag mir den Vorfall nicht zu erklären; es scheint ein Versehen oder ein Mißverständnis einer von mir gegebenen Anordnung vorzuliegen.”
Er wußte, daß die Angelegenheit nicht damit erledigt wäre, nicht erledigt sein könnte, aber er hoffte, in einer mündlichen Unterredung mit dem Kommandeur den Vorfall als harmlos hinstellen zu können, sich aus der Affaire herauszuziehen.
„Vom Dienst dispensiert.”
Das war die Antwort gewesen auf seine Meldung — was er auszudenken nicht gewagt hatte, war eingetreten. Wer würde über ihn urteilen, das Kriegsgericht oder das Ehrengericht, oder würden gar beide ihr Urteil über ihn fällen?
Mehrere Tage vergingen, ohne daß er Gewißheit darüber erhielt — zu der Unruhe, die in ihm wohnte, gesellte sich noch das Empfinden darüber, daß niemand der Kameraden sich bei ihm sehen ließ, daß keiner ein Wort der Teilnahme für ihn hatte.
Teilnahme? Durfte er Anspruch darauf erheben, da er sein Geschick selbst verschuldet, da er sich ein Vergehen hatte zu schulden kommen lassen, das selbst bei dem gemeinen Manne strenge bestraft wird?
Endlich, nach fast acht Tagen, erhielt er ein Schreiben des Regiments. Rasch erbrach er das Siegel, und ein „Gott sei Dank!” entrang sich seinen Lippen, als er in der Einleitungsverfügung die Worte las: „In der kriegsgerichtlichen Untersuchung —”
Kriegsgericht, nicht Ehrengericht — nun konnte doch noch alles gut werden — eine Festungsstrafe von kurzer Dauer, vielleicht eine Versetzung in ein anderes Regiment würde ihn treffen, aber er blieb Offizier.
So hoffte er.
Am folgenden Tag begannen die Verhöre, die bei der einfachen Sachlage schnell zu Ende geführt wurden, und schon nach acht Tagen trat das Kriegsgericht über ihn zusammen.
Koeber hatte persönlich vor demselben zu erscheinen gewünscht, aber noch am letzten Morgen schickte er eine Meldung, daß er auf persönliches Erscheinen verzichte; er konnte es nicht über sich gewinnen, seinen Kameraden, mit denen er so viele frohe, heitere Stunden zusammen verlebt hatte, die in seinem Hause ein- und ausgegangen waren, nun als Angeklagter gegenüberzutreten. Was er zu sagen hatte, war in dem Protokoll niedergeschrieben; sein bester Freund hatte sich freiwillig erboten, für ihn die Verteidigung zu führen.
Ruhig sah er dem Urteil entgegen; er wußte, die Kameraden würden richten, wie die Ehre und die Pflicht es ihnen geboten.
Jedes über einen Offizier gefällte Urteil bedarf der Bestätigung des höchsten Kriegsherrn — so vergingen Wochen, bis Koeber auf das Regimentsbureau beschieden wurde, um die Allerhöchste Kabinettsordre zu vernehmen, die dahin lautete, daß Se. Majestät das Urteil des Kriegsgerichts bestätige, und daß der Premierleutnant von Koeber mit dem Abschied zu bestrafen sei.
„Ich danke Ihnen, Herr von Koeber.”
Er war entlassen, er hörte die Worte, ohne sie zu verstehen, er empfand es nicht einmal, daß der Kommandeur nicht wie sonst „Herr Leutnant von Koeber” zu ihm sagte, nicht zu ihm sagen durfte, da er dem Stande nicht mehr angehörte. Unbeweglich stand Koeber auf seinem Platz, und eine solche Verzweiflung sprach aus seinen Zügen, daß der Oberst zu ihm trat und ihm teilnehmend seine Rechte auf die Schulter legte:
„Fassen Sie sich, Herr von Koeber — das Urteil erscheint Ihnen hart, zu hart, und doch ist es milde: die Pension ist Ihnen gelassen; hätte das Ehrengericht über Sie gesprochen, so wäre Ihnen auch diese abgesprochen worden. Auch den Titel haben Sie behalten — wenn Sie auch nie wieder im bunten Rock Ihrem König dienen können, so sind Sie doch nicht für unwürdig befunden, das ,Leutnant a.D' zu führen. Sie haben eine sichere Existenz leichtsinnig verscherzt — anders kann ich das nicht bezeichnen; sich nun eine neue Existenz zu gründen, muß nun Ihre nächste Sorge sein. Dunkel liegt die Zukunft vor Ihnen — versuchen Sie mit starker Hand die Wolken, die sich Ihnen in den Weg stellen, zu verscheuchen — denken Sie an Weib und Kind; für die zu sorgen und zu arbeiten, muß Ihre Aufgabe sein. Möchte Ihnen gelingen, was immer Sie ergreifen — unsere besten Wünsche begleiten Sie.”
Wie ein Trunkener wankte er nach Haus — was sollte nun werden?
Herzzerreißend war der Schmerz, mit dem seine Frau die Kunde vernahm, aber edel und großherzig, wie Frau Elsa von Haus aus war, dachte sie nicht an sich und an ihre Kinder, die nun mit ihnen der Not preisgegeben waren, sondern nur an den über alles geliebten Mann, der leichtsinnig seine Existenz aufs Spiel gesetzt hatte und dafür nun so schwer büßen mußte.
Schwer büßte er seine Schuld, wie schwer, das empfand er am Abend, als er seine Uniform auszog, um sie als aktiver Offizier nie wieder anzuziehen. Da zog sie noch einmal an seinem Geiste vorbei, die ganze schöne, wilde, lustige Leutnantszeit, alle fröhlichen Stunden, die er im Kreise seiner Kameraden verlebt hatte, alles Glück, alles Schöne, das ihm während seiner Dienstzeit zu teil geworden war. Das Traurige, das Unangenehme, das auch ihm nicht erspart geblieben war, war vergessen; nur das Angenehme lebte in seiner Erinnerung weiter — und nun war es aus — vorbei für immer.
Was war er nun? Ein Leutnant a. D. — ein Nichts — mit dem Kleid hatte er so vieles ausgezogen — die angesehene Stellung, die Achtung seiner Standesgenossen, Beschäftigung und Thätigkeit.
Was nun? „Eine neue Existenz zu gründen, muß Ihre erste Sorge sein,” hatte der Kommandeur zu ihm gesprochen — ach, wie war das schwer!
Von Kameraden, die wegen leichtsinniger Streiche um die Ecke gegangen waren, wußte er, mit welchem Mißtrauen man überall verabschiedeten Leutnants entgegentritt, und wie stets die erste Frage dem Grunde der Verabschiedung gelte. Wäre er freiwillig gegangen, oder hätte er wenigstens ein großes Vermögen besessen, das ihm erlaubt hätte, eine Stellung zu suchen, anstatt um eine solche bitten zu müssen, wäre er Junggeselle gewesen, der nur für sich allein zu sorgen brauchte, dann hätte er der Zukunft mit weit mehr Ruhe entgegensehen können.
Seine erste Sorge mußte sein, die Garnison zu verlassen. Unmöglich konnte er in der Stadt bleiben, in der ihn alle kannten; trotz der in militärischen Dingen waltenden Geheimnisthuerei würde es doch nur zu bald bekannt werden, warum er den Dienst quittiert hatte, und er wollte sich und die Seinen dem unausbleiblichen Gerede, den verwunderten Blicken seiner Mitbürger nicht aussetzen. Er konnte nicht fernerhin in der Gesellschaft verkehren, die er als aktiver Offizier besucht hatte, er mußte vermeiden, mit seinen früheren Kameraden zusammenzutreffen, denn wenn auch der „Leutnant a. D.” für gewöhnlich dem aktiven Kameraden gesellschaftlich völlig gleichsteht, so fühlte er es selbst doch zu gut, daß er nur durch die besondere Milde, die man bei seiner Verurteilung hatte walten lassen, dieses Titels nicht verlustig gegangen war — er betrachtete den ihm gebliebenen Titel als ein Gnadengeschenk, dessen er im Grunde nicht würdig war.
Schon nach wenigen Tagen begab er sich mit den Seinen auf Reisen. Zunächst suchte er seinen Vater auf; aber der im Dienst und in Ehren grau gewordene Oberst fühlte kein Mitleid mit seinem Kinde, das die einfachsten Gesetze der Ehre und Pflicht nicht zu wahren gewußt hatte. Es kam schon in der ersten Stunde zu einer erregten Aussprache zwischen Vater und Sohn, und noch an demselben Abend verließ er das elterliche Haus wieder, als alles Bitten und alles Flehen, den Vater zur Milde zu stimmen, sich als vergeblich erwiesen hatte. Weib und Kind ließ er zurück — er wollte suchen, eine Stellung zu finden, und erst dann, wenn er sie gefunden, wieder mit den Srinen zusammenkommen.
Und nun begann das Anklopfen an verschlossenen Thüren. Er wandte sich an seine Freunde, mit der Bitte, ihm behilflich zu sein, sich eine neue Existenz gründen zu können, er bat nicht um Geld, er bat um Empfehlungen, um Arbeit und Beschäftigung.
„Ja, lieber Freund, wenn Sie nicht wegen einer solchen dummen Geschichte den Abschied bekommen hätten, ließe sich darüber ja reden, aber so —”
Stillschweigen und Achselzucken war stets das Ende der Rede — keiner glaubte ihn mit gutem Gewissen empfehlen zu können, denn wenn er nicht einmal als Offizier seine Pflicht gethan hatte, wer garantierte dafür, daß er nicht in dem neuen Berufe sich eine neue Dummheit zu schulden kommen lassen würde?
Er selbst? Ja, das wäre leicht gesagt, aber durch sein bisheriges Leben habe er gerade nicht bewiesen, daß man viel Vertrauen in ihn setzen könne; gewiß, er könne einem ja leid thun, aber, aber —
Ach, dies Wort „aber” — es ist oft viel grausamer und verletzender als lange, lange Reden, und es vernichtet mit einem Schlage so oft alle Hoffnungen.
Er wandte sich an alle möglihen Gesellschaften, in der Hoffnung, dort irgendwie ein Unterkommen zu finden. Man hörte sein Anliegen an, erkundigte sich nach seinem früheren Beruf und versprach, Erkundigungen über ihn einziehen zu wollen.
Und das Resultat war stets dasselbe: man bedauerte, für seine Verwendung keine Gelegenheit zu haben.
Er war nicht ehrlos, aber er hatte einen Flecken auf der Ehre, jenen Flecken, den nichts wegzulöschen vermag als ein in den Augen der Gesellschaft ehrenwerter Tod.
War es Feigheit, das ihn hinderte, die Waffe in die Hand zu nehmen und sich eine Kugel durch den Kopf zu jagen?
Nie und nimmermehr, aber er dachte an Weib und Kind.
Sein Tod wäre für sie eine pekuniäre Hilfe gewesen — ein Esser weniger, wie der Volksmund derb sagt — er war ihnen jetzt eine Last.
Aber er wollte den Seinen nicht die Schmach anthun, daß sie einen Selbstmörder zum Gatten, zum Vater hatten.
Tage, Wochen, Monate gingen dahin, und so mutig und tapfer sein Weib auch das harte Los trug, sie konnte es doch nicht verhindern, daß aus ihren Briefen Angst und Sorge um die Zukunft zu sprechen begannen. Für den Augenblick war gesorgt: sie weilte noch immer, da sie ihre eigenen Eltern vor mehreren Jahren durch den Tod verloren hatte und ohne nähere Verwandte war, in dem Hause ihres Schwiegervaters.
„Was soll werden, wenn er dereinst die Augen für immer geschlossen hat?” schrieb sie einmal. „Das Erbe, das Dir zustand, haben wir erhalten an dem Tage, da wir den Konsens einreichten; auch ich habe von niemand etwas mehr zu erwarten. Wir haben immer sparsam gelebt, Haus gehalten mit dem wenigen, das wir besaßen, aber wir haben es doch nicht vermeiden können, das Kapital anzugreifen, in der Hoffnung, daß bei Deiner Beförderung die Erhöhung des Gehaltes den Ausfall der Zinsen decken würde. Das Dir bewilligte einmonatliche Gnadengehalt ist verausgabt; nun haben wir nur die kleine Pension, die keine zweihundert Thaler im Jahr ausmacht, und die geringen Zinsen, die kleiner werden, je mehr wir das Kapital werden angreifen müssen. Und wir werden es müssen; schon jetzt sehe ich, daß ich nicht auskommen kann, wenn ich mein Versprechen, Deinem Vater, der sich auch einschränken muß, Pension zu zahlen, halten will. Aber ich würde alles ruhig und freudigen Mutes ertragen, wenn nur die leiseste Hoffnung wäre, daß es jemals besser werden würde.
Lange, lange, viele Stunden sprach ich gestern mit Deinem Vater über Dich. Mit mir ist er verzweifelt über das Geschick, das uns betroffen.
,Vater, was wird aus uns werden?' fragte ich ihn, wie schon so oft, und immer gab er dieselbe Antwort: ,Das weiß nur Gott — an den Bettelstab werdet ihr kommen, du und deine Kinder. Ihr thut mir leid, aber der, der seine Stellung mit Füßen getreten, der sie künstlich untergraben hat, der —'
Ach, verzeih, ich wollte Dir die harten Worte nicht schreiben, die Dein Vater in seiner immer noch unversöhnlichen Stimmung gegen Dich gebrauchte.
,Und kann uns denn niemand helfen auf der ganzen weiten Welt?' fragte ich ihn und faßte flehend, Trost suchend seine Hände.
Da sah er mich mitleidig an: ,Kleine, du thust mir leid; wie wenig kennst du die Welt! Nicht alle Menschen, die auf dieser Erde herumlaufen, sind ehrenwerte Menschen, aber wenn sie es auch nicht sind, so wollen sie es zum wenigsten scheinen, und darum hüten sie sich der Welt gegenüber, sich offenkundig auch nur mit einem Schein des Unehrenhaften zu umgeben. So wird auch dein Mann vergebens an alle Thüren pochen, jahraus, jahrein — man fürchtet sich, daß die Flecken auf seiner Ehre die eigene Ehre beschmutzen könnte.'
,Vater!' rief ich, ,ist es denn nicht menschenmöglich, daß Geschehenes ungeschehen wird, daß mein Mann, daß mein Otto jemals wieder voll und ganz ein Ehrenmann wird? In meinen Augen es zu sein hat er nie aufgehört, aber die Welt, sie urteilt so streng, so hart, so unerbittlich — kann niemand ihm seine Ehre, die er befleckt, rein und makellos zurückgeben?'
Lange, lange schwieg Dein Vater, dann sagte er: ,Niemand, mein Kind, niemand, und doch — ein einziger vermöchte es, ein einziger auf der ganzen weiten Welt.'
,Vater!' rief ich, ,sage mir, wer dieser einzige ist — ich will zu ihm gehen, seine Kniee umfassen und ihn bitten, nein, anflehen für Dich, für mich, für unsere Kinder, für uns alle; sag mir, wer es ist, der alles Leid zu beseitigen vermag, sag, wer ist es?'
Da zeigte Dein alter Vater mit der Rechten auf das große Kaiserbild, das unseren jugendlichen, thatkräftigen Herrscher, streng und ernst, aber zugleich gütig und milde, darstellt.
,Der Kaiser,' entrang es sich meinen Lippen, und fest stand bei mir der Entschluß, mich an ihn zu wenden, ihn für Dich anzuflehen, daß er Dir Deine Schuld vergiebt, daß er Dir seine königliche Gnade zu teil werden läßt!
Das wollte ich thun, aber der Vater hielt mich zurück: ,Nie und nimmermehr!' rief er mir zu, ,solange du noch in meinem Hause bist. Wer unrecht thut, muß die Folgen tragen — um Gnade bitten ist Feigheit.'
Und so streng, so ernst klang des Vaters Wort, daß ich nicht den Mut in mir fühlte, gegen seinen Willen zu handeln — möchte der Himmel Dir und uns allen gnädig sein, daß das Glück bald wieder bei uns einkehrt.”
Und nach langen, langen Wochen schien das Glück sich ihm wieder zuwenden zu wollen: es gelang ihm, auf dem Gute eines Großgrundbesitzers eine Stellung zu erhalten, in der er hauptsächlich den kränklichen Besitzer bei geschäftlichen Angelegenheiten vertreten, auch sonst für ihn repräsentieren sollte; sein Name allein war es wohl, der ihm zu diesem Amte verholfen hatte.
Er reiste voran, um alles für die Ankunft der Seinen vorzubereiten und sich seinem neuen Herrn vorzustellen; er fühlte sich zum erstenmal wieder glücklich seit dem Tage, an dem er den bunten Rock ausgezogen hatte.
Auf der kleinen Station erwartete ihn ein eleganter, mit zwei leichten Juckern bespannter Jagdwagen, und in schnellem Tempo legte man die Entfernung bis zu dem Gute zurück. Freundlich wurde er willkommen geheißen. und er fand Gefallen an dem alten Herrn, der ihm mit großer Herzlichkeit entgegentrat und ihn, nachdem noch einiges Geschäftliche erledigt war, zu seiner Gemahlin hinüberführte, um dieser den neuen Hausbewohner vorzustellen.
Bald ging man zu Tisch, und an der Mahlzeit nahm noch ein zum Besuch weilender Neffe des Hausherrn, ein Leutnant von Unstrut, teil, der bei einem vornehmen Kavallerieregiment stand und jetzt zur Teilnahme an den Jagden verschiedene Güter, wie er sich ausdrückte, „abgraste”.
Die Unterhaltung war lebhaft und animiert; man erzählte Koeber von den Nachbarn, die er ja nun auch bald kennen lernen würde, bis man plötzlich bei dem Kapitel der gemeinsamen Bekannten ankam.
„Sagen Sie mal, Herr von Koeber,” fragte da plötzlich der Neffe des Hausherrn, „sind Sie verwandt mit dem früheren Leutnant von Koeber, der da im vorigen Jahr so plötzlich seinen Abschied erhielt — man erzählte sich damals ja unglaubliche Geschichten; wissen Sie etwas Näheres darüber?”
Dieser taktlosen Frage gegenüber empfand Koeber zum erstenmal das Gefühl, in Sold und Lohn zu stehen. Eine scharfe Antwort lag ihm auf der Zunge; hätte er die Worte ausgesprochen, die sich ihm aufdrängten, so wäre seines Bleibens im Hause nicht länger gewesen, denn in dem Neffen hätte er den Hausherrn und dessen Gattin tödlich beleidigt.
So sagte er nur: „Ich kenne das Vergehen des Herrn von Koeber sehr genau — er hat schwer gefehlt, aber, glauben Sie mir, er hat auch schwer dafür gebüßt.”
„Ja, ich habe auch so was gehört,” klang es zurück; „mich wunderts nur, daß sie ihn jetzt so plötzlich wieder eingestellt haben; ist ja zwar nicht jedermanns Sache, ,Kleiderfritze' zu werden, aber es ist doch immer schließlich besser als gar nichts; der Mensch ist doch wenigstens rehablitiert.”
Starr, sprachlos saß Koeber da und sah den Sprecher mit solchen großen, verwunderten Augen an, daß dieser hinzufügte:
„Na ja, da müssen Sie mir doch schließlich recht geben — was hat denn unsereiner schließlich auch vom Leben, wenn er einen Knacks an seiner Ehre hat, na, und wenn er — ja, aber, ich verstehe Sie wirklich nicht, das müssen Sie aber doch zugeben —”
Koeber war aufgesprungen und trat auf den Sprecher zu: „Herr Leutnant, die Sache ist zu ernst — woher wissen Sie, daß der Koeber wieder eingestellt ist, und daß das derselbe ist, der seinerzeit den Abschied bekam?”
„Aber ich verstehe Sie wirklich nicht,” entgegnete der Leutnant, „ich vermag mir Ihr Benehmen nicht zu deuten — woher ich meine Weisheit habe? Aus der Zeitung, die das neueste Militär-Wochenblatt abdruckt. Heute morgen habe ich es erst gelesen; warten Sie, ich glaube sogar, ich habe die Zeitung eingeteckt.”
Er griff in die Tasche, und wenige Minuten später las Koeber:
„v.Koeber, zuletzt Premierleutnant im x-ten Infanterieregiment, als Premierleutnant beim Corpsbekleidungsamt des y-ten Armeecorps wieder eingestellt.”
Er starrte auf das Papier, er konnte das Unfaßbare nicht begreifen — wie war es möglich, wie war das alles geschehen — hatte sein Weib, des Vaters Zorn nicht achtend, doch des Kaisers Gnade angefleht, und hatte der Kaiser ihm gegenüber von dem schönsten Recht der Fürsten, Gnade üben zu können, Gebrauch gemacht?
Und plötzlich durchdrang ihn neuer Lebensmut, neue Hoffnung, er fühlte sich wie neugeboren, rosig lag das Leben vor ihm, Arbeit und Thätigkeit harrten seiner, er hatte wieder erlangt, was er verloren, weggewischt für alle Zeit war der Flecken von seiner Ehre — er war rehabilitiert.
„Provinciale Drentsche en Asser courant” vom 31.7.1907 bis 6.8.1907: