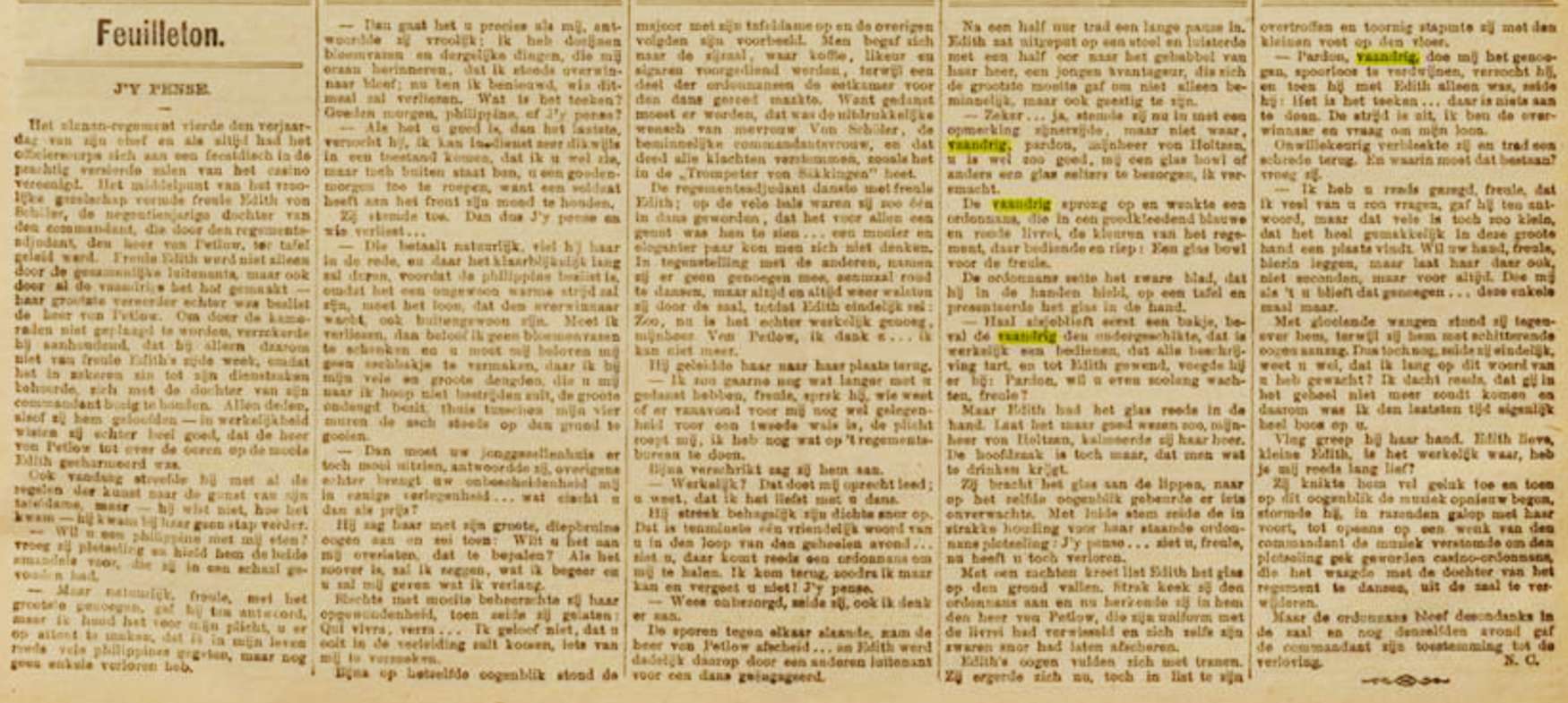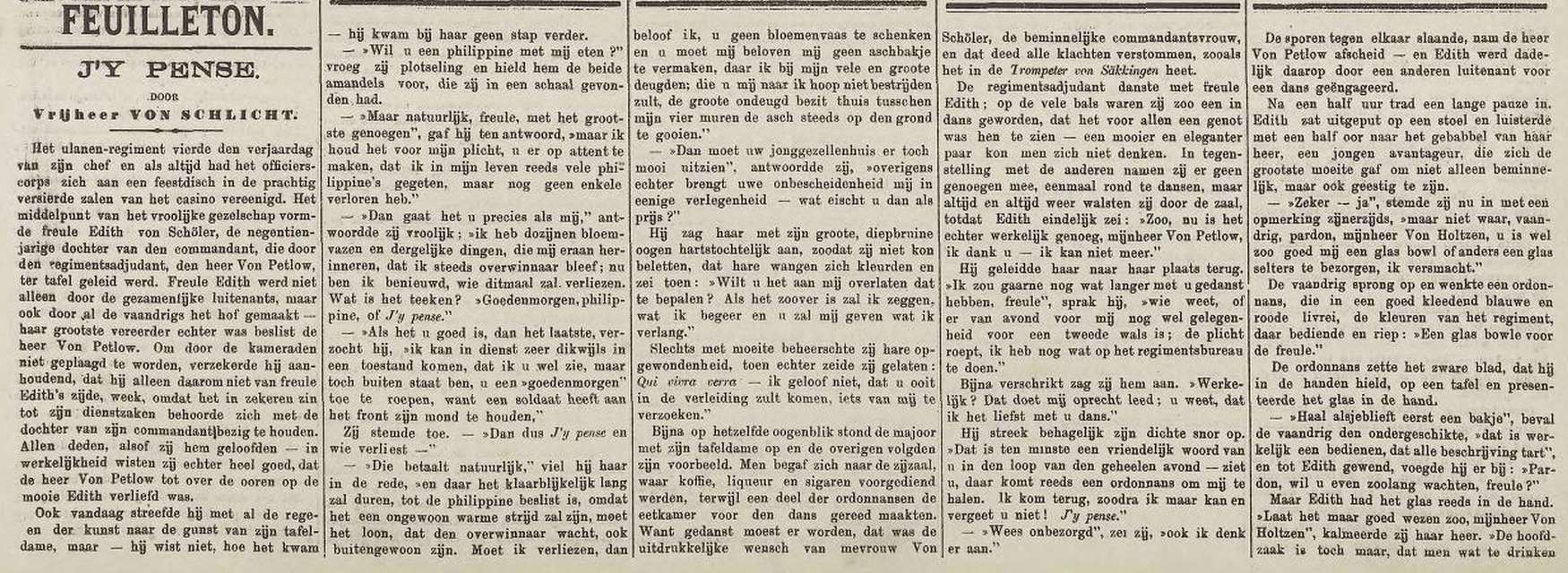
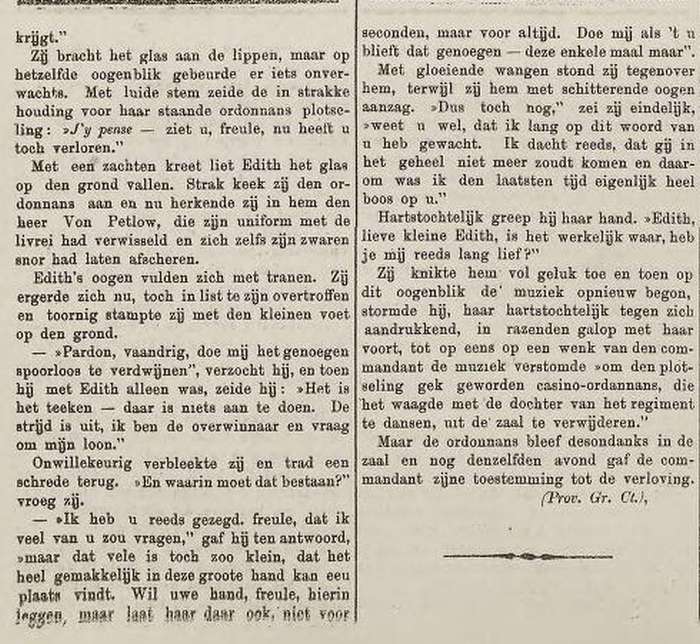
Humoreske von Frhrn. v. Schlicht.
in: „Kieler Zeitung” vom 5.1.1901,
in: „Middelburgsche courant” vom 06-02-1901,
in: „Die Drau” vom 5.3.1901,
in: „Ohligser Anzeiger” vom 20.7.1901,
in: Illustrierte Unterhaltungsbeilage „Zeitbilder” 1902 Nr. 309,
in: „Bataviaasch nieuwsblad” vom 30.9.1901 (unter dem Titel „De Philippine”)
in: „Illustriertes Salonblatt”, 27.Okt. 1901, III.Jahrgang, Nr. 111, S. 703-704,
in: „De Sumatra post” vom 29.10.1901 ( auch unter dem Titel „De Philippine”),
in: „Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant” vom 20.7.1903 und
in: „Zurück — marsch, marsch!”.
Das Ulanenregiment feierte den Geburtstag seines hohen Chefs, und wie immer hatte sich das Offizierskorps mit den Damen zu einem Festessen in den glänzend geschmückten Räumen des Kasinos vereinigt. An der äußersten rechten Ecke der hufeisenförmig gedeckten Tafel ging es besonders lustig zu, denn dort saß die Jugend, sowohl die männliche wie die weibliche, und amüsierte sich herrlich. Den Mittelpunkt der lustigen Gesellschaft bildete Fräulein Edith von Schöler, die neunzehnjährige Tochter des Kommandeurs, die von dem Regimentsadjutanten, Herrn von Petlow, zu Tisch geführt wurde. Fräulein Edith wurde nicht nur von sämtlichen Leutnants, sondern auch von sämtlichen Fähnrichen bekourt — ihr größter Verehrer aber war entschieden Herr von Petlow. Um von den Kameraden nicht geneckt zu werden, versicherte er beständig, er weiche nur deshalb nicht von Fräulein Ediths Seite, weil es gewissermaßen zu seinen Dienstobliegenheiten gehöre, sich um die Tochter seines Kommandeurs zu kümmern. Alle thaten, als wenn sie ihm glaubten — in Wirklichkeit aber wußten sie ganz genau, daß Herr von Petlow, wenn auch nicht gerade über beide Ohren, so doch ganz gewiß bis an beide Ohren in die schöne Edith verliebt sei.
Auch heute bewarb er sich nach allen Regeln der Kunst um die Gunst seiner Tischdame, aber er wußte nicht, woran das lag, er kam bei ihr keinen Schritt weiter — im Gegenteil, es kam ihm zuweilen so vor, als hätte sie ihn in den ersten Wochen und Monaten ihrer Bekanntschaft freundlicher behandelt als jetzt. Auch jetzt war sie fast kühl gegen ihn, und als er die Frage an sie richtete, ob er hoffen dürfe, ihr morgen auf dem Spazierritt zu begegnen, that sie, als hätte sie seine Worte nicht gehört.
„Wollen Sie ein Vielliebchen mit mir essen?” fragte sie plötzlich und hielt ihm die beiden Mandeln hin, die sie in einer Schale gefunden hatte.
Aergerlich biß er sich auf die Lippen: „Auf einen Korb mehr oder weniger kommt es ja schließlich nicht an,” tröstete er sich. Dann nahm er die Mandel, die sie ihm bot.
„Aber selbstverständlich, gnädiges Fräulein, mit dem größten Vergnügen,” gab er zur Antwort, „allerdings halte ich es für meine Pflicht, Sie darauf aufmerksam zu machen, daß ich in meinem Leben schon viele Vielliebchen gegessen, aber noch nicht ein einziges verloren habe.”
„Dann geht es Ihnen genau so wie mir,” erwiderte sie lustig, „ich habe Dutzende von Blumenvasen und derartigen Dingen, die mich daran erinnern, daß ich stets Sieger blieb, da bin ich begierig, wer dieses Mal verlieren wird.”
„Ich nicht,” erwiderte er.
„Und ich auch nicht,” entgegnete sie ihrerseits; „nun, die Zukunft wird ja lehren, wer Recht hat. Was gilt? Guten Morgen, Vielliebchen, oder J'y pense.”
„Wenn es Ihnen recht ist, das letztere,” bat er, „ich kann dienstlich sehr oft in die Lage kommen, daß ich Sie zwar sehe, aber doch außer Stande bin, Ihnen ein „Guten Morgen” zuzurufen, denn in der Front hat ein Jeder den Mund zu halten.”
Sie stimmte ihm bei. „Dann also J'y pense, und wer verliert —”
„Der bezahlt natürlich,” unterbrach er sie, „und da es voraussichtlich lange dauern wird, bis das Vielliebchen entschieden ist, da es ein ungewöhnlich heißer Kampf sein wird, muß der Lohn, der dem Sieger winkt, auch ein ungewöhnlicher sein. Sollte ich verlieren, so verspreche ich, Ihnen keine Blumenvase zu schenken, und Sie müssen mir versprechen, mir keinen Aschenbecher zu dedizieren, zumal ich bei meinen vielen und großen Tugenden, die Sie mir hoffentlich nicht abstreiten werden, die große Unart besitze, daheim in meinen vier Wänden die Asche stets auf die Erde zu werfen.”
„Da muß Ihr Junggesellenheim ja schön aussehen,” erwiderte sie, „im Uebrigen aber setzt mich Ihre Unbescheidenheit in einige Verlegenheit — was fordern Sie denn als Preis?”
Er sah sie mit seinen großen, tiefbraunen Augen leidenschaftlich an, sodaß sie es nicht verhindern konnte, daß ihre Wangen sich röteten, dann sagte er: „Wollen Sie das mir zu bestimmen überlassen? Wenn es soweit ist, werde ich schon sagen, was ich begehre, und Sie werden mir geben, was ich verlnage.”
Nur mühsam bekämpfte sie ihe Erregung, dann aber sagte sie gelassen: „Qui vivra, verra — ich glaube nicht, daß Sie jemals in Versuchung kommen werden, etwas von mir zu erbitten, und ich wüßte auch nicht, was Sie von mir groß fordern könnten. Mein Taschengeld ist nur knapp bemessen und Sie wissen, Schulden zu machen, ist allen Militärpersonen, zu denen ja auch ich gewissermaßen gehöre, verboten!”
„Leider sind aber sehr viele Gesetze nur vorhanden, damit sie überschritten werden,” gab er zur Antwort; „nur noch eine Frage, ehe der Kampf beginnt: Ist jedes Mittel erlaubt? Darf man List und Tücke, Lüge und Heuchelei anwenden, um den Sieg davonzutragen?”
Einen Augenblick zögerte sie, dann sagte sie: „Wenn Sie sich zu schwach fühlen, im ehrlichen Kampf zu siegen, soll mir auch das andere Recht sein. Also auf in den Kampf, Torero.”
Und der Kampf begann, er war der Angreifende, beständig bot er ihr etwas an, fortwährend reichte er ihr etwas, und sie hatte nichts anderes zu thun, als fortwährend „J'y pense” zu sagen.
„Nun lassen Sie es aber gut sein,” bat Edith schließlich, „auf eine so einfache Art fangen Sie mich doch nicht, da müssen Sie es schon anders versuchen.”
„Wie Ihr befehlt, Majestät, zu dienen sind wir da,” zitierte er lustig das alte Wort, „aber zu Ihrer Freude kann ich Ihnen mitteilen, daß höhere Gewalten dafür Sorge tragen, daß Sie vor mir Ruhe bekommen, die Tafel wird sofort aufgehoben werden.”
Fast in demselben Augenblick erhob sich der Herr Oberst mit seiner Tischdame und die übrigen folgten seinem Beispiel. Man begab sich in die Nebenräume, wo Café, Likör und Zigarren serviert wurden, während ein Teil der Ordonnanzen in dem Speisesaal abdeckte und alles zum Tanz vorbereitete. Denn getanzt sollte werden, das war der ausdrückliche Wunsch der Frau von Schöler, der liebenswürdigen Kommandeuse, und dem gegenüber verstummten alle Klagen , wie es im Trompeter von Säkkingen heißt.
Die Kapelle, die während des Diners Blechmusik gemacht hatte, holte jetzt ihre Instrumente zur Streichmusik hervor — noch einmal stärkten sich die Braven durch einen tiefen, tiefen Trunk, um der Kasino–Kommission zu beweisen, daß das große Faß Bier nicht „zum Spaß” aufgestellt sei, dann erklang das „ein — zwei — drei” des Dirigenten und gleich darauf ertönte „die blaue Donau”.
Die Damen freuten sich — die Herren stöhnten: „Um Gotteswillen, geht die Springerei jetzt schon los?”, machten aber doch gute Miene zum bösen Spiel und engagierten ihre Tischdame zum ersten Walzer.
Der Regimentsadjutant tanzte mit Fräulein Edith: auf den vielen Bällen hatten sie sich so miteinander eingetanzt, daß es für alle eine Freude war, ihnen zuzusehen — ein schöneres und eleganteres Paar konnte man sich gar nicht denken. Im Gegenteil zu den anderen begnügten sie sich nicht damit, einmal „die Bahn” zu halten, sondern immer und immer wieder walzten sie durch den Saal, bis Edith schließlich sagte: „So, nun ist es aber wirklich genug, Herr von Petlow, ich danke Ihnen — ich kann nicht mehr.”
Er geleitete sie zu ihrem Platz zurück. „Ich hätte gerne noch etwas länger mit Ihnen getanzt, gnädiges Fräulein,” sprach er, „wer weiß, ob sich mir heute Abend noch Gelegenheit zu einem zweiten Walzer bietet, die Pflicht ruft, ich habe noch auf dem Regimentsbureau zu thun.”
Fast erschrocken sah sie ihn an: „Wirklich? Das thut mir aufrichtig leid, Sie wissen, daß ich am liebsten mit Ihnen tanze.”
Er strich sich wohlgefällig den dichten schwarzen Schnurrbart. „Das ist wenigstens ein freundliches Wort von Ihnen im Laufe des ganzen Abends — sehen Sie, dort kommt schon eine Ordonnanz, um mich zu holen. Ich kehre zurück, sobald ich irgend kann und vergesse Sie nicht! J'y pense.”
„Seien Sie unbesorgt,” bat sie, „auch ich denke daran.”
Die Sporen zusammenschlagend verabschiedete sich Herr von Petlow — und Edith wurde gleich darauf von einem anderen Leutnant engagiert. Die anderen Herren waren glücklich, daß den Adjutanten, wenn vielleicht auch nur für kurze Zeit, der Dienst fernhielt, sie alle umringten Edith und jeder von ihnen wollte als erster mit ihr tanzen.
Nach einer halben Stunde etwa trat eine längere Pause ein, Edith saß erschöpft auf einem Stuhl und hörte nur mit halben Ohren auf die Plauderei ihres Herrn, eines jungen Avantageurs, der sich die größte Mühe gab, nicht nur liebenswürdig, sondern auch geistreich zu sein.
„Gewiß — ja,” pflichtete sie ihm jetzt auf eine Bemerkung seinerseits bei, „aber nicht wahr, Fähnrich, pardon, Herr von Holtzen, Sie sind so liebenswürdig, mir eine Bowle oder sonst ein Glas Selters zu besorgen, ich verschmachte.”
Der Fähnrich sprang in die Höh', er war so diensteifrig, daß er sogar: „Zu Befehl” sagte, dann sah er sich um und winkte eine der Ordonnanzen herbei, die in kleidsamer blau und roter Livree, den Farben des Regiments entsprechend, servierte, herbei [sic! D.Hrsgb.](1): „Sie da — Ordonnanz — ein Glas Bowle für das gnädige Fräulein.”
Die Ordonnanz stellte das schwere Tablett, das sie in den Händen hielt, auf einen Tisch und präsentierte das Glas in der Hand.
„Holen Sie sich gefälligst erst einen Untersatz,” herrschte der Fähnrich den Untergebenen an, „es ist wirklich ein Servieren, das jeder Beschreibung spottet,” und zu Edith gewandt, fügte er hinzu: „Bitte, warten Sie so lange, gnädiges Fräulein.”
Aber Edith hielt das Glas schon in der Hand: „Lassen Sie es gut sein, Herr von Holtzen,” beruhigte sie ihren Herrn. „Die Hauptsache ist doch schließlich, daß man etwas zu trinken bekommt.”
Sie führte das Glas an die Lippen, aber in demselben Augenblick geschah etwas Unerwartetes. Mit lauter Stimme sagte die in strammer Haltung vor ihr stehende Ordonnanz plötzlich: „J'y pense — sehen Sie, gnädiges Fräulein, nun haben Sie doch verloren.”
Mit einem leisen Aufschrei ließ Edith das Glas zu Boden fallen. Starr sah sie die Ordonnanz an und jetzt erkannte sie in ihm Herrn von Petlow, der seine Uniform mit der Livree vertauscht und sich sogar seinen stolzen Schnurrbart hatte abschneiden lassen.
Ediths Augen füllten sich mit Thränen. Sie ärgerte sich nun, doch überlistet zu sein und zornig stampfte sie mit dem kleinen Fuß auf den Boden.
„Bitte, Fähnrich, thun Sie mir den Gefallen spurlos zu verschwinden,” bat er, und als er mit Edith allein war, sagte er: „Es gilt doch — da hilft Ihnen niemand. Sie haben mir das Glas aus der Hand genommen — dafür, daß Sie mich nicht gleich erkannten, dafür, daß Sie mich kaum ansahen, kann ich doch nichts. Ich hatte Sie nicht nur auf eine List und Tücke meinerseits vorbereitet, sondern auch Ihre Erlaubnis dazu erbeten und erhalten. Der Kampf ist aus, ich bin der Sieger und erbitte nun meinen Lohn.”
Unwillkürlich erblaßte sie und trat einen Schritt zurück. „Und worin soll derselbe bestehen?” fragte sie.
„Ich sagte Ihnen ja schon, gnädiges Fräulein, daß ich viel von Ihnen verlangen würde,” gab er zur Antwort, „aber das Viel ist doch so klein, daß es ganz bequem in dieser meinen großen Rechten Platz findet. Bitte, gnädiges Fräulein, legen Sie Ihre Hand hier hinein, aber lassen Sie sie auch dort, nicht für Sekunden, sondern für immer. Bitte thun Sie mir den Gefallen — nur dieses eine Mal.”
Mit glühenden Wangen stand sie ihm gegenüber, während sie ihn mit leuchtenden Augen ansah. „Also doch noch,” sagte sie endlich, „wissen Sie wohl, daß ich lange auf dieses Wort von Ihnen gewartet habe. Ich dachte schon, Sie kämen garnicht mehr und deshalb war ich in der letzten Zeit eigentlich recht böse auf Sie.”
Stürmisch ergriff er ihre Hand. „Edith, liebe kleine Edith, ist es wirklich wahr, hast Du mich schon lange lieb?”
Sie nickte ihm glückselig zu, und als in diesem Augenblick die Musik von neuem begann, stürmte er, sie leidenschaftlich an sich pressend, im rasenden Galopp mit ihr dahin, bis mit einem Mal auf einen Wink des Kommandeurs die Musik verstummte, „damit die plötzlich verrückt gewordene Kasino–Ordonnanz, die es wagte, mit der Tochter des Regiments zu tanzen, aus dem Saal entfernt würde.”
Aber die Ordonnanz blieb trotzdem im Saal und noch an demselben Abend gab der Kommandeur seine Einwilligung zur Verlobung.
(1) In der Buchfassung und in der Fassung der „Kieler Zeitung” fehlt hier das Wort „herbei”. (zurück)
„Middelburgsche courant” vom 06-02-1901:
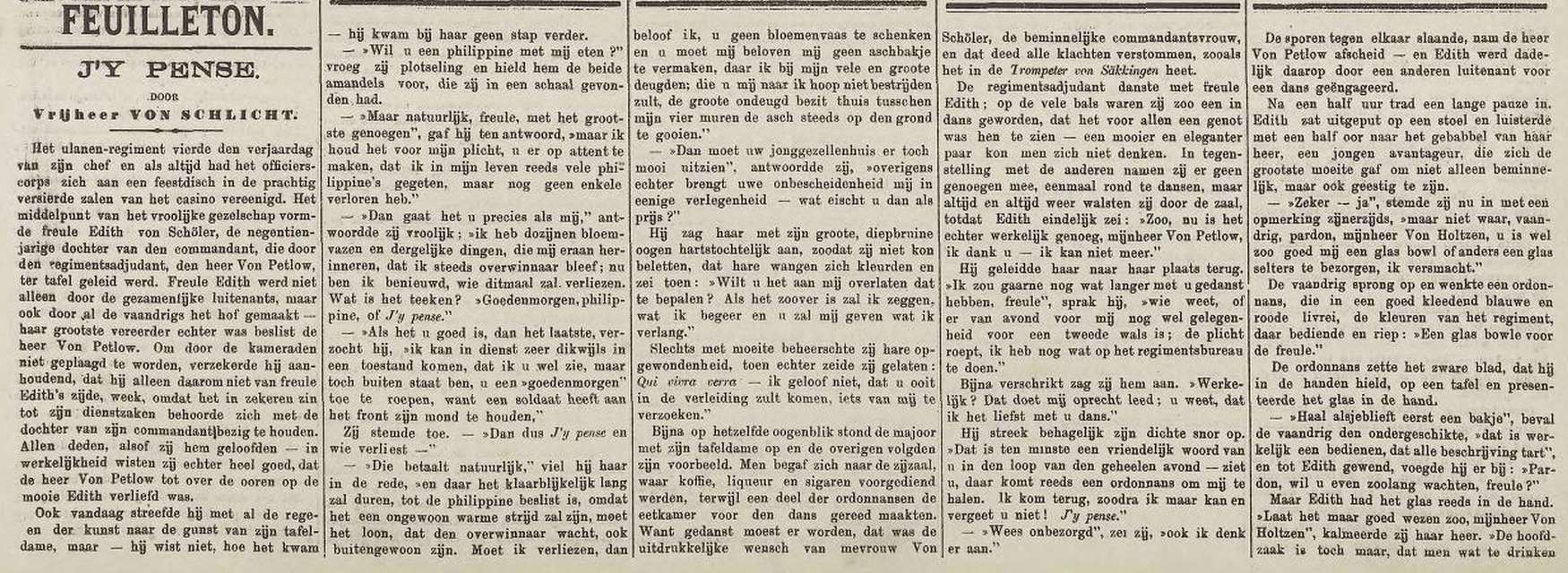
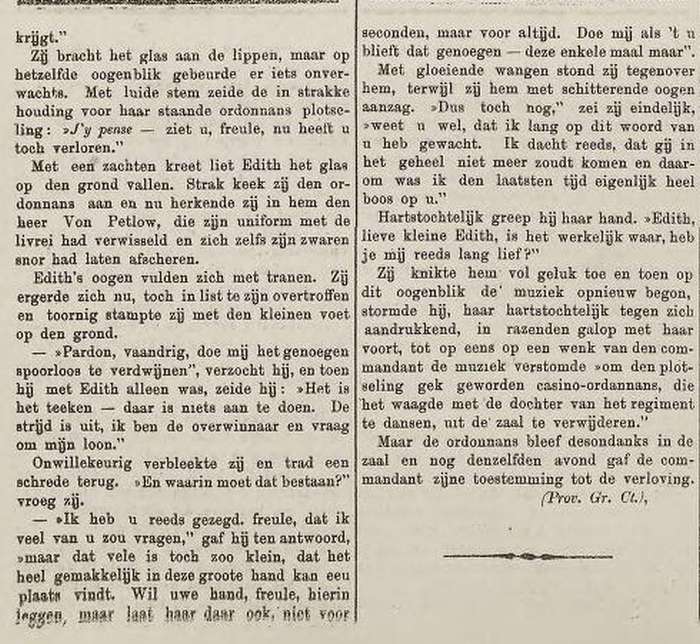
„Bataviaasch nieuwsblad” vom 30.9.1901;
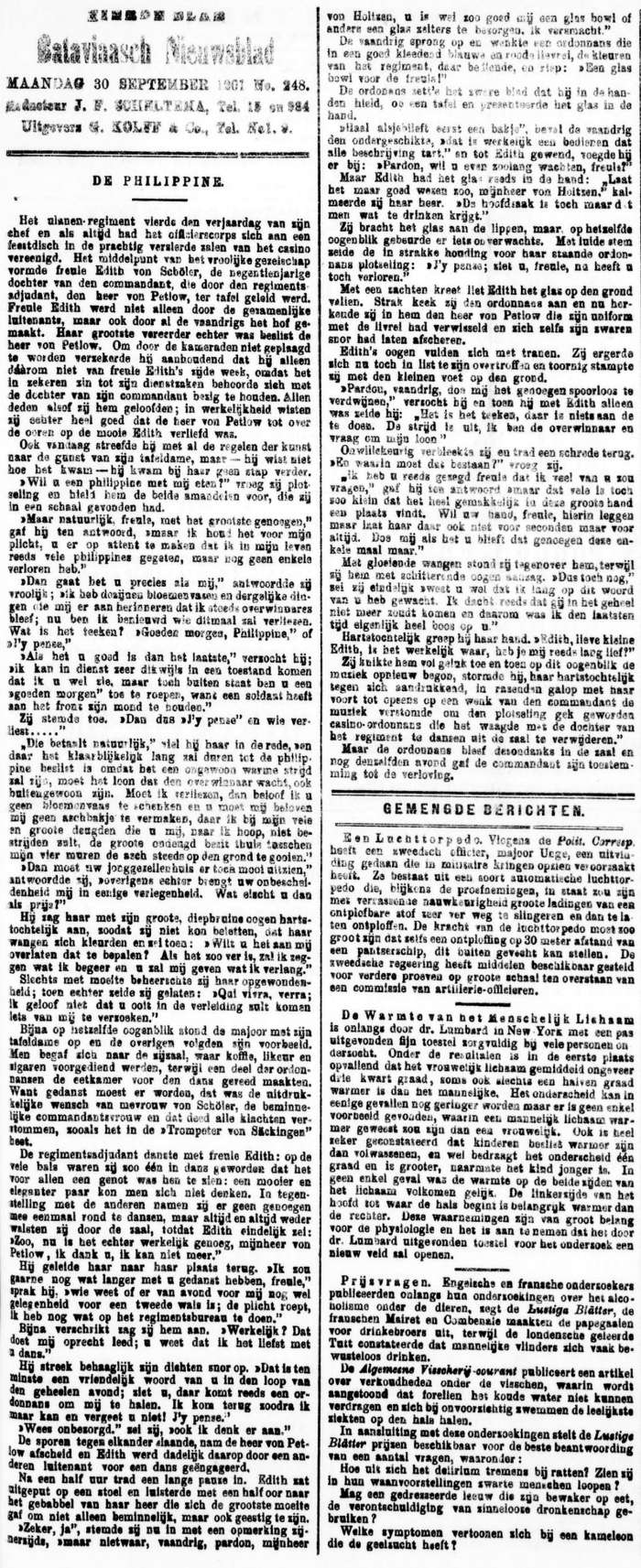
„De Sumatra post” vom 29.10.1901:

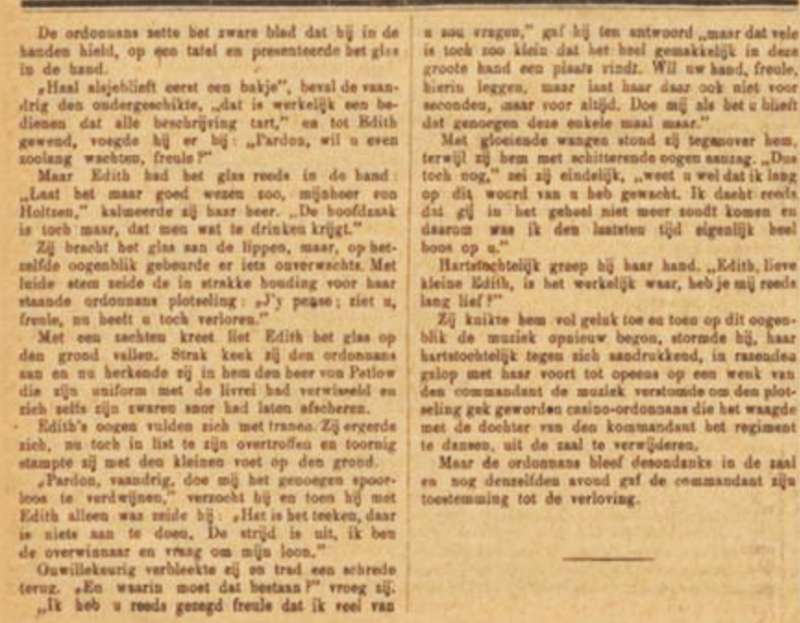
„Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant” vom 20.7.1903: