
Humoreske vom Freiherrn von Schlicht.
in: „Kieler Zeitung” vom 30.7.1896,
in: „Prager Tagblatt” vom 2.Aug. 1896,
in: „Hamburger Anzeiger” vom 2.Aug. 1896,
in: „Mährisches Tagblatt” vom 3.8.1896,
in: „Bonner Zeitung” vom 16.8.1896,
in: „Leipziger Tageblatt” Nr. 442 vom 31.Aug. 1896,
in: „Aachener Anzeiger” vom 2. und 3.9.1896,
in: „Deutsches Heim”, Jahrgang 1895/96, Seite 781-783
(Sonntagsbeilage zur „Berliner Zeitung”), 6.9.1896,
in: „Trierische Landeszeitung” vom 9.12.1896,
in: „Lippische Post” vom 11., 13. und 14.12.1897,
in: „Neues Wiener Journal” vom 10.3.1899,
in: „Güstrower Zeitung” vom 1.4.1899,
in: „New Orleans Deutsche Zeitung” vom 2.4.1899,
in: „Livländischer Kalender 1899,
in: „Haarlem's Dagblad” vom 11.11.1905,
in: „Bataviaasch nieuwsblad” vom 13.12. 1905,
in: „Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië” vom 28-08-1911 und
in: „Meine kleine Frau und ich”.
Sobald der Diener zu mir ins Zimmer trat und mir einen Brief brachte, bekam ich nervöse Zuckungen.
Ich war Strohwittwer, zum ersten Mal in meinem ehelichen Leben lernte ich diesen Zustand kennen, der neben seinen großen Vortheilen auch unleugbare Nachtheile mit sich bringt. Die Trennung sollte nur eine kurze sein, in acht Tagen wollte ich meine Frau bei ihrer Mutter abholen, dort meinen Geburtstag feiern und am selben Abend wieder mit meiner Gebieterin in das eigene Nest zurückkehren. Selbstverständlich versprachen wir uns beim Abschied uns täglich mindestens zwei Mal zu schreiben, und wir hielten auch Wort — meine Frau wenigstens. Aber während diese Briefe anfangs mein Entzücken bildeten, fingen sie allmählich an, mich zu quälen und um die Ruhe meines Lebens zu bringen. Ach, und die kleine Frau meinte es so gut. In der Freude ihres Herzens hatte sie mir im ersten Brief geschrieben, daß meine Schwiegermutter für mich ein wunderschönes Geburtstagsgeschenk habe — ich solle einmal rathen, was es wohl sein könne.
Natürlich war das viel leichter gesagt als gethan, denn was kann man nicht Alles geschenkt bekommen? Die Zahl der Gegenstände ist so groß, daß ein Stotterer sie nie und nimmer aussprechen kann. So bat ich denn, wenn doch einmal gerathen sein sollte, um etwas nähere Angaben, besonders wollte ich wissen, ob es etwas zu essen, trinken, rauchen oder zum Anziehen wäre. Es sei nichts von alledem, hieß es, es sei ein Luxusgegenstand, aber dennoch sehr nützlich, fast unentbehrlich. Nun war der Kreis schon etwas enger gezogen, dennoch war es noch immer umöglich, das Richtige zu errathen. So erbat ich denn abermals nähere Angaben und schrieb, ich möchte gern den Anfangs- oder den Endbuchstaben des Wortes wissen, am liebsten natürlich beide und einige Buchstaben in der Mitte. Die Antwort lautete, das sei leider nicht möglich, aber ein „i” käme in dem Worte vor, ob ich es denn immer noch nicht wisse. Ich gestand offen und ehrlich meine Unwissenheit ein und bat, mir etwas über das Aeußere des geheimnißvollen Gegenstandes zu verrathen. Der Bescheid, den ich erhielt, ging dahin, das Geschenk sei wenigstens viermal so lang als es breit sei, es wäre aus Holz, Leder und Tuch gefertigt. Wenn ich es nun noch nicht wüßte, wäre ich wirklich zu dumm. Natürlich wollte ich diesen Vorwurf nicht auf mir sitzen lassen und telegraphirte sofort: „Hurrah, ich habs. Eine Chaiselongue.” Aber schon nach einer Stunde hatte ich die Antwort: „Ganz falsch.”
Nun fing ich an, unruhig und nervös zu werden, ich dachte an nichts Anderes als an dieses unbekannte X, mit dem ich gequält und gepeinigt wurde, und nur mit Widerstreben öffnete ich schließlich die Briefe meiner Frau, die stets eine Variation über dasselbe Thema waren.
Als ich es endlich garnicht mehr aushalten konnte, that ich, was ich schon längst hätte thun könne, ich wandte mich an einen Freund und klagte ihm mein Leid. Kopfschüttelnd hörte er mir zu: „Was ist mindestens viermal so lang als breit und enthält in seiner Benennung ein „i”? Ich denke, das kann nur eins sein.”
„Und das wäre?” fragte ich frohlockend.
„Eine Irrenanstalt,” antwortete er — und nun gab ich es auf, das Räthsel zu lösen.
So kam mein Geburtstag heran, und Jeder kann sich vorstellen, mit welcher Ungeduld ich dem Augenblick der Bescheerung entgegensah, nachdem ich meine kleine Frau und meine Schwiegermutter begrüßt hatte. Aber ich mußte noch etwas warten, der Conditor hatte den Kuchen noch nicht geschickt, und als er kam, mußten die Lichter noch befestigt und angezündet werden, und als nun endlich für mich geklingelt werden sollte, fehlte die Glocke. Um der Pein ein Ende zu machen, schlug ich selbst in der Eßstube das Gong-Gong und betrat dann, gefolgt von meinen Damen, den Saal, in dem die Geschenke für mich aufgebaut waren. Mit schnellem Blick überflog ich die zahlreichen Gaben, die da vor mir lagen — welche von allen mochte das große Geheimniß sein? Da lagen manche Sachen, die viermal so lang als breit waren und deren Bezeichnung ein „i” enthielt — ein Cigarrenetui für holländische Cigarren, ein neumodisches Portemonnaie von der Gestalt einer Ziehharmonika und sonst noch Mancherlei, aber so schön diese Dinge auch waren, so schienen sie mir doch die Leiden nicht werth zu sein, die ich in den letzten acht Tagen ausgestanden hatte.
„Aber freust Du Dich denn gar nicht, Du bist ja so still?” klang da die Stimme meiner Frau an mein Ohr. —
„Wie kannst Du nur so fragen?” gab ich zurück, „natürlich freue ich mich riesig — aber Kind, nun zeig' mir mal das berühmte Geschenk, mit dem Du mich so lange gequält hast?”
„Aber hier steht es ja doch,” lautete die Antwort, und meine Frau zeigte auf einen Photographierahmen, sowohl an Façon als an Arbeit das Grausigste, was ich je gesehen hatte, nach meiner Meinung konnte das Ding keine fünfzig Reichspfennige gekostet haben.
„Wirklich, sehr, sehr hübsch, meine liebe Schwiegermama,” sagte ich und küßte dankbar die Hände der gütigen, alten Frau.
Aber im Innern war ich arg enttäuscht und ich vermochte dies nur schlecht zu verheimlichen, als wir endlich in das Eßzimmer gingen, um zu frühstücken. Wie stets, wenn ich mich in diesem Saal befinde, ließ ich auch dieses Mal meine Blicke bewundernd umherschweifen und erfreute mich an den vielen alten Krystall- und Glassachen, die die Borde zieren. Da entdeckte ich etwas, was mir bei meinen früheren Besuchen noch nicht aufgefallen war. Neugierig erhob ich mich von meinem Platz.
„Ich bitte um Verzeihung, aber den Ofenschirm muß ich mir erst mal ansehen, das Ding ist ja wundervoll!”
Ich trat an den Kamin und betrachtete aufmerksam den Gegenstand meiner Neugierde. Der Rahmen des gut zwei Meter hohen und etwa einen halben Meter breiten Ofenschirms bestand aus dickem, gepreßtem Leder, auf dem wundervolle Ornamente eingebrannt waren. Die Füllung des Rahmens war ein großes Stück grünen Atlasses mit eingepreßten Heiligenbildern — wie ich später erfuhr, vor vielen Jahren mit großen Kosten in Rußland bei dem Besuch eines Klosters erstanden. Gleichsam den Kopf des Ofenschirms bildeten viele, alte, geschnitzte kleine(1) Engelsfiguren.
„Aber Liebste, wo hast Du denn das wieder aufgetrieben?” fragte ich voller Bewunderung, „das ist ja geradezu herrlich.”
„So, gefällt er Dir?” klang es zurück, „na, dann muß ich ihn Dir wohl noch zum Geburtstag schenken.”
„Du bist aber auch wirklich zu dumm,” brach meine Frau mit hellem Lachen los, „dies ist doch natürlich das große Geheimniß, von dem ich Dir schrieb! Daß Du darauf aber noch nicht gekommen bist.”
Ich war starr vor Freude, keines Wortes fähig, und erst später gelang es mir, meinen Dank zum Ausdruck zu bringen. — — —
Abends um acht Uhr wollten wir mit dem Schnellzug abreisen, und um sieben Uhr begannen wir unsere Sachen einzupacken.
„Und den Ofenschirm nehmen wir mit ins Coupé,” sagte meine kleine Frau.
„Natürlich,” bestätigte ich lachend, „den nehmen wir mit in das Coupé.”
Um ein halb acht Uhr fuhr der Wagen vor, der uns zum Bahnhof fahren sollte, und nun ging das Abschiednehmen los. Mutter und Tochter hatten sich noch im letzten Augenblick soviel zu sagen, sich gegenseitig noch an so viel zu erinnern, einander für dritte Personen noch soviel Grüße aufzutragen, daß ich schließlich voran ging und in den Wagen stieg. Endlich erschien auch meine kleine Frau und ich wollte gerade dem Kutscher zurufen, er solle losfahren, als plötzlich Bertha, das schwiegermütterliche Dienstmädchen, in der Hausthür erschien, in beiden Händen den gewaltigen Ofenschirm tragend.
„Geben Sie nur her,” rief meine Frau, indem sie die Hände ausstreckte, „wir nehmen ihn in den Wagen.”
Ich glaubte, der Schlag sollte mich rühren. „Aber Kind, so mach doch keine Scherze,” bat ich endlich, „wir müssen uns beeilen, wenn wir noch rechtzeitig zur Bahn kommen wollen.”
Inzwischen hatte meine Frau, ohne auf meine Worte zu achten, versucht, den Schirm in den Wagen hineinzunehmen.
„Es geht nicht,” klagte sie endlich.
„Natürlich geht es nicht,” versetzte ich, „selbst die Diagonale unseres Vehikels hat keine zwei Meter.”
„So laß uns den Wagen offen machen und den Schirm hinstellen,” bat meine Frau.
„Damit alle Straßenjungen hinter uns herlaufen?” fragte ich; „Kind, sei verständig, wir lassen den Schirm hier, beauftragen morgen schriftlich einen Packer, ihn uns hinzusenden, und damit ist der Fall erledigt. Kutscher los.”
Die Pferde zogen an, aber meine Frau rief ein so energisches „Halt”, daß der Kutscher, wohl in dem Glauben, es sei ein Unglück passirt, mit jähem Ruck(2) die Zügel wieder anzog.
„Was giebt es den nur?” fragte ich, „hast Du wieder etwas vergessen?”
„Ja, den Ofenschirm,” lautete die Antwort, „ohne den fahre ich nicht.”
Ich begann unruhig und nervös zu werden. „Liebes Kind,” erwiderte ich, „willst Du mir vielleicht sagen, wie wir ihn transportiren sollen?”
„Der Kutscher kann ihn zu sich auf den Bock nehmen, und dann nehmen wir ihn nachher ins Coupé.”
„Aber das ist doch heller Unsinn,” rief ich, „wenn der Kutscher aus Versehen mit seinen Stiefeln an den Atlas kommt und in diesen ein Loch stößt, so ist die ganze Herrlichkeit zum Teufel.”
„So muß er ihn auf das Verdeck legen.” — „Damit er da schmutzig wird, gewiß, das wäre sehr praktisch.”
„Viel Zeit haben wir nun aber nicht mehr,” mahnte der Kutscher.
„Fahr zu!” rief ich.
„Halt — ha a a alt!” rief meine Frau.
Da hielten wir wieder.
Abermals fühlte ich mich einem Schlaganfall nahe, neugierig blieben die Passanten stehen und blickten theils auf uns, theils auf Bertha, die noch immer mit dem Ofenschirm in den vorgestreckten Händen dastand.
„Aber was willst Du denn eigentlich?” fragte ich, „mach uns hier doch, bitte, nicht lächerlich.”
„Blamier Du Dich nur nicht durch Dein lautes Poltern,” klang es zurück, „ich verstehe Dich überhaupt nicht. Du regst Dich hier in einer Art und Weise auf —”
„Da soll der Teufel ruhiges Blut behalten,” erwiderte ich, „und nun, um der Scene ein Ende zu machen: der Schirm bleibt hier.”
„Gut, dann bleibe ich auch hier.” Und ehe ich es verhindern konnte, hatte meine Frau die Wagenthür geöffnet, war hinausgesprungen und in das Haus ihrer Mutter geeilt.
Was nun? Mit einem schnellen Sprung war auch ich aus dem Wagen, und wollte meiner Frau nacheilen, aber die Stimme des Kutschers hielt mich zurück: „Herr, soll ich warten? Zu spät kommen wir ja nun doch.”
Ich sah nach der Uhr, wirklich, es war keine Möglichkeit mehr, den Zug noch rechtzeitig zu erreichen, so lohnte ich denn den Kutscher ab, ließ unsere Koffer wieder abladen und bestellte den Fuhrmann zu Abends 11 Uhr wieder. Es blieb mir nun nichts Anderes übrig, als die ganze Nacht hindurch mit dem Bummelzug zu fahren.
Als ich die Stube wieder betrat, in der ich vor Kurzem Abschied genommen hatte, entschlüpften meinen Lippen bei dem sich mir darbietenden Anblick unwillkürlich die Verse aus Wolff's Tannhäuser: „Die beiden Frauen standen eng umschlungen, und Irmgard weinte an der Fürstin Busen.”
„Ich glaube, zum Scherzen ist die Stunde übel gewählt,” wurde ich da belehrt, „meine Tochter ist mit Recht außer sich. Ich verlange keine Dankbarkeit, aber finde, die vielfachen Beweise von Liebe, die Deine Frau Dir heute gegeben hat, hätten Dich wohl milde und gütig stimmen können.”
„Aber liebste Schwiegermama, so nimm Du doch wenigstens Vernunft an,” flehte ich.
Da kam ich aber schön an. „Ich bin kein vernunftloses Wesen, das sich über nichts und wieder nichts erregt und sich geberdet, wie — nun, ich weiß nicht wie!”
Nun war aber auch meine Geduld Matthäi am letzten. „Das nennst Du nichts und wieder nichts, wenn meine Frau verlangt, daß wir diesen Ofenschirm als Handgepäck mit in das Coupé nehmen sollen?”
„Was ist denn dabei?” erwiderte sie ganz ruhig.
„Was dabei ist?” fragte ich ganz verzweifelt. „Wie soll man den Schirm denn im Coupé unterbringen? Ins Netz kann man ihn doch nicht legen!”
„Aber man kann ihn hinstellen!”
„Dazu ist er zu groß.”
„Nun, dann legt man ihn eben schräg hin!”
„Gewiß,” gab ich zur Antwort, „wenn das Coupé leer ist oder wenn die Mitreisenden Engel sind und es sich gefallen lassen, daß sie anstatt der eigenen Reisedecke einen fremden Ofenschirm auf den Knieen haben.”
„Nicht alle Menschen sind so ungefällig wie Du!” mischte sich jetzt meine kleine Frau, die ihre Thränen getrocknet hatte, in die Unterhaltung.
„Gewiß nicht,” erwiderte ich, „aber ich möchte Dich nur an jenen Moment unserer Hochzeitsreise erinnern, als ein würdiges Ehepaar zu uns ins Coupé stieg, das so viel Handgepäck mit sich führte, daß wir Beide, obgleich wir die Einzigen im Coupé waren, thatsächlich keinen Platz mehr hatten, und uns an den Schaffner wenden mußten. Erinnerst Du Dich dessen?”
Das Schweigen meiner Frau konnte ebenso gut „Ja” wie „Nein” bedeuten. Ich nahm das erstere an und sagte in mildem Tone: „Ich möchte so gerne wieder Ruhe und Frieden haben — wenn ich doch nur wüßte, warum dieser unglückliche Schirm absolut zweiter Classe reisen soll? Warum kann er nicht im Gepäckwagen fahren?”
„Weil er da entzwei geht.”
„Das käme doch wohl nur auf die Verpackung an!” erwiderte ich.
„Der Schirm läßt sich überhaupt nicht verpacken,” klang es zurück, „der muß so transportirt werden, wie er ist.”
„Gieb's auf!” sagte ich zu mir im Stillen, „gieb's auf, Du siegst doch nicht.”
So streckte ich die Waffen und erklärte mich mit Allem einverstanden, was die Damen beschließen würden. Natürlich blieb es bei dem ursprünglichen Beschluß, den Schirm als Handgepäck mit ins Coupé zu nehmen.
Abends um ein halb elf Uhr fuhr unser Wagen zum zweiten Male vor, und der Ofenschirm, in ein altes Stück Leinen eingenäht, wurde auf den Verschlag der Droschke gelegt.
Fünf Minuten vor Abgang des Zuges erreichten wir den Bahnhof. Ich löste die Billets, expedirte das Gepäck und betrat dann, den Ofenschirm horizontal unter dem rechten Arm haltend, den Perron.
„Schaffner, zweiter, Nichtraucher!”
„Hier mein Herr!”
Meine Frau stieg zuerst ein, dann machte auch ich Miene, das Trittbrett in die Höhe zu klettern.
Doch des Schaffners rauhe Stimme hielt mich zurück. „Herr, dieses Ungeheuer müssen Sie aufgeben, das dürfen Sie nicht mit ins Coupé nehmen.”
„Nanu,” fragte ich möglichst erstaunt, „welches Ungeheuer? Ach so, Sie meinen dies kleine Packet? Stellen Sie sich doch nicht so an!”
Die Coupéthüren wurden zugeschlagen, es war die höchste Zeit.
„Fertig?” fragte der Zugführer.
„Nein,” rief mein Schaffner, „hier der Herr da will dieses große Packet als Handgepäck mit ins Coupé nehmen.”
„Das ist ja Unsinn,” klang es zurück. Der Zugführer trat heran und sprach sein energisches: „Das geht nicht.”
„Aber es muß gehen!” rief ich.
Statt aller Antwort ließ er seine Pfeife ertönen, die Locomotive zog an, die Räder setzten sich in Bewegung, meine Coupéthür wurde zugeschlagen, meine Frau erschien verzweifelt am Fenster, eine harte Faust riß mich zurück, als ich auf das Trittbrett springen wollte, die Wagen fuhren schneller und schneller, entschwanden meinen Blicken und ich war allein — allein mit meinem Ofenschirm.
Am liebsten hätte ich das Ding Jemandem an den Kopf geworfen.
Fünf Minuten später unterhandelte ich mit dem Stationsvorsteher über die nächste Reisegelegenheit. Die Kosten eines Extrazuges konnte ich leider nicht bestreiten, aber nach langem Drängen und Bitten erhielt ich die Erlaubniß, Nachts um ein Uhr mit einem Viehzug fahren zu dürfen. In einem Waggon, in dem etliche Ochsen standen, fand sich noch Platz für mich und meinen Ofenschirm.
Zerrädert, zerschlagen an allen Glieden kam ich am nächsten Mittag zu Hause an, wo meine Frau, die ich telegraphisch benachrichtigt hatte, mich voller Ungeduld erwartete. Mit lautem Hurrah wurden wir begrüßt und der Schirm im Triumph vor den Kamin aufgestellt — dort steht er noch, von Vielen bewundert, und dort wird er auch stehen bleiben, wenn das Geschick mich einmal in eine andere Stadt verschlagen sollte. Denn das weiß ich, zum zweiten Male begebe ich mich nicht mit ihm auf Reisen.
(1) In der Fassung der „Kieler Zeitung” fehlt hier das Wort: „kleine” (zurück)
(2) In der Fassung der „Kieler Zeitung” heißt es hier: „mit einem jähen Ruck” (zurück)
„Haarlem's Dagblad” vom 11.11.1905:

„Bataviaasch nieuwsblad” vom 13.12. 1905:
 |
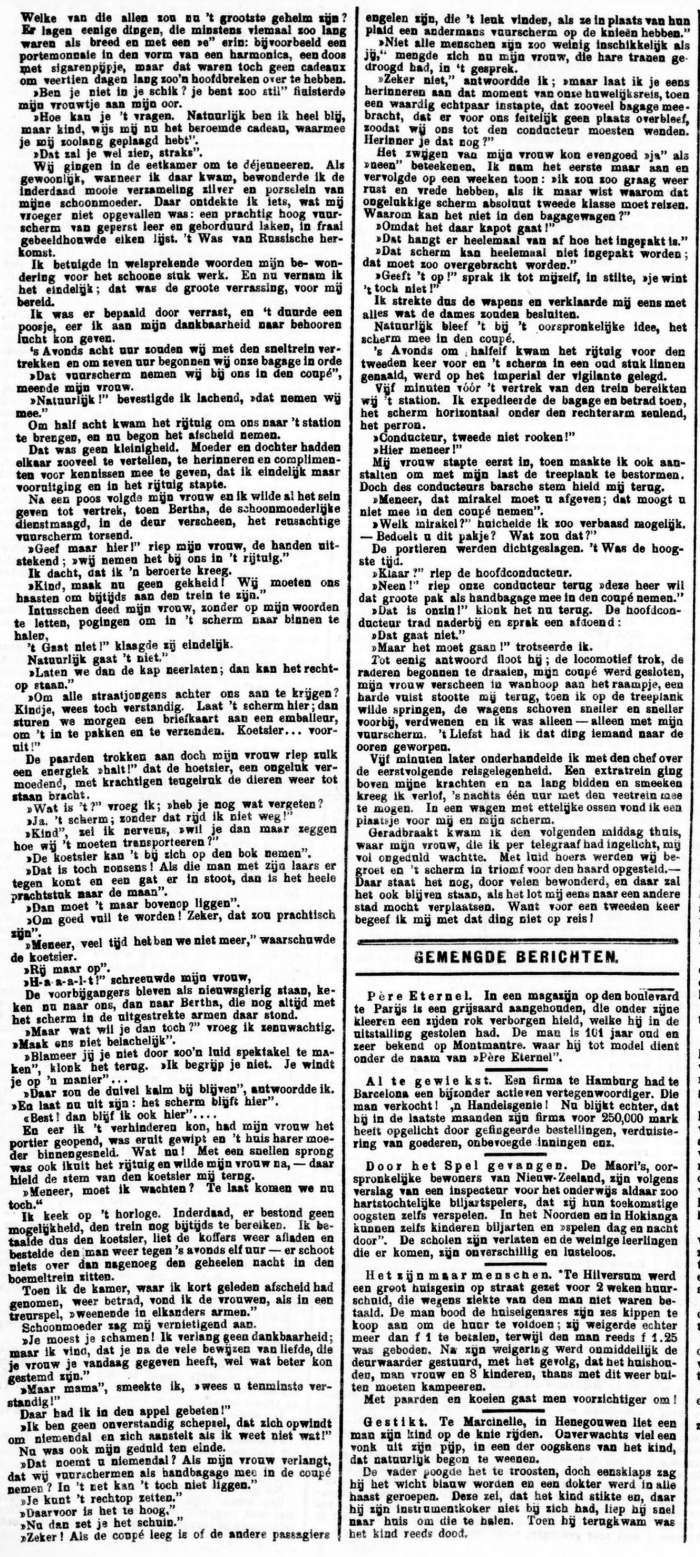 |
„Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië” vom 28-08-1911;
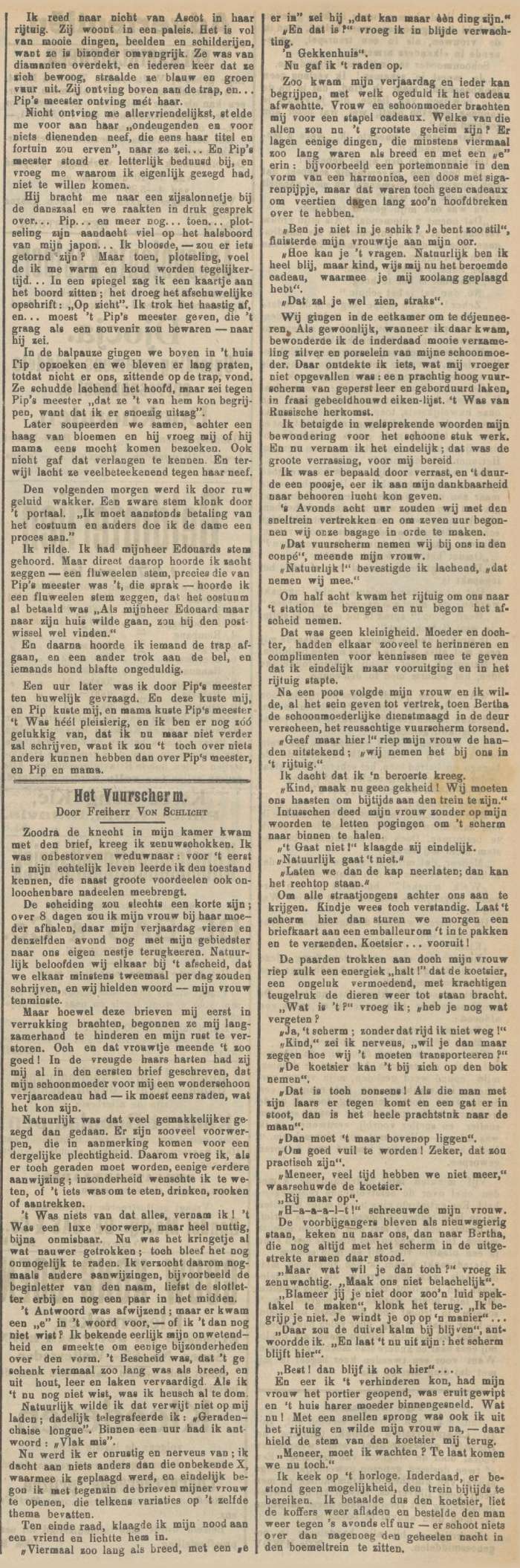 |
 |