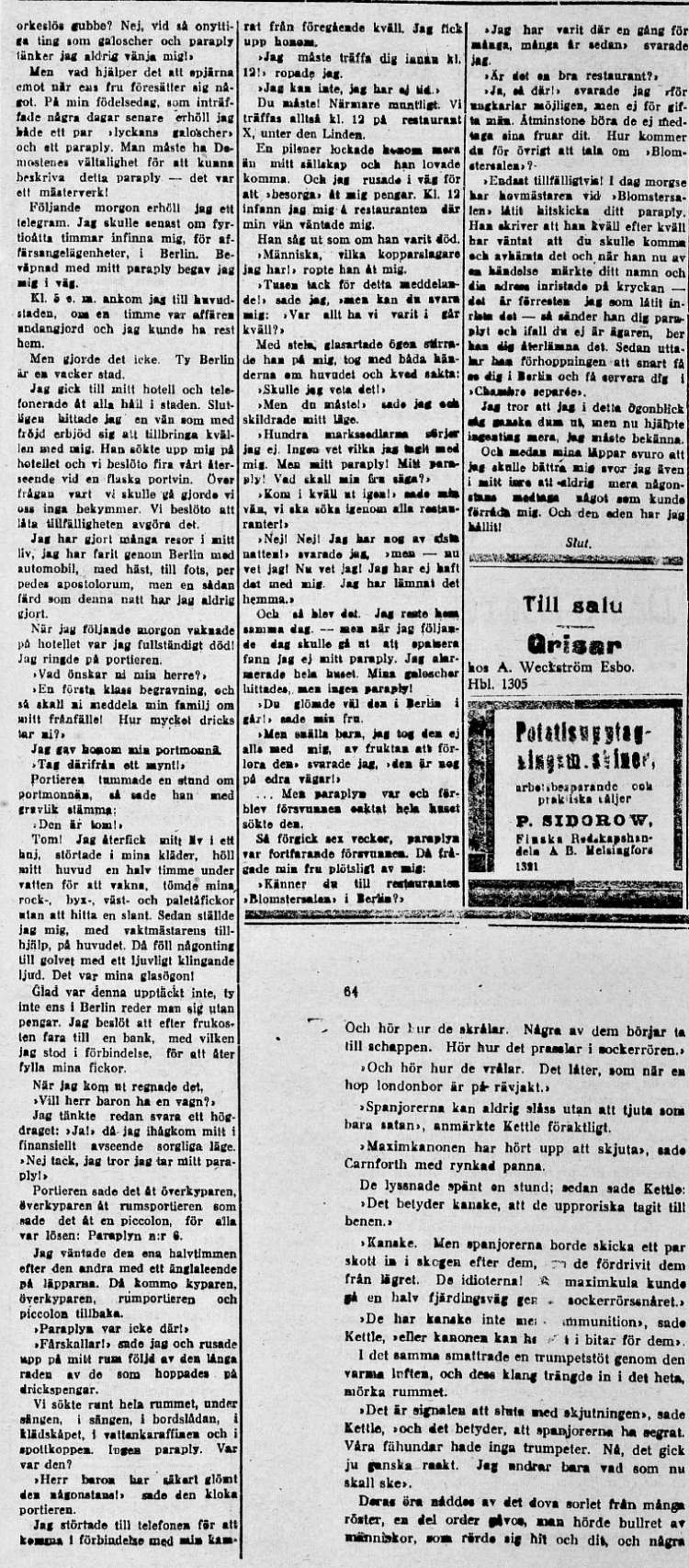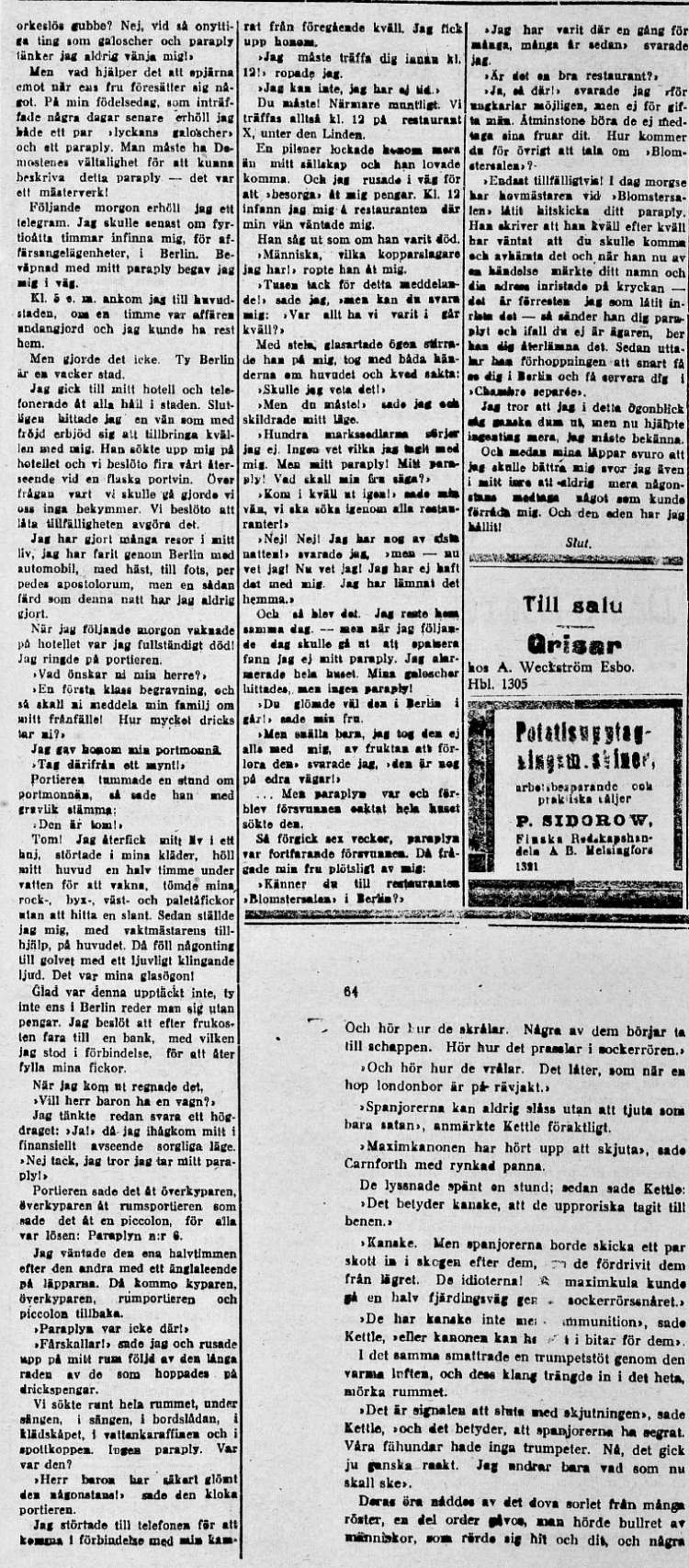
Von Freiherr von Schlicht.
in: „Hagener Zeitung” vom 12.7.1898,
in: „Ohligser Anzeiger” vom 14. und 16.7.1898,
in: „Fremdenblatt. Organ für die böhmischen Kurorte” vom 7.8.1898,
in: „Svenska Tidningen” vom 27.8.1919, Übersetzung ins Schwedische
unter dem Titel „Mitt paraply” und
in: „Ehestandshumoresken”
Wer sich im Freien befindet, wird, wenn es regnet und er sich nicht irgendwo unterstellen kann, naß — über die tiefe Wahrheit dieses Ausspruches hat schon Xenophon in seinen Memorabilien sich eingehend geäußert. Soldaten werden jeden Tag naß, auch wenn es nicht regnet, denn dann sorgen die lieben Vorgesetzten dafür, daß man warm wird und Wärme erzeugt bekanntlich Niederschläge. An das Naßwerden gewohnt, wie der Zahnkranke an das Zahnausziehen, blickt der Soldat, in Sonderheit der Offizier-Soldat, mit einer gewissen Geringschätzung auf seine bürgerlich gekleideten Mitmenschen, die, sobald das Barometer auf Regen zeigt, die Füße in Gummischuhe stecken und den Regenschirm unter den Arm nehmen — ich gestehe offen und ehrlich ein, daß ich früher geringschätzend mitblickte.
Eines schönen Morgens erwachte ich als homo civilis — Civilis ist etwas ganz anderes als Cibilis — mit dem Leutnant sein war es vorbei und anstatt der schönen Uniform zog ich mir einen sehr schönen schwarzen Zivilanzug an, setzte mir einen tadellos neuen Zylinder auf den Kopf, ergriff anstatt des Säbels, der mich sonst auf meinen Wanderungen begleitet hatte, einen Spazierstock, die Perle seines Geschlechts und tändelte dann im leichten, elastischen Schritt durch die Straßen der Stadt, um mich bewundern zu lassen. Tieferen Eindruck schien meine Erscheinung nur auf die Sonne zu machen, denn nachdem sie mich eine Zeitlang bewundert hatte, zog sie ihren Schleier vor das Gesicht, um die Tränen zu verbergen, die ihr in die Augen traten. Schleier sind leider nicht absolut wasserdicht, so fielen auch die Tränen der Frau Sonne hindurch, erst langsam, vereinzelt, dann aber stärker und immer stärker — es goß bald in Strömen.
Als ich endlich wieder zu Hause ankam, war meine ganze vormittägliche Schönheit verschwunden — hin war der frische Glanz des Zylinders, hin war die Neuheit des schönen Anzugs, verdorben für alle Zeiten die Kravatte, die an Schönheit ihresgleich nicht gehabt hatte und auf die ich stolzer gewesen war, als Napoleon jemals auf eine seiner vielen Eroberungen und Erwerbungen.
Mein einziger Trost war, daß ich den am vorigen Tage gekauften Zylinder noch nicht bezahlt hatte: mit einem höflichen Schreiben schickte ich die Kopfbedeckung an den Hutmacher zurück und bat ihn, mir den Zylinder, der sich als etwas zu eng heraus gestellt hätte, gegen einen etwas weiteren umzutauschen. In etwas anderer Weise als ich gehofft hatte, ging der Mann auf meinen Vorschlag ein, er schickte mir mit dem neuen Hut gleichzeitig den alten zurück, so daß ich nun zwei Zylinder zu bezahlen hatte. Nun konnte ich bei gutem Wetter den einen, bei schlechtem Wetter den anderen tragen, vorsichtshalber kaufte ich mir aber dennoch einen dritten, einen weichen Hut, der bei ganz schlechtem Wetter mein teures Haupt bedecken sollte, denn teuer fing mir mein Schädel nachgerade an zu werden.
„Willst du dir nicht ein paar Gummischuhe und einen Regenschirm kaufen?” fragte mich meine Frau, als ich ihr mittags mein Leid klagte.
Ich lachte laut auf: „Bin ich denn mit meinen dreißig Jahren ein alter Mummelgreis? Nein, an diese beiden Bekleidungs- und Ausrüstungsstücke werde ich mich nie gewöhnen.”
Aber die kleine Frau ließ nicht nach, mir die Vorteile der Gummischuhe im allgemeinen und eines Regenschirmes im besonderen auseinanderzusetzen, ich kämpfte dagegen an mit dem Mute der Verzweiflung, aber was half's? Wenige Tage später feierte ich meinen Geburtstag und erhielt als Geschenk ein paar Galoschen des Glücks und einen Paraplui. Ich müßte die Beredsamkeit des Demosthenes besitzen und mit so glühenden Farben wie Böcklin oder Markart darzustellen vermögen, wenn ich der Schönheit des Regenschirms und seines kunstvoll in Elfenbein geschnitzten Stockes gerecht werden wollte — es war ein Meisterwerk der modernen Schirmbaukunst.
Am nächsten Morgen rief mich ein Telegramm nach Berlin — ich schwor sofort nach Erledigung der geschäftlichen Angelegenheit, spätestens nach achtundvierzig Stunden wieder heimkehren zu wollen und reiste, begleitet von den Segenswünschen der Meinen und bewaffnet mit dem neuen Regenschirm, mit dem ich selbst „Unter den Linden” Aufsehen zu erregen hoffte, von dannen.
Am Nachmittage um fünf Uhr kam ich in der Residenz an, schon nach einer Stunde war das Geschäft erledigt und ich hätte schon abends um acht Uhr wieder fortreisen können.
Ich tat es nicht, ich blieb, denn Berlin ist ein schönes Städtchen.
Ich ließ mich für eine Stunde häuslich am Telefon meines Hotels nieder, telefonierte nach allen Richtungen der Stadt und fand nach langem Suchen endlich einen guten Freund, der sich mit Freuden bereit erklärte, mit mir einen Bummel zu unternehmen. Er holte mich aus meinem Hotel ab und nachdem wir das Wiedersehen durch eine Flasche alten, aber guten Portweins gefeiert hatten, ging die Reise los. Über das „wohin” machten wir uns keine Sorgen, Endpunkt der Reise war für mich ja wieder mein Hotel, die Zwischenstationen würden der Zufall und der Durst uns schon bestimmen.
Ich bin, ohne ein Reisender zu sein, schon viel gereist in meinem Leben und habe vieler Herren Länder gesehen — ich bin oft in meinem Leben durch Berlin gereist, mit der Stadtbahn und der Pferdebahn, mit der Droschke erster und der Droschke zweiter Güte, zu Fuß und per pedes apostolorum, aber eine ähnliche Reise wie an jenem Abend habe ich denn doch noch nicht gemacht.
Als ich am nächsten Morgen im Hotel erwachte, war ich tot, vollständig tot. Ich klngelte den Kellner, der gleich darauf ins Zimmer stürzte.
„Sie wünschen, mein Herr?”
„Ein Leichenbegängnis erster Klasse und Mitteilung an meine Familie, daß ich gestorben bin. Hier, nehmen Sie dies für Ihre Bemühungen.”
Ich nahm das Portemonnaie zur Hand, um ihm einen Obolus in die Hand zu drücken, meine Augen konnten nichts sehen.
Ich reichte ihm die Börse: „Bitte, nehmen Sie sich ein Goldstück.”
Er machte eine tadellose Verbeugung und suchte und suchte, endlich sprach er mit hohler Grabesstimme: „Das Portemonnaie ist ganz leer.”
Da werde ich mit einem Male wieder lebendig, ich sprang aus dem Bett, stürzte in die Kleider und hielt meinen Kopf eine halbe Stunde unter Wasser. Nun war ich wieder Mensch, nun konnte ich wieder sehen, aber es nützte nichts, das Portemonnaie war leer. Die Verzweiflung packte mich, ich suchte in allen Hosen-, Westen-, Rock- und Paletottaschen, endlich stellte ich mich mit Hilfe des Kellners auf den Kopf und zur beiderseitigen großen Freude fiel etwas klirrend auf die Erde; schnell bückten wir uns, als ich wieder auf den Beinen stand — es war mein Uhrglas.
Erfreulich war die Entdeckung ja gerade nicht, ohne Geld kann der Mensch selbst in Berlin nicht leben und so entschloß ich mich, dann gleich nach dem Frühstück zu einem Bankhause zu gehen, mit dem ich in Verbindung stehe, und mir die Taschen wieder füllen zu lassen.
Als ich auf die Straße trat, regnete es.
„Befehlen der Herr Baron einen Wagen?” fragte der freundliche Portier.
Schon wollte ich mit einem lauten, vernehmlichen „Ja” antworten, da fiel mir meine traurige Finanzlage ein und so antwortete ich eben, obgleich das Bankhaus eine gute halbe Stunde entfernt war: „Nein, ich danke, ich habe nur ein paar Schritt, aber Sie können mir einen Regenschirm aus meinem Zimmer holen lassen.”
Der Portier klingelte dem Hausknecht, der Hausknecht bestellte es dem Oberkellner, der Oberkellner sagte es dem Zimmerkellner, dieser beauftragte den Piccolo, dieser wandte sich vertrauensvoll an das Zimmermädchen: für sie alle hieß die Parole: den Regenschirm auf Nr. 6.
Die Erledigung selbst der einfachsten Sache auf dem Instanzenwege dauert immer lange, so wartete ich denn mit wahrer Engelsgeduld eine Viertelstunde nach der anderen.
Endlich kam der Hausknecht zurück: der Regenschirm wäre nicht da.
„Schafskopf,” sprach ich halblaut vor mich hin, dann ging ich selbst in mein Zimmer, begleitet von allen, die bei meiner Abreise ein gutes Trinkgeld erhofften — ach, es waren ihrer viele. Wir durchsuchten die ganze Stube, im Bett und unter dem Bett, unter der Tischdecke und im Wasserglas, im Stiefelknecht und im Kleiderschrank, im Ofen und im Spucknapf, überall sahen wir nach, vergebens.
Wo war er?
„Der Herr Baron haben den Schirm gestern abend sicher irgendwo stehen lassen,” bemerkte endlich der kluge und Welt und Menschen kennende Portier.
Ich fiel vor Schreck beinahe an die Wand, dann eilte ich ans Telefon, um mich mit meinem Kneipgenossen von gestern Abend verbinden zu lassen. Endlich hatte ich ihn, wenn auch nur bildlich gesprochen, an den Ohren.
„Um zwölf Uhr muß ich dich unbedingt sprechen,” rief ich ihm zu.
„Ich kann nicht, habe keine Zeit.”
„Du mußt, Näheres mündlich, Rendez-vous im Restaurant „Zum Pilsener”, Unter den Linden.”
Das Pilsener lockte ihn mehr als meine Gesellschaft, so sagte er denn zu und ich eilte davon, um mir Geld zu besorgen. Mit einem der mit Recht so beliebten Sepiascheine in der Tasche betrat ich pünktlich das Restaurant, wo der Freund meiner wartete. Hätte ich nicht gewußt, daß er Baumbach hieße, so hätte ich geglaubt, „Freund Hein” säße dort am Tisch — er sah aus wie der Tod.
„Mensch, was habe ich für einen Jammer,”redete er mich an.
„Herzlichen Dank für diese Mitteilung,” gab ich zur Antwort, „nun aber gib mir Antwort, wo sind wir gestern Abend gewesen?”
Mit stieren, verglasten Augen sah er mich an, dann stützte er das schwere Haupt auf beide Hände und sprach in unnennbarem Weh: „Weiß ich's?”
„Du mußt es wissen,” erwiderte ich, dann schilderte ich ihm meine Lage: „Dem Gelde will ich keine Thräne nachweinen, denn den Hundertmarkscheinen sieht man es nicht an, ob es dieselben sind, die ich von Hause mitnahm oder andere. Den Schirm aber muß ich wiederhaben, meine Frau würde es mir nie verzeihen, wenn ich ohne ihn zurückkäme, sie würde mit Recht vermuten, daß ich etwas viel gekneipt hätte und mich des Lokals nicht erinnerte, in dem ich gewesen bin — so etwas soll ja zuweilen vorkommen, aber man darf es nicht zugeben, das schädigt die häusliche Autorität.”
„Wollen wir ihn heute Abend suchen?” fragte der Freund, „wenn wir alle Restaurants Berlins absuchen, finden wir ihn vielleicht.”
Abwehrend erhob ich beide Hände. „Nein, lieber Freund, daraus wird nichts, ich habe an dem gestrigen Tage mehr als genug, lieber reise ich ohne Schirm zurück — halt, ich habe es, ich behaupte einfach, ich hätte den Schirm gar nicht mitgenommen, dann kann niemand behaupten, ich hätte ihn stehen lassen.”
Und so geschah es.
Wohlbehalten langte ich zu Hause wieder an und wurde von meiner Frau sehr belobt, als ich so viel Geld wieder mit zurückbrachte, ja, ja, man muß sich zu helfen wissen.
Am nächsten Tage rüstete ich mich mittags zu meinem gewöhnlichen Spaziergange, der Regenschirm war nicht da, ich alarmierte das ganze Haus, wir suchten und suchten, vergebens.
„Das ist mir ganz unbegreiflich,” sagte meine Frau. „Hast du ihn denn auch aus Berlin wieder mitgebracht?”
„Aber Kind, ich habe ihn ja gar nicht mitgehabt; um ihn auf der Reise nicht zu verlieren, ließ ich ihn absichtlich zurück, ebenso wie die schönen Gummischuhe — die Galoschen stehen da (ich dankte dem Himmel, daß ich sie in diesem Augenblick entdeckte) aber der Schirm ist weg, einfach weg.”
Und er blieb verschwunden, obgleich täglich das ganze Haus nach ihm abgesucht wurde.
So waren sechs Wochen vergangen, der Schirm war immer noch fort, da fragte mich meine Frau eines Mittags: „Kennst du in Berlin die Blumensäle?”
„Na und ob,” wollte ich antworten, aber ich besann mich und sagte: „Dagewesen bin ich schon einmal, früher, vor vielen Jahren.”
„Ist es ein nettes Restaurant?”
„Riesig nett,” verplapperte ich mich, „das heißt,” setzte ich hinzu, „es ist für Junggesellen recht amüsant, sich das Leben und Treiben dort einmal anzusehen, für Verheiratete aber ist es kein Lokal, weder mit noch ohne ihre Frauen. Wie kommst du übrigens auf die Blumensäle?”
„Ach, nur durch Zufall. Heute Morgen hat der Oberkellner aus den Blumensälen deinen Regenschirm wiedergeschickt, er schreibt, er hätte dich Abend für Abend vergebens erwartet, um dir dein Eigentum wieder einhändigen zu können, jetzt schickt er ihn dir, da er zufällig auf dem silbernen Ring, den ich am Schirm anbringen ließ, deinen Namen und deinen Wohnort eingraviert gefunden habe, er bitte dich, falls du wider Erwarten nicht der richtige Empfänger sein solltest, den wertvollen Schirm wieder an ihn zurückzusenden. Er hofft dich bald wieder in Berlin begrüßen zu dürfen und versichert, daß es ihm eine besondere Ehre sein werde, dir wieder im chambre separée servieren zu dürfen!”
Ich glaube, ich habe bei dieser Mitteilung ein unglaublich dummes Gesicht gemacht, nun half alles nichts mehr, ich mußte beichten.
Und während die Lippen schworen, daß ich mich bessern wollte, schwor ich in meinem Innern, nie wieder einen Regenschirm oder einen Spazierstock zu tragen, der wieder zum Verräter werden könnte.
Und den Schwur habe ich gehalten.
„Svenska Tidningen” 28.8.1919: