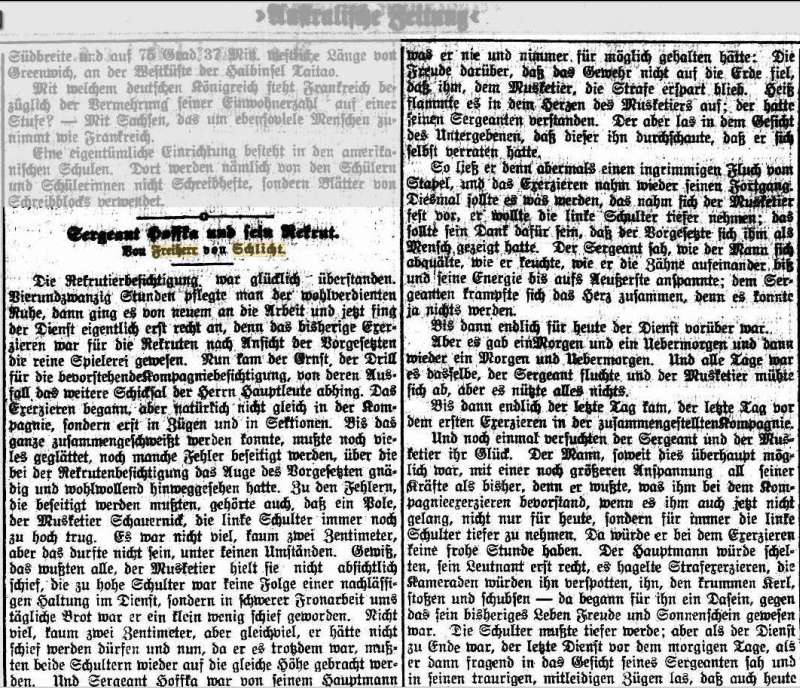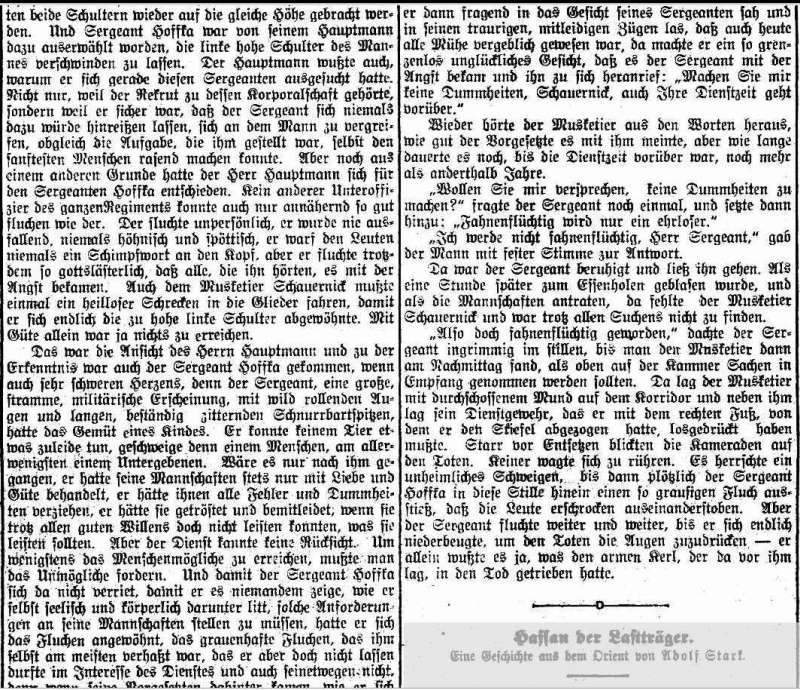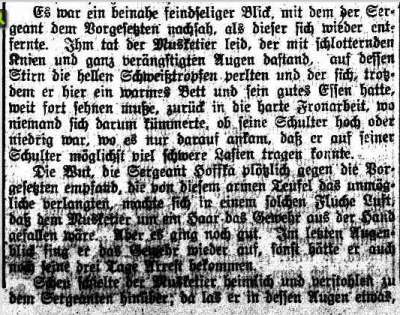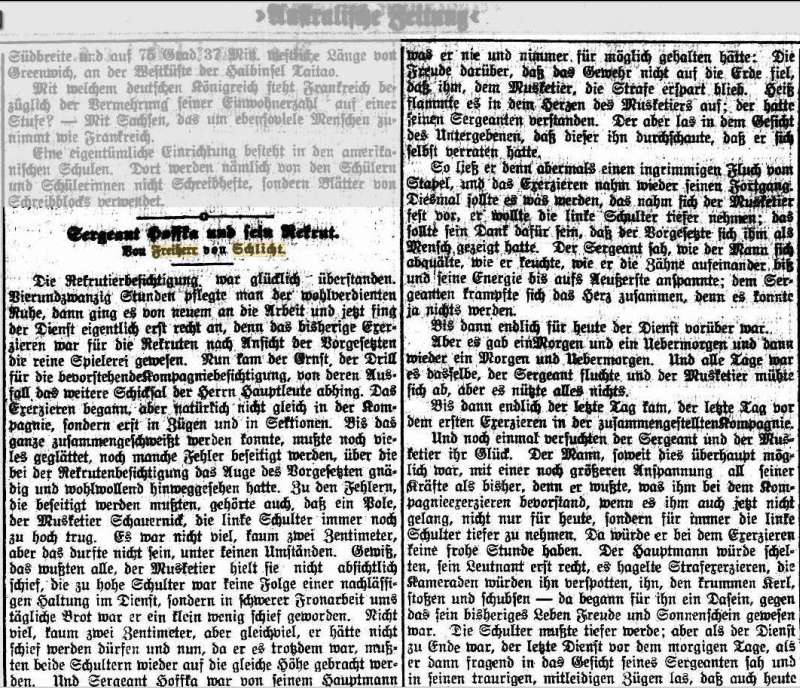
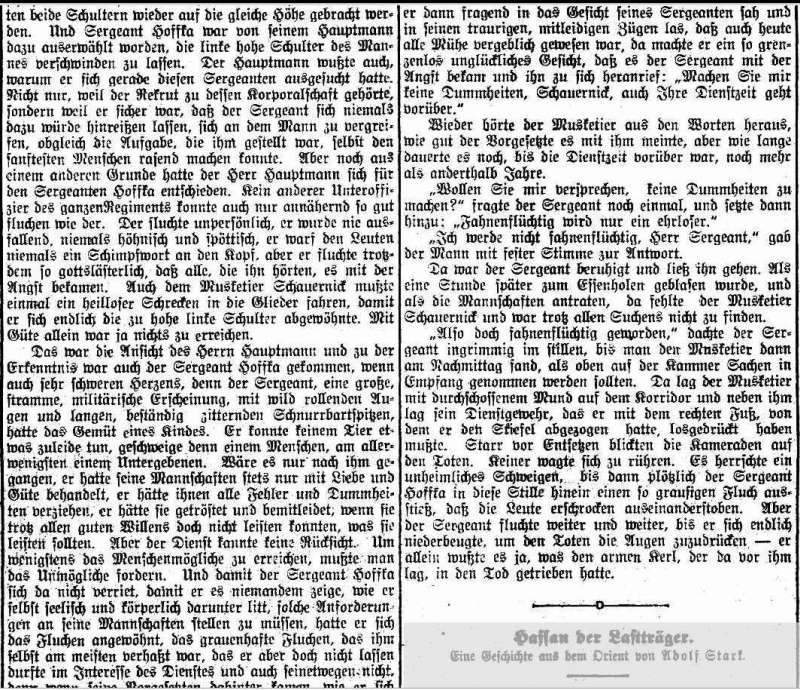

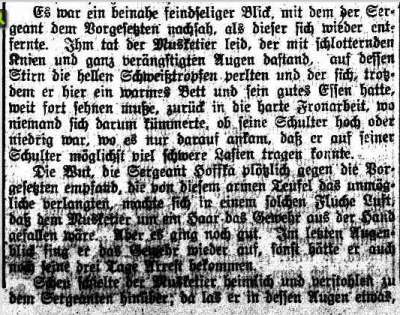
Militär-Erzählung von Freiherr von Schlicht,
in: „Australische Zeitung” (Adelaide) vom 8.12.1915
in: „Der rote Pierrot”
Die Rekrutenbesichtigung war glücklich überstanden. Vierundzwanzig Stunden pflegte man der wohlverdienten Ruhe, dann ging es von neuem an die Arbeit, und jetzt fing der Dienst eigentlich erst recht an, denn das bisherige Exerzieren war für die Rekruten nach Ansicht der Vorgesetzten die reine Spielerei gewesen. Nun kam der Ernst, der Drill für die bevorstehende Kompagniebesichtigung, von deren Ausfall das weitere Schicksal der Herren Hauptleute abhig. Das Exerzieren begann, aber natürlich nicht gleich in der Kompagnie, sondern erst in Zügen und in Sektionen. Bis das ganze zusammengeschweißt werden konnte, mußte noch vieles geglättet, noch manche Fehler beseitigt werden, über die bei der Rekrutenbesichtigung das Auge des Vorgesetzten gnädig und wohlwollend hinweggesehen hatte. Zu den Fehlern, die beseitigt werden mußten, gehörte auch, daß ein Pole, der Musketier Schauernick, die linke Schulter immer noch zu hoch trug. Es war nicht viel, kaum zwei Zentimeter, aber das durfte nicht sein, unter keinen Umständen. Gewiß, das wußten alle, der Musketier hielt sie nicht absichtlich schief, die zu hohe Schulter war keine Folge einer nachlässigen Haltung im Dienst, sondern in schwerer Fronarbeit ums tägliche Brot war er ein klein wenig schief geworden. Nicht viel, kaum zwei Zentimeter, aber gleichviel, er hätte nicht schief werden dürfen, und nun, da er es trotzdem war, mußten beide Schultern wieder auf die gleiche Höhe gebracht werden.
Und Sergeant Hoffka war von seinem Hauptmann dazu ausgewählt worden, die linke Schulter des Mannes verschwinden zu lassen. Der Hauptmann wußte auch, warum er sich gerade diesen Sergeanten ausgesucht hatte. Nicht nur, weil der Rekrut zu dessen Korporalschaft gehörte, sondern weil er sicher war, daß der Sergeant sich niemals dazu würde hinreißen lassen, sich an dem Mann zu vergreifen, obgleich die Aufgabe, die ihm gestellt war, selbst den sanftesten Menschen rasend machen konnte. Aber noch aus einem anderen Grunde hatte der Herr Hauptmann sich für den Sergeanten Hoffka entschieden. Kein anderer Unteroffizier des ganzen Regiments konnte nur annähernd so gut fluchen wie der. Der fluchte unpersönlich, er wurde nie ausfallend, niemals höhnisch und spöttisch, er warf den Leuten niemals ein Schimpfwort an den Kopf, aber er fluchte trotzdem so gottslästerlich, daß alle, die ihn hörten, es mit der Angst bekamen. Auch dem Musketier Schauernick mußte einmal ein heilloser Schrecken in die Glieder fahren, damit er sich endlich die zu hohe linke Schulter abgewöhnte. Mit Güte allein war ja nichts zu erreichen.
Das war die Ansicht des Herrn Hauptmanns, und zu der Erkenntnis war auch der Sergeant Hoffka gekommen, wenn auch sehr schweren Herzens, denn der Sergeant, eine große, stramme, militärische Erscheinung, mit wild rollenden Augen und langen, beständig zitternden Schnurrbartspitzen, hatte das Gemüt eines Kindes. Er konnte keinem Tier etwas zuleide tun, geschweige denn einem Menschen, am allerwenigsten einem Untergebenen. Wäre es nur nach ihm gegangen, er hätte seine Mannschaften stets nur mit Liebe und Güte behandelt, er hätte ihnen alle Fehler und Dummheiten verziehen, er hätte sie getröstet und bemitleidet, wenn sie trotz alllen guten Willens doch nicht leisten konnten, was sie leisten sollten. Aber der Dienst kannte keine Rücksichten. Um wenigstens das Menschenmöglichste zu erreichen, mußte man das Unmögliche fordern. Und damit der Sergeant Hoffka sich da nicht verriet, damit er es niemandem zeige, wie er selbst seelisch und körperlich darunter litt, solche Anforderungen an seine Mannschaften stellen zu müssen, hatte er sich das Fluchen angewöhnt, das grauenhafte Fluchen, das ihm selbst am meisten verhaßt war, das er aber doch nicht lassen durfte im Interesse des Dienstes und auch seinetwegen nicht, denn wenn seine Vorgesetzten dahinter kamen, wie er sich fortwährend verstellen mußte, um den strengen Vorgesetzten zu spielen, dann hätte kein Hauptmann weiter mit ihm kapituliert.
Sergeant Hoffka hatte das Gemüt eines Kindes, und als der Musketier Schauernick nun vor ihm stand, betrachtete er ihn mitleidig. Der Musketier war ein mittelgroßer, strammer Bengel, mit einem hübschen Gesicht und ein Paar unendlich traurigen Augen, denen man es ansah, daß der Mann bisher in seinem Leben nicht allzu viel Freude kennen gelernt hatte. Und jetzt heftete er diese Augen auf den Vorgesetzten mit einem Blick, der zu sagen schien: „Ich flehe dich an, mißbrauche deine Macht, die du über mich hast, nicht allzusehr.”
„Ginge es nach mir, mein Junge,” hätte der Sergeant am liebsten geantwortet, „dann würde ich dich sofort vom Militär entlassen, denn du bist schief und wirst es bis an dein Lebensende bleiben. Ebensowenig wie man dem Elefanten seinen Rüssel, dem Dromedar seinen Höcker nehmen kann, ebenso wenig wird es jemals gelingen, dir deine schiefe Schulter wegzubringen. Aber trotzdem, der Versuch muß gemacht werden, der Dienst verlangt es.” Und so fuhr denn dem armen Musketier als Einleitung ein derartiges Donnerwetter an den Kopf, daß der sich sagte: „Die Menschen wissen nicht, was Mitleid und Erbarmen ist.”
Dann begannn das Exerzieren, das eigentlich nur in der fortwährenden Ermahnung bestand: „Schauernick, nehmen Sie die linke Schulter tiefer.” Aber die linke Schulter blieb da, wo sie war, denn wenn er sie wirklich einmal tiefer nahm, konnte er das nur dadurch, daß er die rechte Schulter zu hoch zog, und dann hieß es sofort: „Die rechte Schulter tiefer, die linke höher.” Und nahm er die linke höher, dann war sie wieder zu hoch. Da halfen selbst die schauerlichsten Flüche nichts, das sah der Sergeant Hoffka ein, aber um es nicht auch dem Musketier eingestehen zu müssen, fluchte er erst recht. Der Hauptmann, der in der Nähe stand, trat auf den Sergeanten zu und sagte: „So ist's recht, mit Güte allein ist nichts zu erreichen.”
Es war ein beinahe feindseliger Blick, mit dem der Sergeant dem Vorgesetzten nachsah, als dieser sich wieder entfernte. Ihm tat der Musketier leid, der mit schlotternden Knien und ganz verängstigten Augen dastand, auf dessen Stirn die hellen Schweißtropfen perlten, und der sich, trotzdem er hier sein warmes Bett und sein gutes Essen hatte, weit fort sehnen mußte, zurück in die harte Fronarbeit, wo niemand sich darum kümmerte, ob seine Schulter hoch oder niedrig war, wo es nur darauf ankam, daß er auf seiner Schulter möglichst viel schwere Lasten tragen konnte.
Die Wut, die Sergeant Hoffka plötzlich gegen die Vorgesetzten empfand, die von diesem armen Teufel das unmögliche verlangten, machte sich in einem solchen Fluche Luft, daß dem Musketier um ein Haar das Gewehr aus der Hand gefallen wäre. Abr es ging noch gut. Im letzten Augenblick fing er das Gewehr wieder auf, sonst hätte er auch noch seine drei Tage Arrest bekommen.
So schielte der Musketier heimlich und verstohlen zu dem Sergeanten hinüber; da las er in dessen Augen etwas, was er nie und nimmer für möglich gehalten hätte: Die Freude darüber, daß das Gewehr nicht auf die Erde fiel, daß ihm, dem Musketier, die Strafe erspart blieb. Heiß flammte es in dem Herzen des Musketiers auf; der hatte seinen Sergeanten verstanden. Der aber las in dem Gesicht des Untergebenen, daß dieser ihn durchschaute, daß er sich selbst verraten hatte.
So ließ er denn abermals einen ingrimmigen Fluch vom Stapel, und das Exerzieren nahm wieder seinen Fortgang. Diesmal sollte es was werden, das nahm sich der Musketier fest vor, er wollte die linke Schulter tiefer nehmen; das sollte sein Dank dafür sein, daß der Vorgesetzte sich ihm als Mensch gezeigt hatte. Der Sergeant sah, wie der Mann sich abquälte, wie er keuchte, wie er die Zähne aufeinander biß und seine Energie bis aufs äußerste anspannte; dem Sergeanten krampfte sich das Herz zusammen, denn es konnte ja nichts werden.
Bis dann endlich für heute der Dienst vorüber war.
Aber es gab ein Morgen und ein Übermorgen, und dann wieder ein Morgen und Übermorgen. Und alle Tage war es dasselbe, der Sergeant fluchte und der Musketier mühte sich ab, aber es nützte alles nichts.
Bis dann endlich der letzte Tag kam, der letzte vor dem ersten Exerzieren in der zusammengestellten Kompagnie.
Und noch einmal versuchten der Sergeant und der Musketier ihr Glück. Der Mann, soweit dies überhaupt möglich war, mit einer noch größeren Anspannung all seiner Kräfte als bisher, denn er wußte, was ihm bei dem Kompagnieexerzieren bevorstand, wenn es ihm auch jetzt nicht gelang, nicht nur für heute, sondern für immer die linke Schulter tiefer zu nehmen. Da würde er bei dem Exerzieren keine frohe Stunde haben. Der Hauptmann würde schelten, sein Leutnant erst recht, es hagelte Strafexerzieren, die Kameraden würden ihn verspotten, ihn, den krummen Kerl, stoßen und schubsen — da begann für ihn ein Dasein, gegen das sein bisheriges Leben Freude und Sonnenschein gewesen war. Die Schulter mußte tiefer werden; aber als der Dienst zu Ende war, der letzte Dienst vor dem morgigen Tag, als er dann fragend in das Gesicht seines Sergeanten sah, und in seinen traurigen, mitleidigen Zügen las, daß auch heute alle Mühe vergeblich gewesen war, da machte er ein so grenzenlos unglückliches Gesicht, daß es der Sergeant mit der Angst bekam und ihn zu sich heranrief: „Machen Sie mir keine Dummheiten, Schauernick, auch Ihre Dienstzeit geht vorüber.”
Wieder hörte der Musketier aus den Worten heraus, wie gut der Vorgesetzte es mit ihm meinte, aber, wie lange dauerte es noch, bis die Dienstzeit vorüber war, noch mehr als anderthalb Jahre.
„Wollen Sie mir versprechen, keine Dummheiten zu machen?” fragte der Sergeant noch einmal, und setzte dann hinzu: „Fahnenflüchtig wird nur ein Ehrloser.”
„Ich werde nicht fahnenflüchtig, Herr Sergeant,” gab der Mann mit fester Stimme zur Antwort.
Da war der Sergeant beruhigt und ließ ihn gehen. Als eine Stunde später zum Essenholen geblasen wurde, und als die Mannschaften antraten, da fehlte der Musketier Schauernick, und war trotz allen Suchens nicht zu finden.
„Also doch fahnenflüchtig geworden,” dachte der Sergeant ingrimmig im stillen, bis man den Musketier dann am Nachmittag fand, als oben auf der Kammer Sachen in Empfang genommen werden sollten. Da lag der Musketier mit durchschossenem Mund auf dem Korridor und neben ihm lag sein Dienstgewehr, das er mit dem rechten Fuß, von dem er den Stiefel abgezogen hatte, losgedrückt haben mußte. Starr vor Entsetzen blickten die Kameraden auf den Toten. Keiner wagte sich zu rühren. Es herrschte ein unheimliches Schweigen, bis dann plötzlich der Sergeant Hoffka in diese Stille hinein einen so grausigen Fluch ausstieß, daß die Leute erschrocken auseinanderstoben. Aber der Sergeant fluchte weiter und weiter, bis er sich endlich niederbeugte, um dem Toten die Augen zuzudrücken — er allein wußte es ja, was den armen Kerl, der da vor ihm lag, in den Tod getrieben hatte.
„Australische Zeitung” (Adelaide) vom 8.12.15: