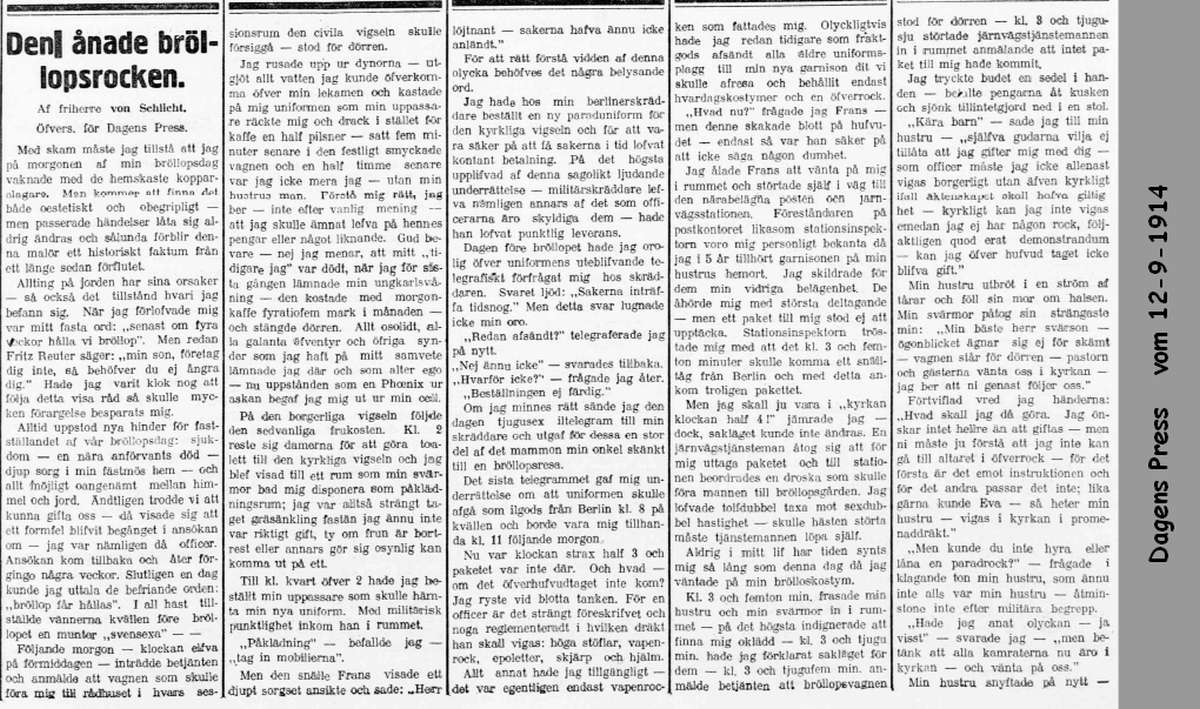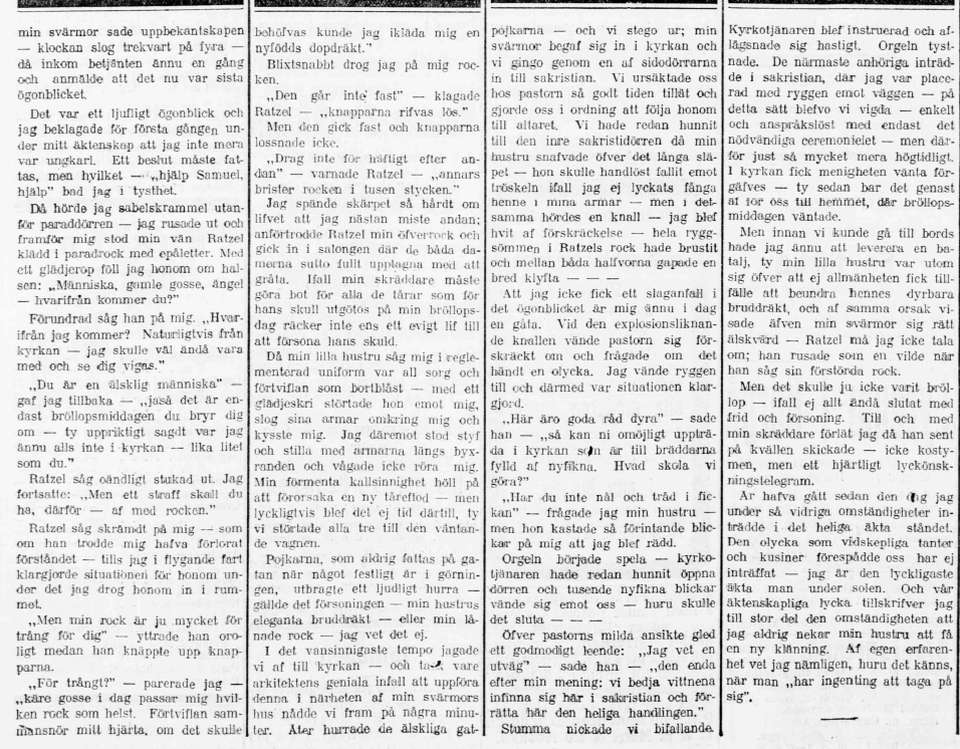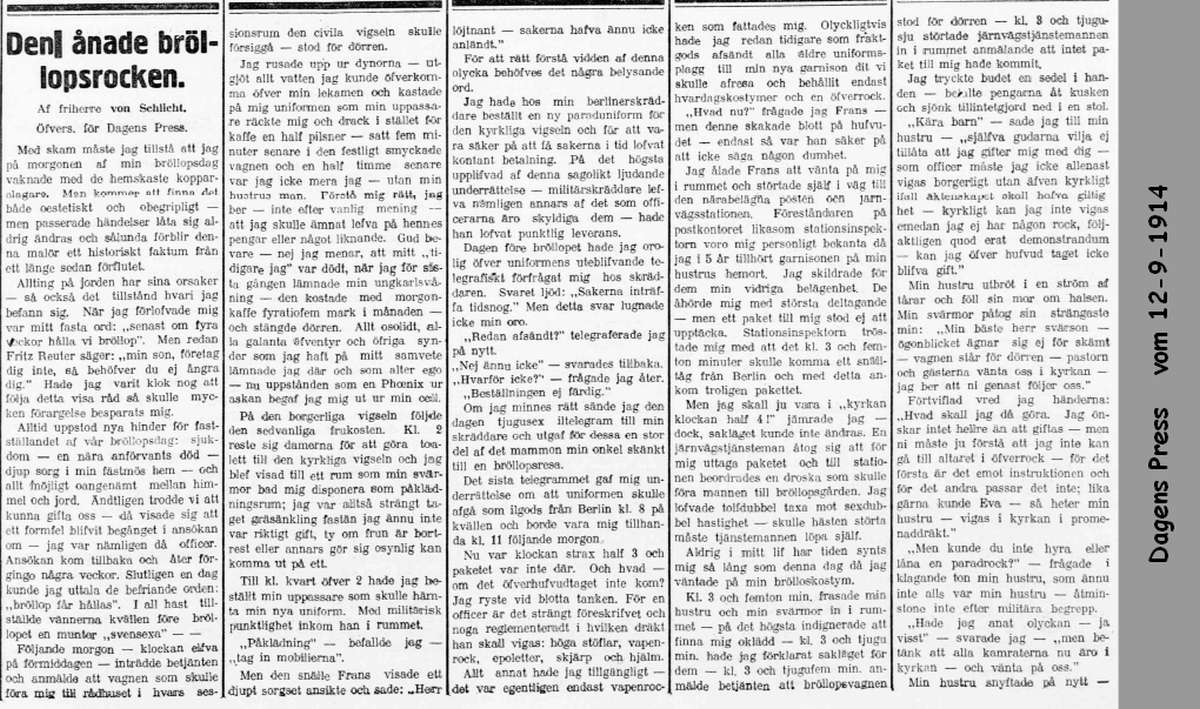
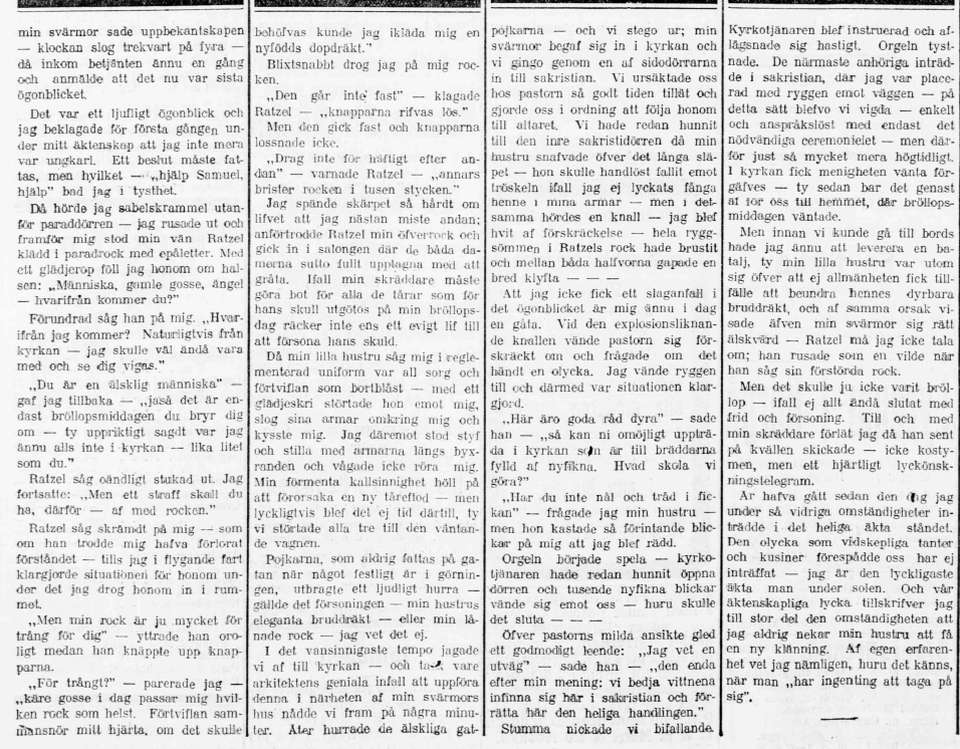
Humoreske von Graf Günther Rosenhagen.
in: „Düna-Zeitung” vom 20.3.1896,
in: „Leipziger Tageblatt und Anzeiger” Nr. 162 vom 30.März 1896,
in: „General-Anzeiger für Hamburg-Altona” vom 5.April 1896,
in: „Trierische Landeszeitung” vom 2.1.1897,
in: „Neues Wiener Journal” vom 24.8.1898,
in: „Sonntagsblatt” Jhrgg. 1899, Nr. 36,
Beilage zur „Güstrower Zeitung” vom 10.9.1899,
in: „Dagens Press” vom 12.9.1914 unter dem Titel „Den ånade bröllopsrocken” und
in: Ehestandshumoresken
Zu meiner Schande sei es bekannt: als ich an meinem Hochzeitstag Morgens erwachte, hatte ich einen mordsmäßigen Katzenkammer. Man wird es vielleicht unästhetisch und unbegreiflich finden, aber geschehene Dinge lassen sich leider nicht rückgängig machen, und so bleibt mein Jammer historisch bestehen, wenngleich er schon lange verflogen ist.
Ein jedes Ding auf Erden hat bekanntlich auch seine Ursache, so auch die Stimmung, in der ich mich an jenem Morgen befand. Als ich mich verlobt hatte, war mein erstes Wort, als ich auch beim besten Willen nicht mehr küssen konnte. „In spätestens vier Wochen wird geheirathet.” Aber schon Fritz Reuter sagt: „Min Söhn, nimm Di nicks vör, denn geiht Di nicks fehl.” Hätte ich nach diesem weisen Rath gehandelt, so wäre mir viel Aerger und Verdruß erspart geblieben. Immer neue Hindernisse traten der Festsetzung des Hochzeitstages entgegen; Krankheit, Tod eines nahen Verwandten, Trauer und was es sonst noch Unangenehmes auf dieser Welt giebt. Endlich glaubten wir, heirathen zu können, da stellte es sich heraus, daß bei dem eingereichten Gesuch um Ertheilung des Consenses — ich war damals noch Officier — ein Formfehler sich eingeschlichen habe. Das Gesuch kam zurück — wieder vergingen Wochen und endlich wurde das erlösende Wort gesprochen: „Morgen wird geheirathet.” Na, das mußte ja am Vorabend gefeiert werden und so kam denn, was nach dem alten Wort kommen mußte: „Auf Sonnenschein folgt Regen, auf Glück und Freund' — Jammer und Noth.”
Um 11 Uhr Morgens trat der Lohndiener zu mir ins Zimmer und meldete, der Wagen, der mich zum Standesamt fahren sollte, stände vor der Thür. Ich sprang aus den Kissen, goß alles Wasser, dessen ich habhaft werden konnte, über meine sterblichen Gliedmaßen, schlüpfte in die Uniform, die mein Bursche mir entgegen hielt, trank anstatt des Kaffees eine Flasche Pilsener Bier, saß fünf Minuten später in dem festlich geschmückten Wagen und eine halbe Stunde später war ich nicht mehr ich, sondern der Mann meiner Frau. Ich bitte dies richtig verstehen zu wollen und nicht in dem gewöhnlichen Sinn, als ob ich fortan die Absicht gehabt hätte, von dem Gelde meiner Frau zu leben und auf der ganzen weiten Welt sonst nichts zu thun. Um Gottes Willen nicht — aber das „Ich”, das ich früher gewesen, war gestorben, als ich zum letzten Mal die Thür meiner Junggesellenwohnung — sie kostete mit Morgenkaffee fünfundvierzig Mark monatlich — hinter mir zumachte. Alles was ich an Unsolidität, galanten Abenteuern und sonstigen Schlechtigkeiten auf dem Gewissen hatte, blieb hinter mir liegen und als alter ego, neu erstanden wie ein Phönix aus der Asche, ging ich aus meiner Klause heraus.
Der standesamtlichen Trauung folgte das übliche Frühstück. Um 2 Uhr erhoben sich die Damen, um für die kirchliche Feier Toilette zu machen, und ich blieb allein in dem mir zum Ankleiden überwiesenen Zimmer im Hause meiner Schwiegereltern zurück — ich war also streng genommen schon Strohwittwer, bevor ich ordentlich verheirathet war, denn ob die Frau verreist oder für den Mann nicht sichtbar ist, bleibt sich doch ganz gleich.
Um ein Viertel nach 2 Uhr hatte ich mir meinen Diener bestellt, der mir die neuen Uniformen bringen sollte. Mit militairischer Pünctlichkeit trat er in mein Zimmer.
„Anziehen,” befahl ich, „hole die Sachen herein.”
Aber der gute Franz machte ein sehr trauriges Gesicht und sagte: „Herr Lieutenant, die Sachen sind immer noch nicht angekommen.”
Um das ganze Unglück dieser Botschaft zu begreifen, bedarf es einiger erläuternder Worte.
Ich hatte mir bei meinem Berliner Schneider für die kirchliche Trauung einen neuen Paradeanzug bestellt und, um ganz sicher zu sein, die Sachen rechtzeitig zu erhalten, sofortige Baarzahlung versprochen. Hoch erfreut über diese ihm märchenhaft klingende Nachricht — Militairschneider leben nur von Dem, was Andere ihnen schulden — hatte er pünctliche Lieferung versprochen. Am Tage vor meiner Hochzeit war ich über das Ausbleiben der Uniforman beunruhigt worden und hatte telegraphisch angefragt. „Sachen treffen rechtzeitig ein”, lautete die Antwort. Das aber beruhigte mich nicht.
„Schon abgeschickt?” fragte ich per Draht an.
„Nein, noch nicht,” lautete der Bescheid.
„Warum nicht?” erkundigte ich mich.
„Weil noch nicht fertig,” kam es telegraphisch zurück.
Wenn ich mich recht entsinne, wechselte ich an diesem Tag mit meinem Schneider sechsundzwanzig Eiltelegramme und verausgabte dafür einen nicht unbeträchtlichen Theil des mir von meinem guten Onkel für die Hochzeitsreise gespendeten Mammons.
Das letzte Telegramm brachte mir den Bescheid, daß die Uniformen Abends um 8 Uhr als Eilgut von Berlin abgehen und am nächsten Morgen um 11 Uhr in meinen Händen sein würden.
Und nun war es gleich ein halb 3 Uhr und das Packet war noch nicht da. Was nun, wenn es überhaupt nicht kam? Für den Officier ist ganz genau der Anzug vorgeschrieben, in dem er sich trauen lassen muß; hohe Stiefel, Waffenrock, Epaulettes, Schärpe und Helm. Alles hatte ich — nur keinen Waffenrock. Ich hatte alle meine Uniformen bereits als Frachtgut in meine neue Garnison, in die ich versetzt worden war, geschickt, nur einen Ueberrock für die standesamtliche Feier hatte ich zurückbehalten.
„Was nun?” fragte ich Franz — der aber schüttelte nur sein Haupt, da war er wenigstens sicher, keine Dummheit zu sagen.
Ich gebot Franz, hier im Zimmer auf mich zu warten und stürzte dann zu der nahe gelegenen Post und dem ebenfalls nur eine kleine Viertelstunde entfernten Bahnhof. Dem mir persönlich bekannten Postdirector und dem Statiosnvorsteher — ich hatte fünf jahre in der Geburtsstadt meiner Frau in Garnison gestanden — schilderte ich meine Noth. Theilnehmend hörten sie mir zu — aber ein Packet war für mich nicht da. Aber es konnte noch kommen — um drei Uhr fünfzehn Minuten kam der Schnellzug von Berlin, der würde sicher das Packet mitbringen, und ich sollte es dann sofort erhalten.
„Aber um halb vier Uhr muß ich ja schon in der Kirche sein!” jammerte ich; doch es ließ sich nichts ändern. Ich bestellte am Bahnhof eine Droschke, die den Auftrag erhielt, den Bahnbeamten, der im Voraus bestimmt wurde, mir das Packet zu bringen, mit sechsfacher Geschwindigkeit gegen zwölffache Taxe vor das Haus zu fahren. Sollte der Gaul unterwegs stürzen, so sollte der Beamte sofort aus dem Wagen springen und sich lieber auf seine, als des Pferdes Beine verlassen. Für den Fall, daß auch ihm ein Unglück zustieße, stellte ich ein Relais von Dienstleuten, die einander das Packet zuwerfen sollten, der Letzte sollte es mir in die Stube bringen.
Nie wieder ist mir die Zeit so langsam vergangen, wie an diesem Nachmittag, da ich voll Ungeduld auf mein hochzeitlich Gewand wartete.
Um drei Uhr fünfzehn Minuten rauschten meine Frau und meine Schwiegermutter in mein Zimmer und waren auf das Höchste erstaunt, mich noch nicht angezogen zu finden, um drei Uhr zwanzig hatte ich ihnen den Sachverhalt erklärt, um drei Uhr fünfundzwanzig meldete der Diener, der Hochzeitswagen stände vor der Thür und um drei Uhr siebenundzwanzig stürzte der Bahnbeamte zu mir ins Zimmer mit der Meldung, es sei kein Packet für mich angekommen!
Ich drückte dem Boten den versprochenen Lohn und das Geld für den Kutscher in die Hand und sank dann vernichtet auf einen Stuhl.
„Liebes Kind,” sprach ich zu meiner Frau, „die Götter wollen es nicht, daß ich Dich heirathe. Als Officier muß ich nicht nur standesamtlich, sondern auch kirchlich getraut sein, wenn die Ehe Giltigkeit haben soll — kirchlich trauen lassen kann ich mich aber nicht, weil ich keinen Rock habe, folglich — quod erat demonstrandum — kann ich Dich überhaupt nicht heirathen.”
Meine Frau brach in einen Thränenstrom aus und fiel ihrer Mutter um den Hals, die ihre strengste Miene aufsetzte.
„Mein lieber Herr Schwiegersohn &mdash, ich glaube, der Zeitpunct ist zum Scherzen schlecht gewählt — der Wagen steht vor der Thür, der Pastor wartet in der Kirche, ich bitte, daß Sie uns begleiten.”
Verzweifelt rang ich die Hände: „Aber was soll ich denn nur machen? Ich wünsche nichts sehnlicher, als zu heirathen — aber Ihr müßt doch selbst einsehen, daß ich nicht im Ueberrock gehen kann, erstens ist das gegen die Vorschrift und zweitens schickt sich das nicht, ebenso gut könnte Anna” — so heißt meine Frau — „im Straßenkostüm in die Kirche gehen.”
„Könntest Du Dir nicht einen Waffenrock leihen?” fragte klagend meine Frau, die eigentlich noch gar nicht meine Frau war, wenigstens nach militairischen Begriffen noch nicht.
„Hätte ich das Unglück kommen sehen — gewiß,” gab ich zurück, „aber bedenke, die Kameraden sind jetzt schon alle in der Kirche und warten auf uns.”
Meine Frau schluchzte erneut auf — meine Schwiegermutter verleugnete meine Bekanntschaft — die Uhr schlug 3/44 und der Lohndiener kam, um zu melden, daß es nun aber wirklich die höchste Zeit sei.
Es war ein Augenblick der höchsten Wonne und ich beklagte zum ersten Mal in meiner Ehe nicht mehr Junggeselle zu sein. Ein Entschluß mußte gefaßt werden, aber welcher? „Hilf, Samiel, hilf,” bat ich im Stillen.
Da hörte ich auf den Fliesen der Hausdiele Schritte und Säbelgerassel. Ich stürzte hinaus und vor mir stand mein Freund Ratzel in Waffenrock und Epaulettes. Mit einem Freudenschrei fiel ich ihm um den Hals: „Mensch, Knabe, Engel, wo kommst Du her?”
Verwundert sah er mkich an: „Wo ich herkomme? Natürlich aus der Kirche, ich mußte doch dabei sein, wenn Du getraut wurdest.”
„Du bist ein Gemüthsmensch,” gab ich zurück, „also nur um das hochzeitliche Diner ist es Dir zu thun, denn, im Vertrauen gesagt, ich war noch gar nicht in der Kirche, ebenso wenig wie Du. Strafe aber muß sein und darum: herunter mit dem Rock.”
Ratzel sah mich an, als ob ich blödsinnig wäre, aber mit fliegenden Worten erklärte ich ihm die Situation, während ich ihn in ein Zimmer hineinzog.
„Aber der Rock ist Dir ja viel zu eng,” meinte er, während er die Knöpfe öffnete.
„Zu eng?” versetzte ich, „Liebster, heut paßt mir jeder Rock. Die Verzweiflung schnürt mein Herz zusammen; wenn es sein muß, paßt mir heute das Costüm eines neugeborenen Babys.”
Ich schlüpfte in den Rock hinein. „Er geht nicht zu,” klagte Ratzel, „die Knöpfe reißen,” aber er ging zu, und die Knöpfe rissen nicht.
„Nur nicht Luft holen,” bat Ratzel, „sonst geht der Rock in tausend Stücke.”
Ich band mir die Schärpe so eng um den Leib, daß das Luftholen mir zur vollsten Unmöglichkeit ward, vertraute Ratzel meinen Ueberrock an und ging in die Stube zurück, in der die beiden Damen saßen und weinten. Wenn mein Schneider für jede Thräne, die an meinem Hochzeitstage seinetwegen vergossen worden ist, auch nur eine Secunde büßen soll, so reicht selbst ein ewiges Leben nicht aus, um seine Schuld zu sühnen.
Als meine kleine Frau mich im vorschriftsmäßigen Anzuge vor sich sah, war alles Leid und Ungemach im Augenblick vergessen. Mit einem Freudenschrei stürzte sie auf mich zu, sehnsüchtig breitete sie die Arme nach mir aus: ich aber stand vor ihr still, mit den Händen an der Hosennaht, und wagte mich nicht zu rühren. Meine anscheinende Herzlosigkeit hätte beinahe einen neuen Thränenstrom hervorgerufen, aber dazu war, Gott sein Dank. keine Zeit mehr. Ich ließ mir von meiner Frau und der ebenfalls wieder schnell versöhnten Schwiegermutter rasch einen Kuß geben, und wir traten dann auf die Straße, wo der Wagen unserer harrte. Die Jungens, die ja bei keiner Festlichkeit fehlen, brachen bei unserem Anblick in ein lautes Hurrah aus — galt es der Versöhnung, dem eleganten Hochzeitskleid meiner Frau oder meinem Rock? Ich weiß es nicht.
Im wahnsinnigsten Tempo jagten wir der Kirche zu und schon nach wenigen Minuten hatten wir, Dank dem Einfall des Erbauers der Kirche, sie in der Nähe meines schwiegerelterlichen Hauses zu errichten, unser Ziel erreicht. Abermals wurden wir mit einem Hurrah der lieben Straßenjugend begrüßt, dann stiegen wir aus, und während meine Schwiegermutter in die Kirche trat, gingen meine Frau und ich durch eine kleine Seitenpforte in die Sakristei. Wir entschuldigten uns bei dem eng befreundeten Pastor ob unseren Zuspätkommens und schickten uns dann an, ihm in das Innere der Kirche zu folgen. Schon hatten wir einige Schritte zurückgelegt, als meine Frau beinahe über ihre lange Schleppe gestolpert wäre. Erschrocken breitete ich rasch die Arme aus, um sie vor einem Fall zu bewahren, da gab es einen Knacks, daß ich fast ohnmächtig wurde — die ganze Rückennaht meines Rockes war zerplatzt, und die einzelnen Bestandtheile meines Kleidungsstückes standen klafterweit auseinander . . .
Daß ich in diesem Augenblick keinen Schlaganfall bekommen habe, ist mir heute noch ein Räthsel.
Bei dem donnerähnlichen Krach, mit dem Ratzel's Rock auseinanderging, drehte sich der Pastor erschrocken um und fragte, ob ein Unglück geschehen sei. Mit wenigen Worten war ihm die Situation erklärt.
„Da ist guter Rath allerdings theuer,” meinte er, „so können Sie unmöglich in die Kirche, die voll von Neugierigen ist, hineingehen. Was machen wir nur?”
„Hast Du nicht Nähnadel und Zwirn bei Dir?” fragte ich meine Frau — die aber sah mich so vernichtend an, daß mir ganz bange ward.
Die Orgel begann zu spielen, der Küster hatte die Thür der Sakristei geöffnet, tausend und abertausend neugierige Blicke wandten sich uns zu — wie sollte das werden?
Ueber das gütige milde Gesicht des Pastors glitt ein leises Lächeln: „Ich weiß einen Ausweg, den einzigen, den es giebt, nach meiner Meinung. Wir bitten die Trauzeugen, sich hierher bemühen zu wollen und nehmen die heilige Handlung hier vor.”
Stumm nickten wir Beifall. Der Küster wurde instruirt und entfernte sich. Die Orgel verstummte, die nächsten Angehörigen traten in die Sakristei, in der ich mich mit dem Rücken gegen die Wand gestellt hatte und in einfacher, schlichter, aber(1) vielleicht desto feierlicherer Weise wurden wir getraut, während drinnen in der Kirche Tausende unserer harrten.
Dann ging's nach Hause, dem hochzeitlichen Mahl entgegen. Bevor wir uns aber zur Tafel setzten, hatte ich noch manchen Streit auszufechten, meine kleine Frau war böse, daß ich Niemanden Gelegenheit gegeben hätte, sie zu bewundern, aus demselben Grunde, natürlich im Interesse ihres Kindes, schmollte meine Frau Schwiegermutter. Die Gäste zürnten, daß sie solange vergeblich in der eiskalten Kirche hätten warten müssen, und Ratzel tobte wie ein Wilder, als er seinen Rock sah, in dem er doch unmöglich an dem Diner theilnehmen konnte..
Es wäre ja aber kein Hochzeitstag gewesen, wenn sich nicht doch noch Alles in Freude und Friede verwandelt hätte. Selbst meinem Schneider verzieh ich seine Saumseligkeit, als spät Abends zwar nicht ein Packet, wohl aber ein sehr freundliches Glückwunschtelegramm von ihm einlief.
Gar manches Jahr ist seit dem Tage vergangen, an dem ich unter solchen Schwierigkeiten in den Stand der heiligen Ehe trat. Das Unglück, das uns abergläubige Tanten und Cousinen prophezeiten, ist nicht eingetroffen — ich bin der glücklichste Ehemann unter der Sonne. Daß ich es bin, verdanke ich zum Theil dem Umstand, daß ich meiner Frau nie widerspreche, wenn sie den Wunsch nach einem neuen Kleid äußert. Aus eigener Erfahrung weiß ich, was es heißt, — wenn man nichts anzuziehen hat.
(1) In der Buchfassung heißt es hier: „aber darum vielleicht<”. (zurück)
„Dagens Press” vom 12.9.1914: