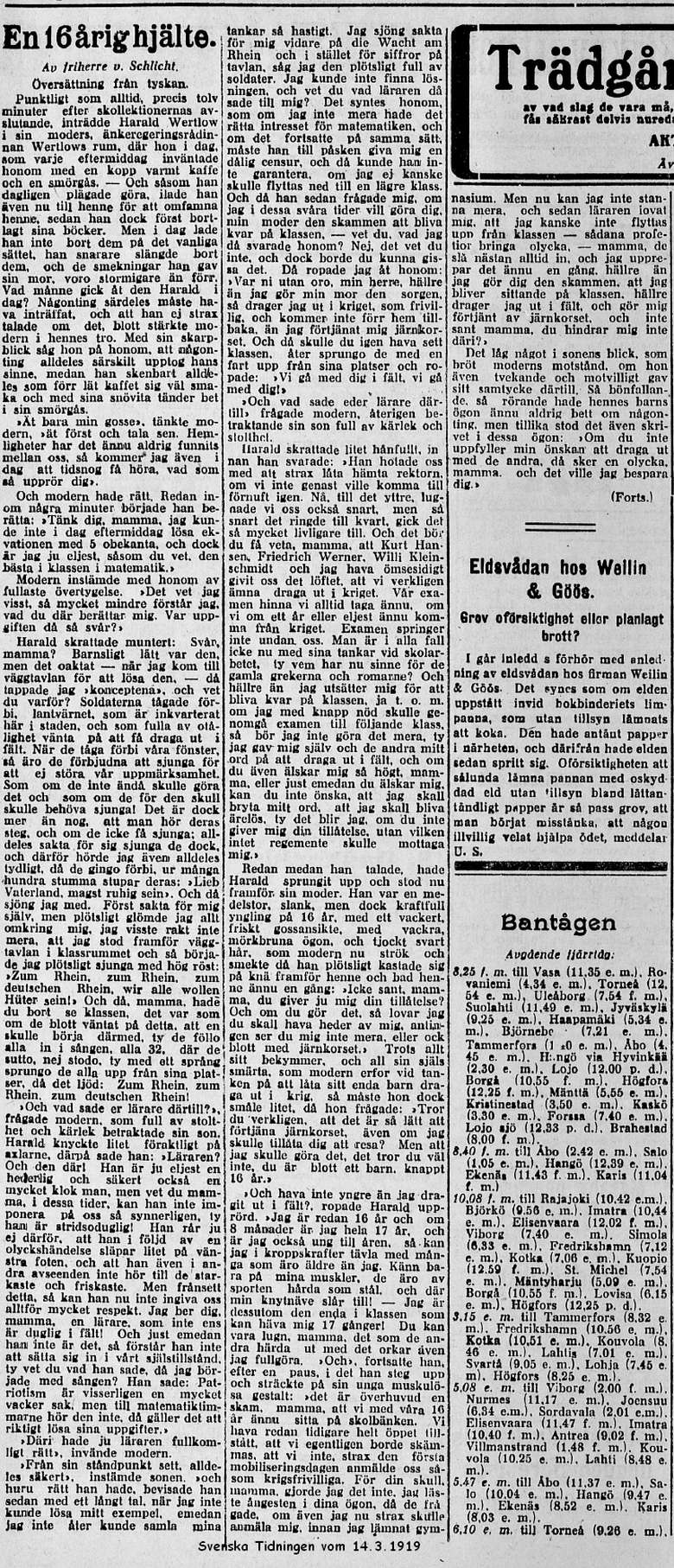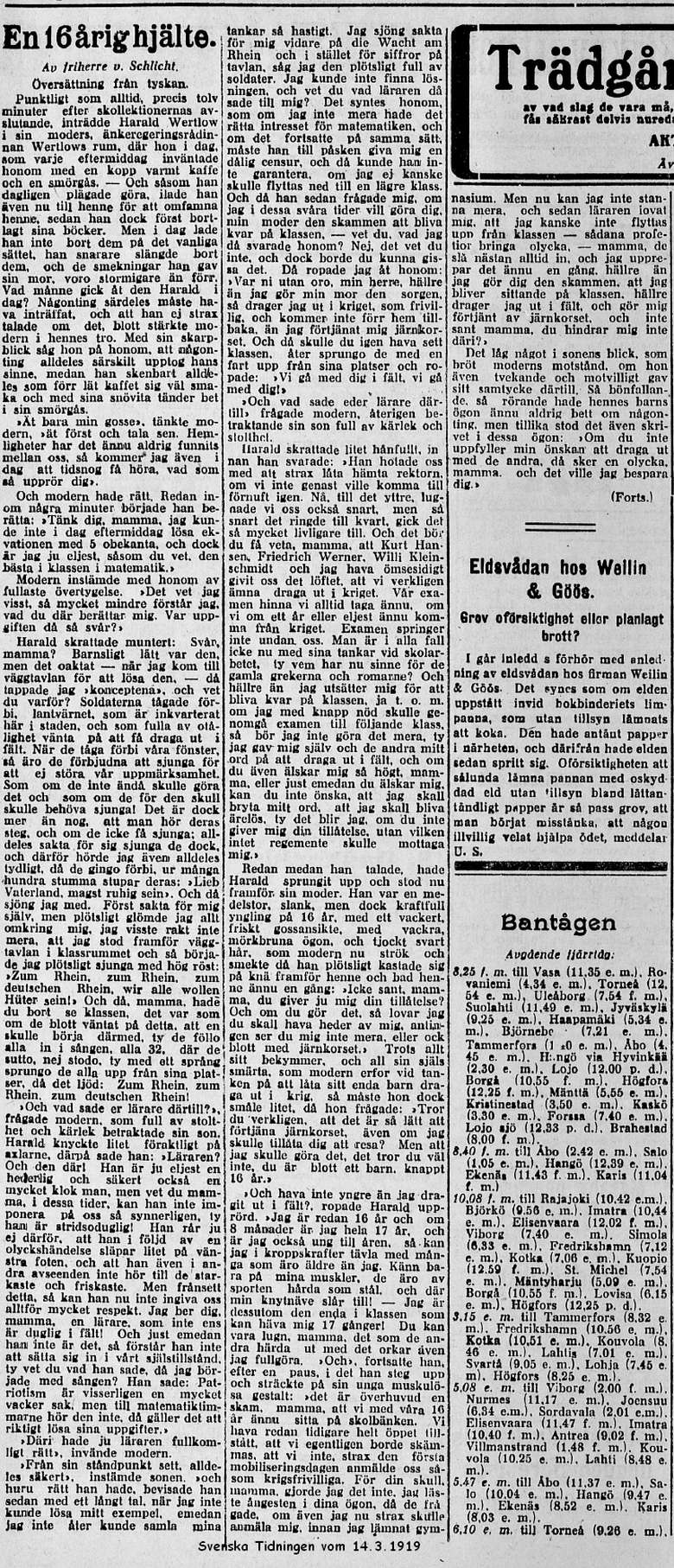

Erzählung von Freiherr von Schlicht.
in: „Zur guten Stunde”, Jahrgg. 1914/15, Heft 6, 26.11.1914
(siehe: Berliner Börsenzeitung vom 26.11.1914),
in: „Svenska Tidningen” vom 14. und 20.3.1919 und
in: „Unsere Feldgrauen”
Pünktlich wie immer, genau zwölf Minuten nach Beendigung des Schulunterichts, trat Harald Wertlow in das Zimmer seiner Mutter, der verwitweten Frau Regierungsrat, die ihn, wie alltäglich, am Nachmittag bereits mit einer Tasse warmen Kaffee und einem Butterbrot erwartete. Und wie täglich eilte er schnell auf sie zu, um sie zu küssen, nachdem er die Bücher, die er noch in der Hand trug, beiseite gelegt hatte. Aber heute war es kein Hinlegen der Bücher, mehr ein Hinwerfen, und auch die Küsse, die die Mutter er hielt, waren wilder und stürmischer als sonst. Was mochte der Harald heute nur haben? Irgend etwas Besonderes mußte vorgefallen sein, und daß er sich nicht gleich darüber aussprach, bestärkte die Mutter in ihrer Vermutung. Mit ihrem Scharfblick sah sie es ihm an, daß irgend etwas Wichtiges ihn beschäftigte, während er sich aufatmend ganz wie sonst seinen Kaffee gut schmecken ließ und mit seinen großen, schneeweißen Zähnen in die Schnitte hineinbiß.
Immer iß, mein Junge, dachte die Mutter, erst iß, dann sprich. Geheimnisse hat es zwischen uns ja noch nie gegeben, so werde ich auch heute schon bald erfahren, was dich erregt.
Und die Mutter behielt recht. Schon nach wenigen Minuten begann er zu erzählen: „Denk' dir nur, Mutter, ich habe heute nachmittag in der Mathematikstunde die Gleichung mit den fünf Unbekannten nicht lösen können, und dabei bin ich doch sonst der Beste in der Mathematik, das weißt du ja auch, Mutter.”
Die stimmte ihm aus voller Überzeugung bei: „Gewiß weiß ich das, und um so weniger verstehe ich, was du mir da sagst. War die Aufgabe denn so schwer?”
Harald lacht hell und fröhlich auf: „Schwer, Mutter? Kinderleicht war sie, aber trotzdem, als ich an der Wandtafel stand und die Aufgabe dort lösen sollte, da kam ich aus dem Text, und weißt du weshalb? Die Soldaten zogen vorüber, die Landwehrleute, die hier in der Stadt einquartiert sind und die voller Ungeduld darauf warten, in das Feld rücken zu dürfen. Wenn die bei unserem Gymnasium vorbeimarschieren, dürfen sie ja nicht singen, damit sie uns dadurch in unserer Aufmerksamkeit nicht stören. Als ob die das nicht ohnehin täten, und als ob die deswegen erst zu singen brauchten! Es ist doch mehr als genug, daß man ihre Schritte hört, und wenn sie auch nicht laut singen dürfen, im stillen singen sie doch, und so hörte ich denn auch ganz deutlich, als sie vorübergingen, aus vielen hundert stummen Kehlen ihr ,Lieb' Vaterland, magst ruhig sein!' Und da sang ich mit. Zuerst auch ganz leise und für mich, aber plötzlich vergaß ich alles um mich herum, ich wußte gar nicht mehr, daß ich vor der Wandtafel in dem Klassenzimmer stand, und da fing ich mit einem Male an, laut zu singen: ,Zum Rhein, zum Rhein, zum deutschen Rhein, wir alle wollen Hüter sein!' Und da hättest du nur die Klasse sehen sollen, Mutter, als wenn sie nur darauf gewartet hätten, daß einer damit anfänge, fielen sie alle mit in den Gesang ein, alle zweiunddreißig, wie sie dasaßen, nein, wie sie dastanden, denn mit einem Satz waren sie aufgesprungen, als es hieß: ,Zum Rhein, zum Rhein, zum deutschen Rhein!'”
„Und was sagte euer Lehrer dazu?” fragte die Mutter, die voller Stolz und voller Liebe auf ihren Sohn blickte.
Harald zuckte etwas verächtlich die Schultren, dann meinte er: „Der Lehrer? Ach der! Der ist ja sonst ein sehr netter und sicher auch ein sehr kluger und ehrenwerter Mann, aber weißt du, Mutter, in dieser Zeit kann er uns doch nicht sonderlich imponieren, er ist nicht einmal felddienstfähig. Er kann ja nichts dafür, daß er infolge eines Unfalles den linken Fuß etwas nachzieht, und daß er auch sonst nicht der Kräftigste und der Gesündeste ist. Aber trotzdem, allzuviel Respekt kann er uns jetzt nicht einflößen. Ich bitte dich, Mutter, ein Lehrer, der nicht einmal felddienstfähig ist! Und wohl weil er das nicht ist, versteht er auch gar nicht, sich in unsere Seelen hineinzuversetzen, denn weißt du, was er gesagt hat, als ich mit dem Gesang angefangen hatte? Er sagte: Mit dem Patriotismus sei es gewiß eine sehr schöne Sache, aber in die Mathematikstunde gehöre der nicht hinein, da gälte es, die Aufgaben richtig zu lösen.”
„Da hatte der Lehrer doch aber auch ganz recht,” warf die Mutter ein.
„Von seinem Standpunkt aus sicher,” stimmte der Sohn ihr bei, „und wie sehr er recht habe, bewies er mir mit einer langen Rede, als ich dann die Aufgabe nicht lösen konnte, weil ich meine Gedanken nicht so schnell wieder zu sammeln vermochte. Ich sang im stillen ,Die Wacht am Rhein' immer weiter, und statt der Zahlen auf der Tafel sah ich dort plötzlich lauter Soldaten. Ich konnte die Lösung nicht finden und, weißt du, was der Lehrer da zu mir sagte? Es käme ihm vor, als habe ich für die Mathematik nicht mehr das richtige Interesse, und wenn das so weiterginge, müsse er mir zu Ostern eine schlechte Zensur geben, und ob ich dann nach der Unterprima versetzt würde, das sei dann sehr die Frage. Und als er mich dann weiter fragte, ob ich dir, meiner Mutter, in der jetzigen schweren Zeit die Schande antun wolle, sitzenzubleiben — weißt du, was ich ihm da geantwortet habe? Nein, das weißt du nicht, und doch könntest du es dir eigentlich denken. Da habe ich ihm zugerufen: ,Seien Sie unbesorgt, Herr Doktor, ehe ich meiner Mutter das antue, eher ziehe ich als Kriegsfreiwilliger in das Feld und komme nicht eher wieder, als bis ich mir das Eiserne Kreuz geholt habe.' Un da hättest du nur wiederum die Klasse sehen sollen, wieder sprangen alle mit einem Satze auf, und wie aus einem Munde riefen sie mir zu: ,Wir gehen mit dir in das Feld, wir gehen mit!'”
„Und was sagte euer Lehrer dazu?” fragte die Mutter abermals, voller Stolz und Liebe auf ihren Sohn blickend.
Harald lachte ein klein wenig spöttisch auf, bis er dann zur Antwort gab: „Der drohte uns damit, er würde den Herrn Direktor holen lassen, wenn wir nicht gleich wieder zur Vernunft kämen. Na, äußerlich sind wir denn auch wieder zur Ruhe gekommen, aber als dann zur Pause geläutet wurde, da ging es desto lebhafter zu. Und erfahren wirst du es ja doch, Mutter, der Kurt Hansen, Friedrich Werner, Willi Kleinschmidt und ich wir haben uns gegenseitig das Wort gegeben, daß wir wirklich in das Feld ziehen wollen. Das Abitur können wir immer noch nachholen, wenn wir nach einem Jahr oder sonst aus dem Kriege zurückkommen. Das Abitur läuft uns nicht weg, und daß wir weiter zur Schule gehen, hat gar keinen Zweck. Man ist mit seinen Gedanken ja doch nicht bei der Sache, denn wer hat wohl jetzt Sinn für die alten Griechen und Römer? Und ehe ich mich dem aussetze, sitzenzubleiben — aber selbst, wenn ich im nächsten Jahr aber auch erst das Notabitur machen wollte, ich darf es jetzt nicht mehr, ich gab mir selbst und den anderen das Wort, in das Feld zu ziehen, und wenn du mich auch noch so sehr liebst, Mutter, oder gerade weil du mich liebst, wirst du es nicht wollen, daß ich mein Wort breche und daß ich ehrlos werde, denn das werde ich, wen du mir nicht deine Erlaubnis gibst, ohne die mich kein Regiment nehmen darf.”
Schon während des Sprechens war Harald aufgesprungen und stand nun vor seiner Mutter. Er war ein mittelgroßer, schlanker und dabei doch kräftiger, junger Mensch von sechzehn Jahren, mit einem hübschen, frischen Knabengesicht, mit schönen, dunkelbraunen Augen und dichtem, schwarzem Haar, das die Mutter jetzt mit ihren weichen Händen streichelte und liebkoste, als er nun plötzlich vor ihr auf den Knien lag und sie noch einmal bat: „Nicht wahr, Mutter, du gibst mir die Erlaubnis? Und wenn du es tust, dann verspreche ich es dir, ich will dir Ehre machen, und du siehst mich entweder gar nicht wieder oder nur mit dem Eisernen Kreuz.” Trotz all ihres Kummers und ihres Seelenschmerzes, die die Mutter bei dem Gedanken empfand, ihr einziges Kind in den Krieg ziehen zu lassen, mußte sie jetzt doch leise lächeln, und so fragte sie denn: „Glaubst du denn wirklich, daß es so leicht ist, das Eiserne Kreuz zu verdienen, selbst wenn ich dich ziehen ließ? Aber daß ich das tue, das glaubst du wohl selbst nicht, du bist noch ein Kind, kaum sechzehn Jahre alt.”
„Und sind nicht schon Jüngere als ich in den Kampf gezogen?” rief Harald erregt. „Habe ich dir nicht erst neulich von dem jüngsten Fähnrich in der Armee vorgelesen, der von dem Kadettenkorps in das Feld gegangen ist, und erst dreizehndreiviertel Jahre zählte! Aber ich bin schon sechzehn, und in acht Monaten werde ich sogar schon siebzehn, und wenn ich auch jung an Jahren bin, an Körperkräften nehme ich es mit vielen auf, die weit älter sind als ich. Fass' nur mal meine Arm- und meine Beinmuskeln an, die sind durch den Sport gestählt, und wo meine Faust hinschlägt — ich bin der einzige in unserer Klasse, der mit Aufgriff siebzehn Klimmzüge machen kann. Selbst Ernst Lüttich bringt es nur auf fünfzehn, und auch das nur mit dem viel leichteren Untergriff. Du kannst unbesorgt sein, Mutter, was die anderen aushalten, halte ich erst recht aus, und der Tornister, der mich während des Marsches drückt oder der mir zu schwer wird, der Tornister soll noch erst gepackt werden!” Und sich stolz aufrichtend und seine kräftige, muskulöse Gestalt dehnend und streckend, fuhr er nach einer kleinen Pause fort: „Es ist ja überhaupt eine Schande, Mutter, daß wir mit unseren sechzehn Jahren uns hier noch auf der Schulbank herumdrücken. Wir haben uns das vorhin auch offen eingestanden, wir müßten uns eigentlich schämen, daß wir uns nicht gleich am ersten Tage der Mobilmachung als Kreigsfreiwillige meldeten. Ich tat es deinetwegen nicht, Mutter, ich las die stumme Angst in deinen Blicken, daß auch ich mich jetzt schon melden möchte, ehe ich das Gymnasium, wenn auch nur mit dem Notabitur, verlassen hätte. Aber jetzt kann ich nicht mehr bleiben, und seitdem der Lehrer mir davon gesprochen hat, daß ich vielleicht nicht versetzt werde — solche Prophezeiungen bringen Unglück, Mutter, die treffen fast immer ein, und ich wiederhole es nochmals: ehe ich dir die Schande antue und sitzenbleibe, eher ziehe ich in das Feld und hole mir das Eiserne Kreuz, und, nicht wahr, Mutter, du hinderst mich nicht daran?”
Es lag etwas in den Blicken ihres Sohnes, das den Widerstand der Mutter brach, das sie, wenn auch nur schwer und zögernd, ihre Einwilligung geben ließ. So flehend, so rührend hatten die Augen ihres Kindes sie noch nie um etwas gebeten wie jetzt, aber zugleich stand in diesen Augen auch geschrieben: Wenn du mir meine Bitte nicht erfüllst, wenn du nicht einwilligst, mit den anderen hinauszuziehen, dann gibt es ein Unglück, Mutter, und das möchte ich dir ersparen.”
Drei Tage später meldete sich der bisherige Obersekundaner Harald Wertlow mit seinen Freunden auf dem Garnisonkommando als Kriegsfreiwilliger, ebenso wie die anderen wurde auch er nach der ärztlichen Untersuchung genommen, und er, der bisher außerordentlich viel Wert auf seine Kleidung gelegt hatte, ging so stolz in der fünften Garnitur herum, als wären ihm die Hosen nicht viel zu weit und dabei etwas zu kurz, als wäre der bunte Rock extra für ihn angefertigt und nicht schon von vielen, vielen vor ihm getragen worden.
Er war jetzt Soldat, und wenn er durch die Straßen der Stadt marschierte und während seiner freien Zeit zu seiner Mutter ging, hatte er keinen Blick mehr für die hübschen, jungen Mädchen, mit denen er als Obersekundaner flirtete, mit denen er auf den Schülerbällen getanzt hatte. Was fragte er noch nach den süßen, kleinen Mädchen, die hatten überhaupt ihren Beruf verfehlt, die konnten ja nicht einmal Soldat werden. Er aber war Soldat und als solcher plötzlich ein Mann geworden, der seine Pflicht tun würde wie nur einer, wenn er erst endlich vor dem Feinde stand.
Vorher aber kam noch das Schwerste: der Abschied von der Mutter. Und als die Stunde da war, da schnürte und würgte es ihm trotz alledem verdammt an der Kehle, und er mußte sich Gewalt antun, um nicht ebenfalls zu weinen, wie seine Mutter es tat. Die hatte doch nur ihn, diesen einen Sohn, und wer wußte, ob sie ihn jemals wiedersah. Und wenn er daran dachte, daß er auch vielleicht die Mutter heute zum letzten Male sah, seine Mutter, die ihn in all den Jahren mit so viel Liebe umgeben hatte — aber nein, er wollte nicht weinen, und er durfte nicht weinen, denn er war doch jetzt ein Mann.
So kämpfte er gewaltsam jede Rührung hinunter und sprach, selber des Trostes bedürftig, seiner Mutter Trost zu, bis er ihr dann noch einmal zurief: „Weine nicht, Mutter, freue dich mit mir, daß sich mir Gelegenheit bieten wird, das Eiserne Kreuz zu verdienen, denn das schwöre ich dir, ohne das siehst du mich nicht wieder.”
Dann riß er sich gewaltsam aus den Armen seiner Mutter und stürmte davon, der Kaserne entgegen, denn am Abend ging es mit der Bahn fort, der Grenze zu, nachdem die Ausbildung in den vergangenen Wochen beendet worden war.
Aber jetzt, wo es gegen den Feind ging, war er erst wirklich Soldat, und bald lernte er, ewas es im Kriege heißt, Soldat zu sein. Leicht war es nicht. Die endlos langen Märsche, das Nachtlager unter freiem Himmel, die Beköstigung aus der Feldküche, keine Gelegenheit, sich zu waschen und zu säubern, tagelang nicht aus den Kleidern und den schweren Stiefel kommen, keine Gelegenheit, sich selbst nach der größten Anstrengung einmal ordentlich ausschlafen zu können, nein, leicht war es nicht, aber er sehnte sich trotzdem nicht ein einzigesmal nach Hause zurück. Es war ja trotz alledem oder gerade wegen dieser Strapazen so unbeschreiblich schön. Und wie schön war es erst im Gefecht, wenn einem die Kugeln um die Ohren pfiffen, wenn die Geschütze donnerten, wenn man Gelegenheit hatte, das Hurra der attackierenden Reiter zu hören, und wie schön, wie herrlich schön war der Sieg, wenn der Feind sich zur Flucht wandte, wenn man ihn mit Schnellfeuer verfolgte oder mit dem aufgepflanzten Seitengewehr nachstürmte.
Ja, schön war der Krieg, und der würde für ihn noch viel schöner werden, wenn er erst das Eiserne Kreuz besaß. Einmal würde sich auch für ihn schon Gelegenheit bieten, sich das zu verdienen. Sein Hauptmann hatte es sich schon geholt. Täglich sah er an dessen Waffenrock das Eiserne Kreuz an dem schwarzweißen Band aus dem Knopfloch heraushängen, und er wartete voller Ungeduld auf die Stunde, in der auch ihm diese Auszeichnung zufiele.
Aber wie schon so oft schien sich ihm auch heute keine Gelegenheit dazu bieten zu wollen, heute weniger denn je, denn die Kompagnie lag untätig auf freiem Felde und wartete auf weitere Befehle. Man vertrieb sich die Zeit so gut es ging. Man plauderte miteinander, dieser oder jener benutzte die Gelegenheit, eine Feldpostkarte nach Hause zu schreiben, bis dann plötzlich ein Surren und Brummen in der Luft sie alle aufblicken ließ. Ein Flieger kreiste dort oben herum, aber keiner der eigenen Armee, wie sie alle sehr bald erkannten , sondern ein feindlicher, der aus der nicht allzu weit entfernten Festung zu einem Erkundigungsflug aufgestiegen sein mochte.
Hoffentlich wirft der Kerl keine Bombe, war der erste Gedanke, der sie alle durchzuckte, aber kaum gedacht, wurde die dicht zusammenliegende Kompagnie, die ein gutes Angriffsziel bot, auch schon von der ersten Bombe getroffen. Mit einem lauten Krach zerbarst das Geschoß, und viele der Mannschaften wälzten sich in ihrem Blut. Ein einziger Schrei des Entsetzens, der Verzweiflung und der ohnmächtigen Wut entrang sich ihnen allen, dann ertönte auch schon das Kommando: „An die Gewehre!” Jeder eilte an seinen Platz, da schlug auch schon die zweite Bombe in die Reihen, und abermals sanken viele der Kameraden um.
„Den Kerl da oben müssen wir haben,” ertönte da die helle Stimme des Hauptmanns, „der Kerl darf nicht lebendig von dannen kommen, der muß herunter, und das verspreche ich euch, wenn wir ihn kriegen, und wenn sich nachher feststellen läßt, wer ihn herunterholte, dem verschaffe ich das Eiserne Kreuz. Darauf verpfände ich euch mein Wort, und nun versucht euer Glück.”
Gleich darauf begann gegen den Flieger ein mörderisches Feuer, aber der ließ sich dadurch nicht beirren. Der dachte nicht daran, sich zu Flucht zu wenden, sondern warf eine Bombe nach der anderen, und wenn auch die eine oder die andere keinen Schaden anrichtete, es gab leider immer noch genug Treffer, und die Leute sahen es deutlich, wie der Flieger jetzt sogar etwas tiefer herunterging, wohl um die Wirkung seiner Wurfgeschosse noch zu erhöhen.
Die Leute schossen wie wild darauf los, und wohl gerade deshalb verfehlten sie alle ihr Ziel. Vergebens ermahnte der Hauptmann seine Leute, langsamer zu feuern, bis er zufällig auf einen Schützen aufmerksam wurde, der nicht wie blödsinnig darauf losknallte, sondern der auch jetzt seine ruhige Besonnenheit bewahrte. Das war der Kriegsfreiwillige Harald Wertlow. Etwas abseits von den anderen stand er da, ruhig und gelassen wie auf dem Scheibenstand. Ja, der Hauptmann sah sogar mit einem Lächeln, daß der Mann von Zeit zu Zeit einen Blick auf seine Fußstellung warf, um sich davon zu überzeugen, ob er auch richtig dastände, und daß er seine Fußstellung sogar korrigierte, wenn er selbst etwas an ihr auszusetzen hatte. Ruhig, völlig ruhig und gelassen gab der Kriegsfreiwillige einen Schuß nach dem anderen ab, und doch zitterte jeder Nerv in ihm. Der Hauptmann hatte recht, der Kerl dort oben mußte herunter, wenn der mit der Zeit nicht die ganze Kompagnie zur Strecke bringen solle, und kein anderer durfte den herunterholen als er selbst. Ließ er sich diese Gelegenheit entgehen, um sich das Eiserne Kreuz zu verdienen, wer wußte, ob sich ihm dann zum zweitenmal eine Gelegenheit bot.
Er allein durfte der glückliche Schütze sein. Nicht umsonst war er während der Ausbildungszeit fortwährend auf dem Schießplatz wegen seiner guten Leistungen belobt worden, nun galt es zu zeigen, was er zu Hause gelernt hatte.
Da ertönte plötzlich aus dem Munde der Kameraden ein Wutgeschrei. Dem Flieger schien es mit der Zeit dort oben doch unbehaglich zu werden, und deutlich sahen alle, wie er sich anschickte, die Flucht zu ergreifen. Sollte der Kerl wirklich mit dem Leben davonkommen? Die Erregung, die alle ergriff, war so groß, daß keiner mehr daran dachte, weiterzufeuern. Mit starren, entsetzten Augen sahen alle auf den Flieger, der sich jetzt höher und höher schraubte.
Nur einer bewahrte auch jetzt nach außen hin sein kaltes Blut, obgleich er sich im stillen sagte: Jetzt oder nie! Dann hob der Kreigsfreiwillige Harald Wertlow das Gewehr an die Wange und zielte nach jener Stelle des Flugzeuges, wo der Flieger seinen Sitz haben mußte. Er zielte und zielte, dann drückte er ab wie auf dem Scheibenstand. Erst nahm er Druckpunkt, dann krümmte er den Zeigefinger der rechten Hand immer mehr und mehr, ganz langsam, bis das Geschoß den Lauf verließ. Und es mußte getroffen haben, ein donnerndes Hurra der Kameraden war die Antwort auf diesen Schuß. Er selbst wie alle sah, wie das Flugzeug dort oben schwankte. Sicher hatte der Führer die Gewalt über das Flugzeug verloren, der mußte verwundet sein, das Flugzeug begann sich zu senken, erst langsam, dann schneller und schneller.
Einen Augenblick stand der Kriegsfreiwillige Harald Wertlow wie gelähmt da. Gewiß war sein Treffer nur ein Zufallstreffer gewesen, aber der Erfolg sprach für ihn. Das Glück war zu groß, und er fühlte, wie er vor Freude taumelte, dann aber raffte er sich zusammen und eilte mit den Kameraden der Stelle zu, auf der der Flieger voraussichtlich niedergehen würde. Der war, wenn er überhaupt noch lebte, unrettbar verloren, der konnte der sicheren Gefangennahme nicht mehr entgehen. Kaum zweihundert Meter hoch war der jetzt noch in der Luft, aber der mochte den Entschluß gefaßt haben, sein Leben so teuer wie nur möglich zu verkaufen, denn jetzt, für alle gänzlich unerwartet, schlug eine letzte Bombe in die Reihen der Kompagnie, daß die Leute mit einem erneuten Wutgeschrei auseinanderstoben. Mehr als zwölf Kameraden wälzten sich auf der Erde, unter ihnen tödlich verwundet der Kriegsfreiwillige Harald Wertlow.
Der Hauptmann und die Kameraden sahen ihn erst am Boden liegen, als sie den schwerverwundeten Flieger wenige Minuten später gefangengenommen hatten und als sie den glücklichen Schützen suchten, um diesem den Gefangenen vorzuführen und um ihm zu diesem glücklichen Treffer zu gratulieren. Aber der sah und hörte kaum noch etwas von alledem, was um ihn herum vorging. Mit zerschmetterten Gliedern sich in seinem Blute wälzend, lag er schwerröchelnd da. Als aber der Hauptmann sich über ihn beugte, um zu sehen, ob denn gar keine Rettung mehr möglich sei, da griff der Sterbende mit zitternden Händen nach dem Kreuz, das der Hauptmann im Knopfloch seines Waffenrockes trug, und bat mit leiser Stimme: „Das Eiserne Keuz!”
Der Hauptmann wußte, seine Aufgabe war es nicht, diese Auszeichnung zu verleihen. Dazu hatte er kein Recht, aber er durfte dem Sterbenden die Bitte auch nicht ausschlagen. Man würde ihm das Kreuz schon wieder ersetzen, wenn man erfuhr, wem er es gegeben hatte, und daß er dem glücklichen Schützen das Kreuz mit seinem Wort gelobte.
So löste er denn das Kreuz mit schnellem Griff aus seinem Knopfloch und drückte es dem Sterbenden in die Hand, der es mit zitternden, krampfhaft bebenden Fingern umklammerte und es so fest an sich preßte, als wolle er sicher sein, daß man es ihm auch im Tode nicht wieder nehmen könne. Der Sterbende schien die Wunden und die Schmerzen vergessen zu haben, mit einem glücklichen Lächeln auf den Lippen lag er da, bis dann das Leben aus seinem jungen Körper immer mehr und mehr entwich, so daß selbst der Hauptmann, der sich immer noch um ihn bemühte, nur leise seine letzten Worte vernahm: „Das Eiserne Kreuz — sagt es meiner Mutter — und auch dem Mathematiklehrer — sie haben mir beide nicht geglaubt.”
„Svenska Tidningen” vom 14.3, 15.3., 19.3. und 20.3.1919: