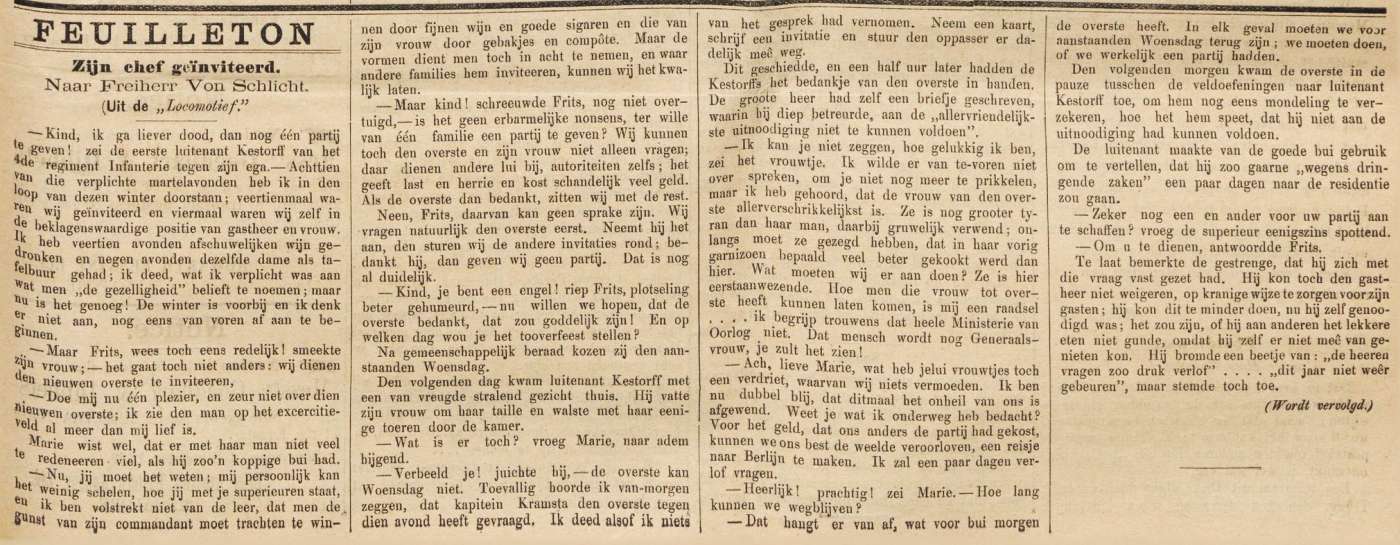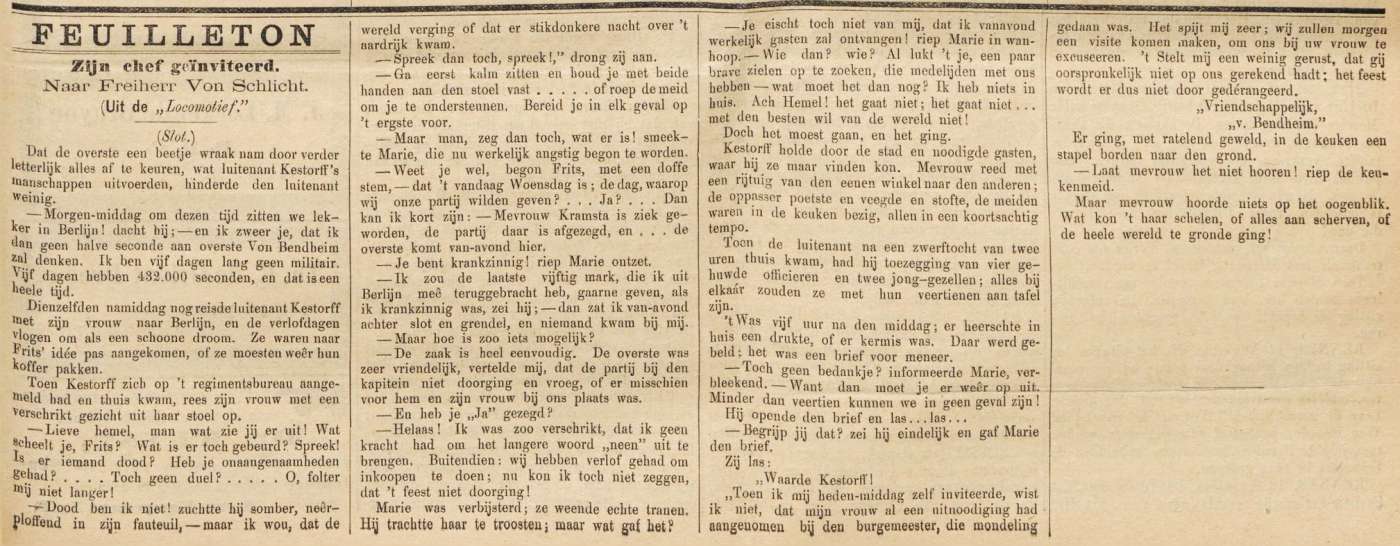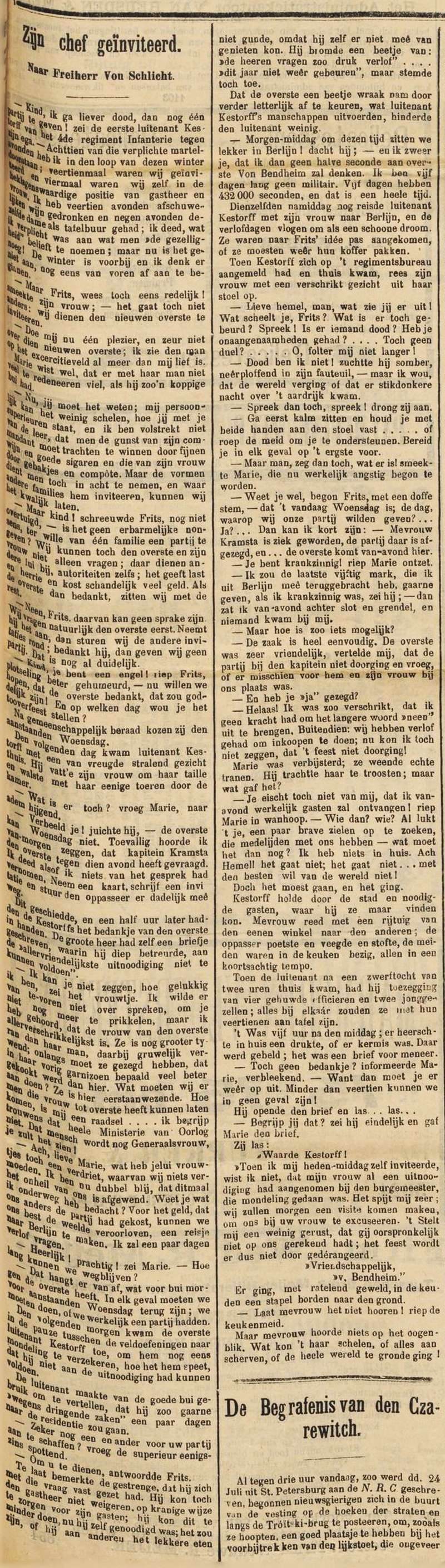
Militär-Humoreske von Freiherr von Schlicht.
in: „De Lokomotief” Samarangsch handels- en advertentie-blad vom 2.9.1899 (unter dem Titel: „Zijn chef geïnviteerd”),
in: „De Sumatra Post” vom 11.9.1899 (unter dem Titel: „Zijn chef geïnviteerd”),
in: „Neue Hamburger Zeitung” vom 31.1.1900 und
in: Der grobe Untergebene”
„Lieber sterbe ich, als daß ich nur noch eine Gesellschaft gebe,” sagte der Oberleutnant von Kestorff zu seiner Gattin, mit der er zusammen am Abendbrottisch saß, „lieber sterbe ich! Achtzehn Kommißgesellschaften habe ich im vergangenen Winter glücklich überstanden, vierzehnmal waren wir eingeladen und viermal waren wir selbst sehr zu bedauern, weil wir selbst Gäste bei uns hatten. Ich habe vierzehn Flaschen entsetzlichen Rotweins getrunken, habe bei der Vertilgung von zwölf Kalbsbraten und zwei Kalbsnierenbraten Wunder verrichtet, habe neumal dieselbe Dame zu Tisch geführt und vierzehnmal nach Tisch eine Zigarre rauchen müssen, an der ich gestorben wäre, wenn ich es nicht jedesmal fertig gebracht hätte, sie mit meiner eigenen Henry Clay zu vertauschen. Ich tat, was ich konnte, um die Geselligkeit und die Kameradschaft zu pflegen; nun ist's aber genug, der Winter ist außerdem vorbei, da denke ich nicht daran, noch einmal wieder von vorne anzufangen und einen Pekko zu veranstalten.”
„Aber Fritz, so nimm doch Vernunft an,” bat seine Frau, „es geht nun doch einmal nicht anders, wir müssen den neuen Oberst einladen.”
„Tue mir den einzigen Gefallen,” bat er, „und laß mich mit dem neuen Oberst zufrieden, ich habe schon genug daran, daß ich den Mann jeden Tag, öfter als mir lieb ist, auf dem Exerzierplatz sehen muß.”
„Aber wir müssen ihn dennoch bitten,” fing sie von neuem an, „die anderen —”
„Ja, warum sind die anderen so schlapp?” untebrach er sie. „Erst wird ein großer, sogenannter gemeinsamer Beschluß gefaßt, dem Oberst zu Ehren in dieser Saison keine Gesellschaften mehr zu geben, sondern bis zum nächsten Winter damit zu warten — alles wird abgemacht und besprochen; aber kaum ist der neue Oberst da, kaum hat er einmal mit den Augen gerollt, da kriechen sie alle zu Kreuz. Der Etatsmäßige, der vor Angst in der Nähe eines Vorgesetzten beinahe jeden Tag dreimal tot bleibt, fängt an — strenge nach der Dienstaltersliste folgen die anderen. Bis zum jüngsten Hauptmann hat er sich nun schon durchgegessen und nun sollen wir auch noch anfangen? Ich danke.”
Frau Marie zuckte die Achseln. Wenn ihr Mann so redete, war noch weniger als gar nichts mit ihm anzufangen, da half kein Widersprechen, das reizte ihn nur zu neuer Opposition, anstatt ihn zu beruhigen und von seiner Absicht abzubringen.
„Wie du meinst,” gab sie zur Antwort, „ich stecke ja nicht drinnen in Deinem Rock und mir persönlich kann es ja gleich sein, ob Du Dich mit Deinem Kommandeur gut stellst oder nicht. Ich bin gewiß die letzte, die da sagt: man muß das Wohlwollen des Kommandeurs durch gute Weine und Zigarren, die gnädige Gesinnung der Kommandeuse durch schöne, eingemachte Früchte und andere Süßigkeiten sich zu erwerben suchen. So bin ich nicht, das weißt Du ganz genau; aber die Form muß man wahren, und wenn alle anderen Familien ihn einladen, müssen auch wir es tun, wenn wir nicht unhöflich und ungezogen erscheinen wollen.”
Er wehrte sich wie ein Verzweifelter. „Aber Kind, ist denn das nicht ein gen Himmel schreiender Unsinn, wegen einer einzigen Familie eine Gesellschaft zu geben? Wir können doch den Oberst und seine Frau nicht allein bitten, wir müssen doch jemand dazu laden, sogar Spitzen und Honoratioren, die Sache macht viel Arbeit, kostet ein blödsinniges Geld und das alles, weil wir den Oberst ,haben müssen'. Wenn der Oberst dann absagt, sitzen wir da mit unserem großen Ochsenbraten, und ich kann die Überreste dann acht Tage lang, jeden Mittag in einer anderen seligmachenden Fasson, zu mir nehmen.”
„Aber Fritz,” sagte sie, „davon kann doch nicht die Rede sein! Wir laden den Oberst ein, natürlich zuerst. Sagt er zu, so schreiben wir die anderen Einladungen aus, sagt er ab, so geben wir natürlich überhaupt keine Gesellschaft, das ist doch ganz klar.”
„Kind, Du bist ein Engel,” sprach er glücklich, sie in seine Arme schließend, „nun wollen wir hoffen, daß der Oberst absagt, das wäre mehr als herrlich! Und an welchem Tage, meintest Du, sollte das Zauberfest stattfinden?”
Nach gemeinsamer Beratung entschieden sie sich für den Mittwoch; aber am nächsten Tage kam Herr von Kestorff freudestrahlend vom Dienst nach Haus.
„Was hast Du nur?” fragte ihn die Gattin, „hast Du ein Kommando bekommen, hat Dein Zug einen guten Parademarsch gemacht oder was ist sonst geschehen?”
Er faßte sie bei der Hand und tanzte mit ihr im Zimmer auf und ab, während er mit schrecklicher Stimme dazu sang:
|
„Und nun tanzt Tarantella |
„Denk' Dir nur,” jubelte er, als er sie endlich losließ, „denke Dir, der Oberst kann Mittwoch nicht. Durch Zufall hörte ich heute morgen auf dem Marsch, wie Kramsta, der älteste verheiratete Oberleutnant, dem Hauptmann erzählte, daß er am nächsten Mittwoch den Kommandeur bei sich zur Abendgesellschaft habe. Ich tat natürlich, als hätte ich keine Silbe von dem Gespräch gehört; nun aber schnell her mit der Einladungskarte, schreib sie rasch aus, dann kann der Bursch sie gleich hinbringen.”
Das geschah, und eine halbe Stunde später hatten Kestorffs die Absage des Kommandeurs in Händen, ein von dem Herrn Oberst persönlich geschreibenes Billett, in dem er unendlich bedauerte, der so „außerordentlich liebenswürdigen Einladung nicht Folge leisten zu können”.
„Ich kann Dir gar nicht sagen, wie grenzenlos glücklich ich bin,” sagte die kleine Frau, „ich wagte nur nicht, es Dir zu sagen, um Deinen Widerspruch nicht noch mehr zu reizen; aber ich habe vor der Gesellschaft entsetzliche Angst gehabt! Die Kommandeuse ist nämlich die größte Tyrannin, die jemals das Szepter geschwungen hat. Sie hat uns, gleichsam durch Parolebefehl, verboten, für unsere Gesellschaften eine Kochfrau anzunehmen, sie will, daß wir alles mit unserem Mädchen allein machen. Dabei ist sie in einer Art und Weise verwöhnt, die schon nicht mehr schön ist; neulich hat sie sich sogar hinreißen lassen, mit infam spitzer Zunge zu bemerken: ,Das muß ich denn doch aber wirklich sagen, in meinem alten Regiment wurde viel, viel besser gekocht.' Zuerst wollten wir uns alle, wie Ihr zu sagen pflegt, wenn Ihr Euch in derselben Lage befindet, unseren Hut aufsetzen und uns beschweren. Aber leider ist sie hier ja die Höchstkommandierende in den Marken. Da blieb uns nichts weiter übrig, als den Tadel ruhig hinzunehmen. Schließlich legte sie uns sehr ans Herz, recht fleißig in Henriette Davidis Kochbuch zu lesen — wenn es so weitergeht, hält sie noch jeden Mittag mit uns Appell mit Kochtöpfen ab. Ich habe nie viel vom Miltärkabinett wissen wollen, aber wie man die Frau zur Kommandeuse hat befördern können, ist mir völlig rätselhaft — es fehlt nur noch, daß sie auch noch eine Brigade erhält, imstande dazu ist sie. Der Frau traue ich alles zu.”
„Aber Kind, Du redest Dich ja ganz in Wut und Zorn,” sagte er verwundert, „mein Herz ahnte ja nicht,daß Ihr so viel unter Eurer Kommandeuse leiden müßt. So freue ich mich doppelt und dreifach, daß diese Gesellschaft an Deinen Kochtöpfen vorübergeht. Ich will Dir aber noch eine andere freudige Mitteilung machen. Ich habe mir unterwegs ausgerechnet, da dies Fest uns, alles in allem, doch ungefähr zweihundert Mark gekostet hätte — ausgegeben hätten wir sie doch, und darum habe ich beschlossen, morgen ein paar Tage Urlaub zu nehmen und mit Dir nach Berlin zu fahren.”
Sie jubelte laut auf und hing glückselig an seinem Hals. „Das ist zu schön! — zu herrlich! — wie lange wollen wir denn fortbleiben?”
„Das kommt darauf an, wie der Oberst morgen bei Laune ist,” gab er zur Antwort, „auf jeden Fall müssen wir aber am nächsten Mittwoch wieder hier sein; wir müssen doch wenigstens so tun, als ob wir unsere Gesellschaft gäben.”
Am nächsten Morgen war große Regimentsübung, der Etatsmäßige führte, der Herr Oberst schwebte als Kritikus über dem Ganzen. Der Oberst schalt schon gleich zu Beginn ganz gewaltig, so daß sich jeder sagte: wenn er sich jetzt schon so verausgabt, was bleibt dann für den Schluß?
Man muß stets die Wirkung zu steigern suchen, sie niemals abschwächen, das ist eine alte Geschichte aus der Zeit vor der Erschaffung der Welt,.
Da sah der Kommandeur den Oberleutnant von Kestorff. Er ritt auf ihn zu und gab ihm sogar die Hand. „Sie waren so liebenswürdig, uns einzuladen — es tut uns wirklich ganz außerordentlich leid —, wir hätten gerade in Ihrem Hause so gern einen Abend zugebracht.”
„Ich weiß zwar, daß das alles nur Redensarten sind und daß du bei jedem anderen genau dasselbe sagen würdest,” dachte Kestorff, „aber die Gelegenheit ist günstig, eigentlich wollte ich nur drei Tage Urlaub haben, aber wenn du so gnädig bist, kommst du unter fünf nicht weg,” und er trug ihm sein Anliegen vor.
Aber die Gnadensonne des Kommandeurs verwandelte sich plötzlich in einen Gewittersturm. „Herr, glauben Sie, daß Sie nur Offizier sind, um auf Urlaub gehen zu können? Das gibt es nicht, da könnte jeder kommen.”
„Aber es kommt doch nicht jeder,” dachte Kestorff, „und außerdem nützt dir dein Schelten doch nichts, ich will nach Berlin und folglich muß ich auch dorthin.”
So machte er denn sein „dienstliches” Gesicht und sagte: „Ich bitte sehr um Verzeihung , Herr Oberst” (um Verzeihung bittet man immer, wenn man mit einem Vorgesetzten spricht), „ich bitte sehr um Verzeihung, aber dringende Geschäfte rufen mich nach der Residenz.”
„Sie müssen wohl noch Besorgungen für Ihre Gesellschaft machen?” fragte der Kommandeur in ironischem Tone.
„Zu Befehl!” sagte Kestorff — er hätte selbst dann „Zu Befehl!” gesagt, wenn der Oberst ihn gefragt hätte, ob er in Berlin jemand hinrichten wolle.
Zu spät merkte der Kommandeur, daß seine Frage nicht sehr schlau gewesen war, daß er sich mit derselben selbst gefangen habe. Er konnte nun doch nicht gut „nein” sagen, dem Gastgeber nicht die Möglichkeit nehmen, in vornehmer Weise für seine Gäste zu sorgen, er konnte doch dem Leutnant nicht verwehren, für eine Gesellschaft, an der er selbst beinahe teilgenommen hätte, einzukaufen, das hätte doch beinahe so ausgesehen, als wenn er sagen wollte: ich bekomme doch nichts von den schönen Sachen, folglich braucht Ihr anderen auch nichts. Das ging doch nicht.
So knurrte er denn ärgerlich: „Na, denn meinetwegen, aber kommen Sie mir, bitte, in diesem Jahr nicht wieder damit, daß Sie auf Reisen gehen wollen.”
Daß man aber keinen Vorgesetzten ungestraft um Urlaub bittet, merkte Kestorff, als nach einem schier endlosen Gefecht endlich die Kritik erfolgte.
Falsch gewesen war alles von Anfang bis zu Ende, darüber wunderte sich nun freilich niemand, denn die Übungen sind ja da, damit Fehler gemacht werden und damit man aus den Fehlern lernt.
Falsch gewesen war alles, aber das Falscheste des Falschen stellten die Heldentaten dar, die Kestorff mit seinem Zuge verbrochen hatte, und der Herr Oberst konnte sich nicht genuf darüber wundern, daß ein so alter Offizier so wenig leistete.
Unter anderen Umständen hätte Kestorff sich über diese vernichtende Beurteilung seiner Leistungen die abligate militärische Schwindsucht an den Hals geärgert, heute aber, am Vorabend seiner Reise, dachte er: „Rede nur, Freundchen. Wenn du glaubst, daß du mir durch deine Worte die Laune verdirbst, dann irrst du dich sowohl als auch . . . Morgen mittag um diese Zeit bummle ich bereits mit der Gattin — ach der teuern! — Unter den Linden, und ich schwöre dir bei allem, was dir heilig ist, daß ich dann aber auch nicht eine halbe Sekunde an dich denken will. Mit meinem militärischen Leben schließe ich heute, wenn auch nur vorläufig auf die Dauer von fünf Tagen, ab. Fünf Tage sind aber vierhundertzweiunddreißigtausend Sekunden, und das ist eine lange, lange Zeit. Im übrigen magst du ruhig sagen, was du willst; ich erkläre mich für einen Ehrenmann und erwarte von dir den Gegenbeweis.”
Am Nachmittag desselben Tages reiste Kestorff mit seiner Frau ab und wie im Fluge ging der schöne Aufenthalt in Berlin zu Ende.
Kaum waren sie nach ihrer Meinung angekommen, da mußten sie schon wieder ihre Koffer packen und die Rückreise antreten.
Als Kestorff sich am nächsten Mittag „von Urlaub zurück” gemeldet hatte und nach Haus kam, fuhr seine Frau bei seinem Anblick erschrocken in die Höhe. „Um Gottes willen — wie siehst Du aus? — Wa sist geschehen? Sprich! — Ist jemand gestorebn? Gewiß, ich irre mich nicht — foltere mich nicht länger, wer ist es ?”
„Ich leider nicht,” stöhnte er, während er in einen Stuhl sank, „aber ich wollte, es wäre Nacht oder die Preußen kämen.”
„Aber so rede doch,” drängte sie, „was ist geschehen? So sprich doch!”
„Setz Dich auf einen Stuhl,” riet er, „und halte Dich mit beiden Händen fest oder rufe den Burschen, daß er Dich festbindet. Mache Dich auf das Schlimmste gefaßt.”
„Aber so sprich doch!” bat sie noch einmal — Angst und Furcht vor dem Kommenden sprachen aus ihren Zügen.
„Weißt Du wohl, daß heute Mittwoch ist, der Tag, an dem wir unsere Gesellschaft geben wollten? Ja? dann kann ich mich kurz fassen. Frau von Kramsta ist krank geworden, die Gesellschaft ist abgesagt, der Oberst kommt heute abend zu uns.”
„Du bist wahnsinnig,”rief sie voll Entsetzen.
„Ich würde die letzten fünfzig Mark, die ich aus Berlin mitgebracht habe, dafür ausgeben, wenn ich wirklich wahnsinnig wäre,” sagte er, „dann säße ich heute abend sicher hinter Schloß und Riegel, und niemand käme zu mir.”
„Wie ist denn aber nur so etwas möglich?” fragte sie.
„Die Sache ist sehr einfach,” gab er zur Antwort, „der Oberst empfing mich sehr freundlich, erzählte mir, daß die Gesellschaft bei Kramsta abgesagt sei und fragte mich, ob wir vielleicht noch für ihn und seine Gattin Platz hätten.”
„Und Du hst ,ja' gesagt?” fragte sie verzweifelt, die Hände ringend.
„Gott sei es geklagt — ja,” gab er zur Antwort — „ich bekam einen solchen Schrecken, daß ich zu dem langen Wort ,nein' nicht die physische Kraft besaß. Außerdem bedenke: wir haben Urlaub gehabt, um für die Gesellschaft einzukaufen, da konnte ich doch heute mittag nicht sagen, daß wir keine Gäste erwarteten.”
Frau Marie saß verzweifelt in ihrem Stuhle und weinte die bittersten Tränen. „Du tust mir ja leid,” versuchte er sie zu trösten, „und ich selbst tu mir ja noch viel leider. Aber das hilft nun alles nichts, die Gesellschaft muß gegeben werden.”
Sie sprang in die Höhe „Was? Du verlnagst doch nicht von mir, daß ich heute abend wirklich Gäste bei uns sehe? Außerdem haben wir ja niemand, und selbst wenn Du noch einige Familien auftreibst, die Mitleid und Erbarmen mit uns haben, es geht nicht, es geht absolut nicht! Ich habe nichts im Hause — es geht nicht, es geht bei dem besten Willen nicht.”
Aber es mußte gehen, und es ging.
Herr von Kestorff raste durch die Stadt und lud seine Gäste ein; Frau Marie fuhr mit einer Droschke von einem Laden zum anderen und machte Besorgungen, der Diener putzte alles Silber und alle Lampen, die Mädchen waren in der Küche beschäftigt — alles in fieberhafter Tätigkeit.
Als Kestorff nach zwei Stunden nach Haus kam, hatte er die Zuage von vier verheirateten Offizieren und zwei Junggeellen, im ganzen waren sie nun vierzehn Personen.
Es war fünf Uhr nachmittags, im Hause herrschte ein Durcheinander wie auf einem Jahrmarkt, da klingelte es an der Tür und für den Hausherrn wurde ein Brief abgegeben.
„Doch hoffentlich keine Absage?” fragte seine Frau, „sonst mußt Du Dich noch einmal auf den Weg machen, weniger als vierzehn können wir auf keinen Fall sein.”
Er öffnete das Billett und las und las.
„Verstehst Du das?” fragte er, und reichte seiner Frau die Zeilen, und mit lauter Stimme las sie:
„Lieber Kestorff!
Als ich mich heute mittag bei Ihnen zu heute abend ansagte, wußte ich nicht, daß meine Frau schon bei dem Regierungsrat Haase für heute abend zugesagt hatte, die heute morgen uns mündlich eingeladen haben. So muß ich Ihnen, so leid es mir tut, doch nun wieder eine Absage schicken. Ich bedaure dies aufrichtig und werde morgen mit meiner Frau kommen, um mich noch persönlich bei Ihrer sehr verehrten Frau Gemahlin und bei Ihnen zu entschuldigen. Mich beruhigt etwas die Tatsache, daß Sie ja ursprünglich nicht auf uns gerechnet haben — so haben Sie jetzt wenigstens nicht nötig, die Tischordnung zu ändern.
Mit bestem Gruße Ihr
v. Bendheim
Oberst und Regimentskommandeur.”
Da klirrten in der Küche eine Anzahl zu Boden fallender Teller.
„Laß nur die Gnädige das nicht hören,” riet die Köchin mit lauter Stimme.
Aber „die Gnädige” hörte nichts — ihr war alles einerlei — was lag daran, ob das Geschirr in Scherben ging oder nicht? — Sie war, als sie Besorgungen machte, in einem Laden mit der Frau Regierungsrat Haase zusammengetroffen und hatte ihr die Geschichte ihrer Gesellschaft erzählt.
Mit keiner Silbe hatte die Haase erwähnt, daß sie selbst am Abend den Oberst erwartete, nur ein paarmal hatte sie gesagt: „Das ist ja sehr interessant.”
Daß die Haase diese Neuigkeit nicht für sich behielt, sondern sie heute abend dem Kommandeur und was noch schlimmer war, der Kommandeuse erzählen würde, stand felsenfest.
Nie und nimmer aber durfte das geschehen und so machte sich Herr von Kestorff, mit einem Blumenstrauß „bewaffnet”, denn auf den Weg, um die wegen ihrer Geschwätzigkeit gefürchtete Frau Regierungsrat um Stillschweigen zu bitten.
Schon nach einer kleinen halben Stunde kehrte er zurück. „Nun? War sie zu Hause?” fragte seine Frau, ängstlich in seinem Gesicht lesend, „und was hat sie Dir geantwortet?”
Einen Augenblick zögerte Herr von Kestorff noch, dann sprach er: „Sie sagte zu mir: ,Wie schade, daß Sie nicht einen Augenblick eher kamen, ich habe Bertha, mein Mädchen, gerade mit der interessanten Neuigkeit zur Stadt geschickt!'”
Da gab die kleine Frau jeden weiteren Widerstand auf und demütig beugte sie sich vor dem Unvermeidlichen.
De locomotief, Samarangsch handels- en advertentie-blad vom 2.9.1899;
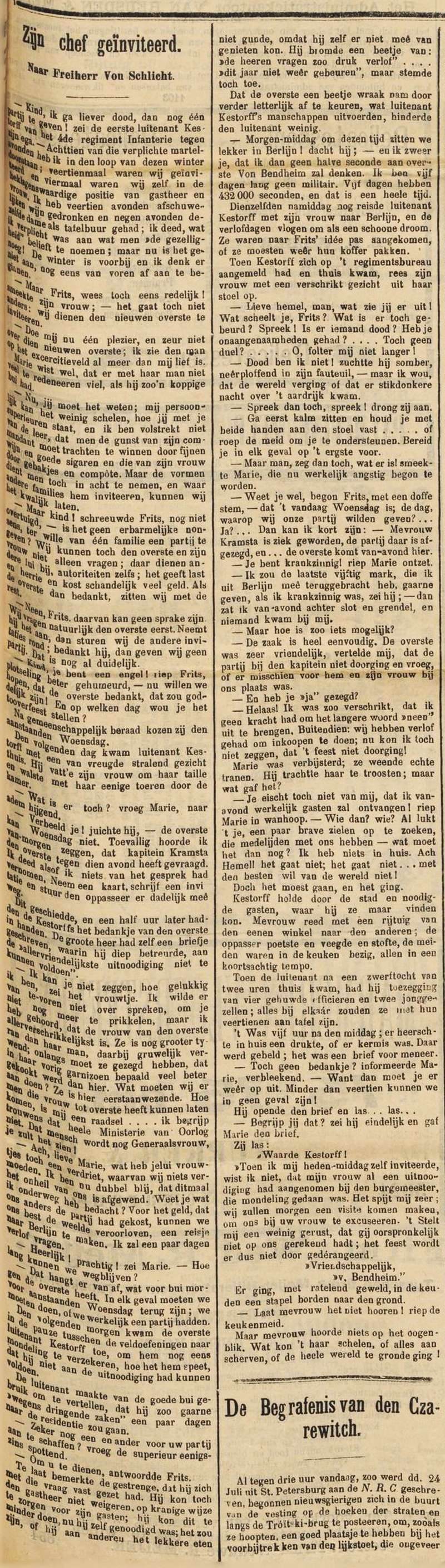
„De Sumatra Post” vom 11.9.1899: