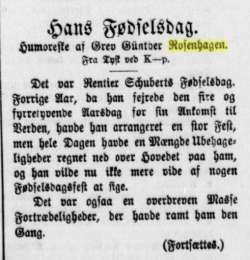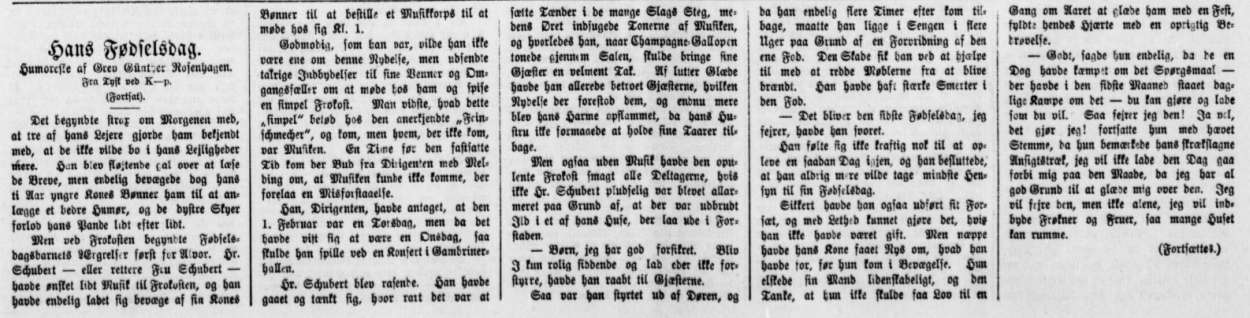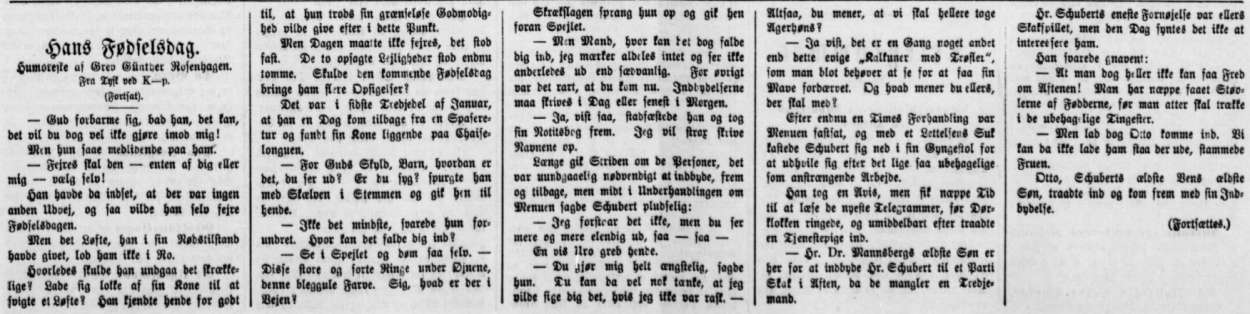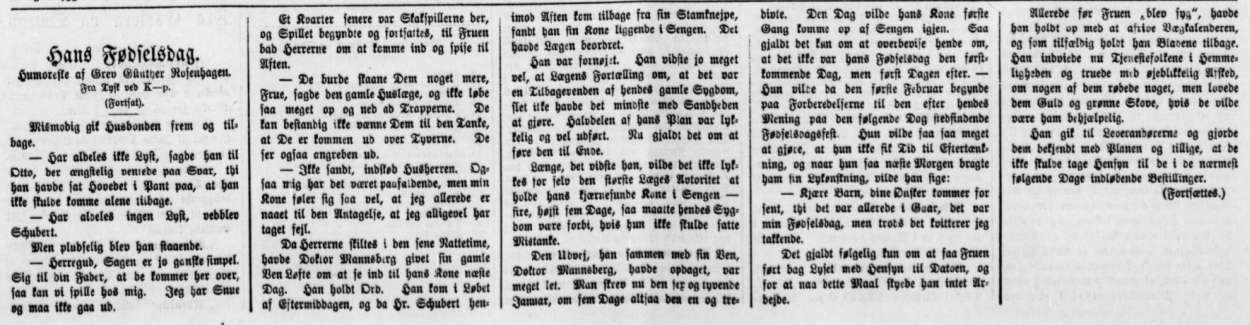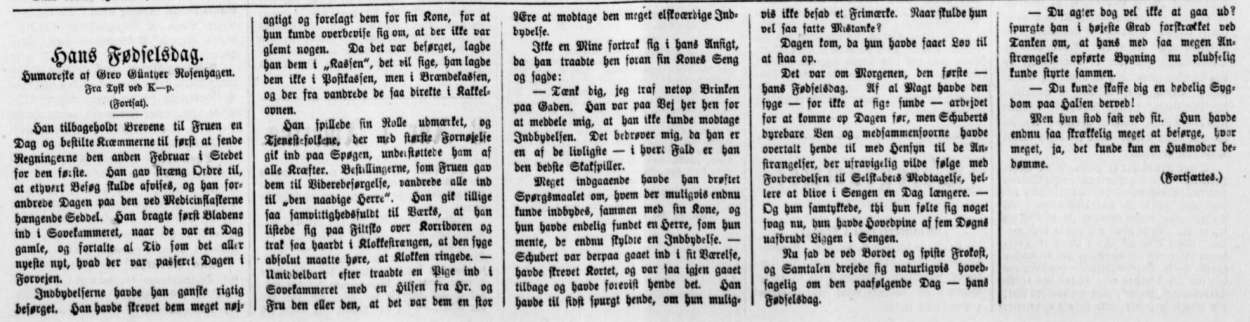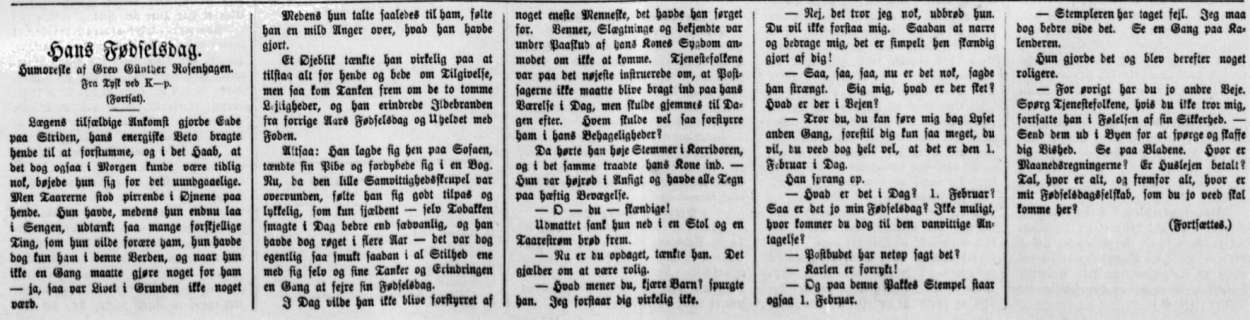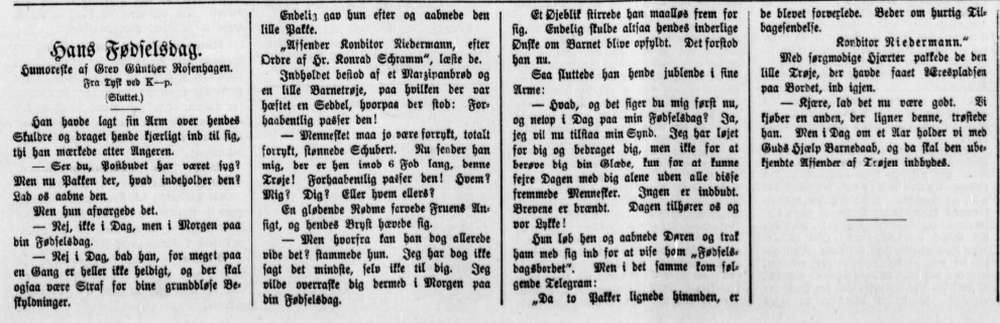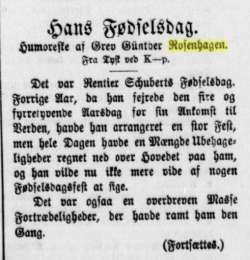
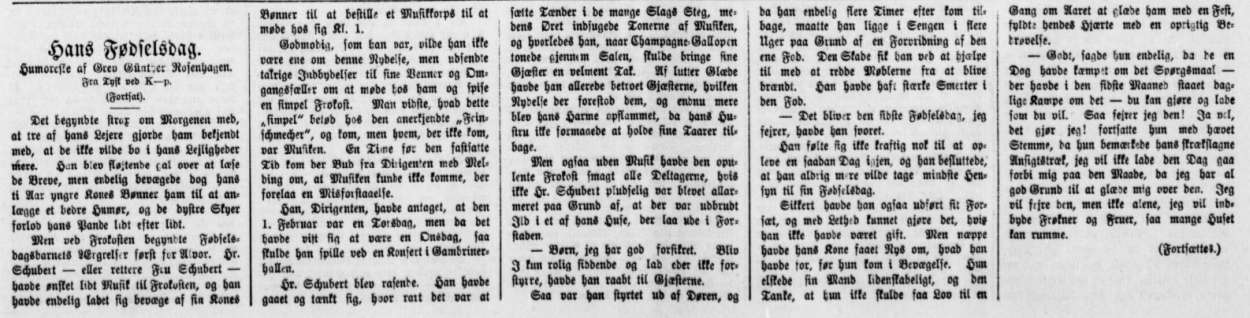
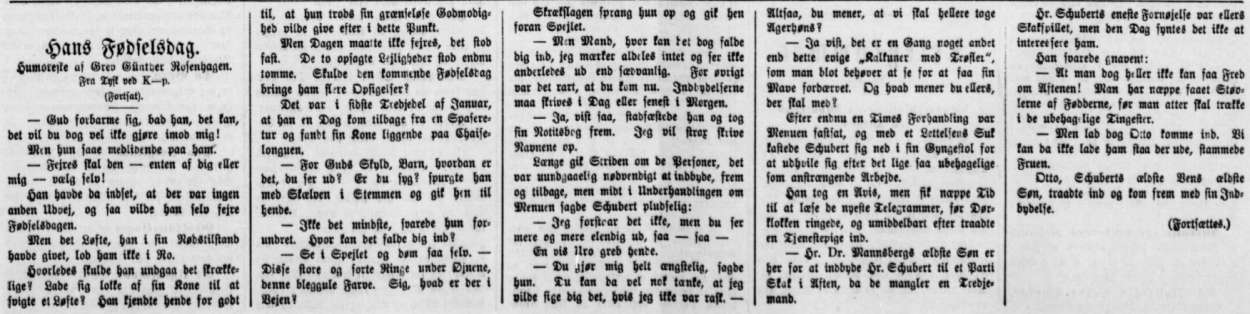
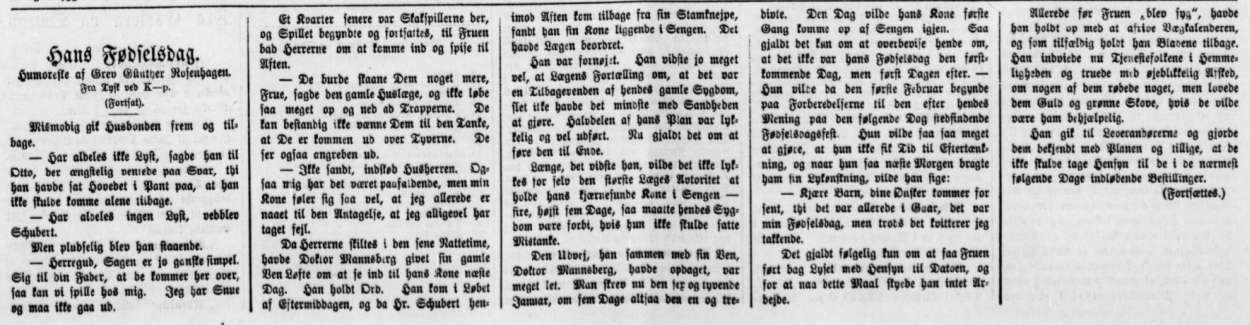
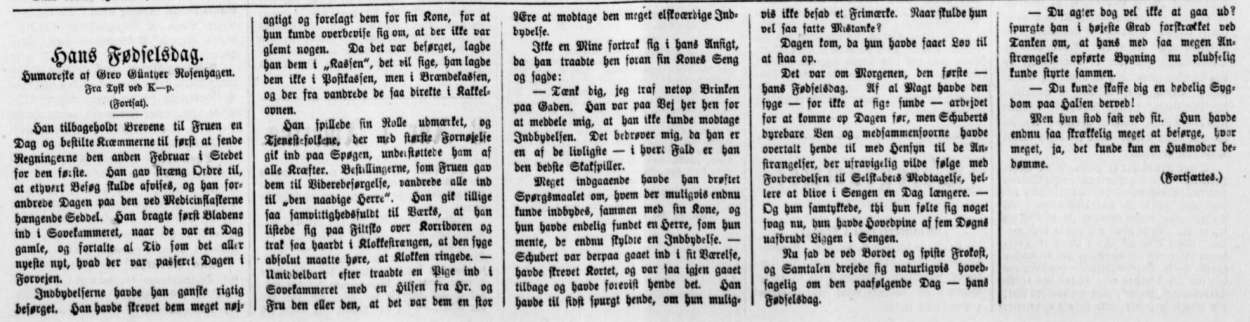
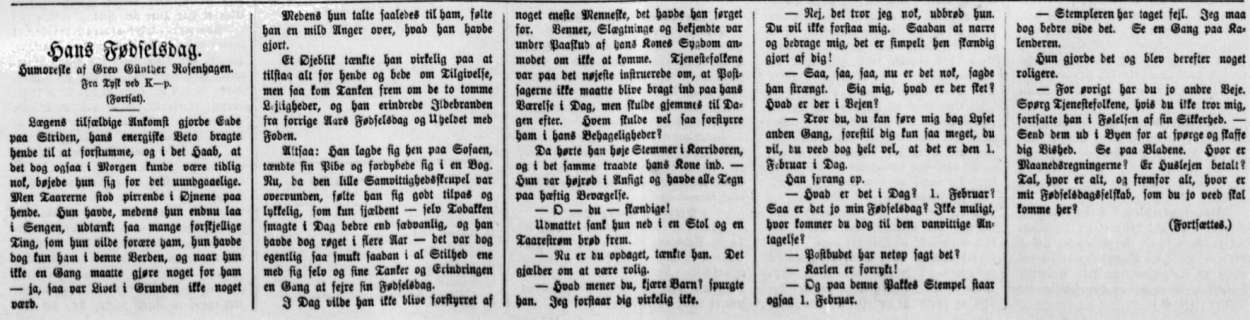
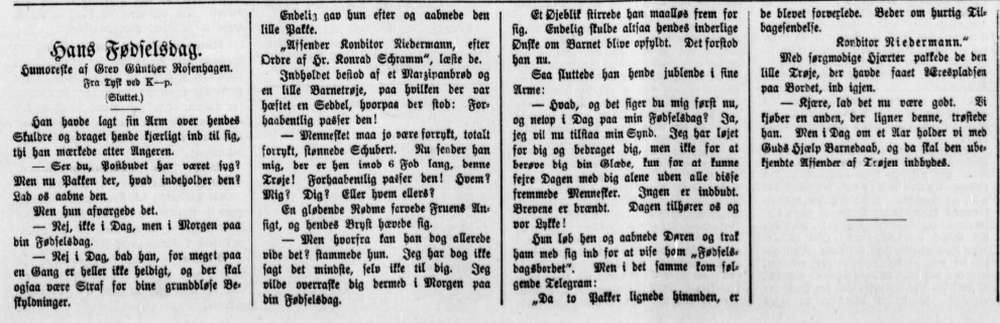
Humoreske von Graf Günther Rosenhagen.
in: „Deutsche Lesehalle”, Sonntags-Beilage zum Berliner Tageblatt, Nr. 30, 29.7.1894, Seite 233,
in: „Frederiksborg Amts Avis” vom 10.8., 11.8 und 12.8.1894, (in dänisch unter dem Titel „Hans Fødselsdag”),
in: „Pittsburger Volksblatt” vom 16.8.1894,
in: „Esbjerg Folkeblad” vom 5.2., 6.2., 7.2., 8.2., 9.2., 10.2. und 12.2.1895, (in dänisch unter dem Titel „Hans Fødselsdag”),
in: „Lemvig Folkeblad” vom 6.2., 7.2., 8.2., 9.2., 10.2., 12.2. und 13.2.1895, (in dänisch unter dem Titel „Hans Fødselsdag”),
in: „Kolding Folkeblad” vom 5.2., 6.2., 7.2., 8.2., 9.2., 11.2. und 12.2.1895, (in dänisch unter dem Titel „Hans Fødselsdag”),
in: „Viborg Stifts Folkeblad” vom 5.2., 6.2., 7.2., 8.2., 9.2., 10.2. und 12.2.1895, (in dänisch unter dem Titel „Hans Fødselsdag”),
in: „Holstebro Dagblad” vom 6.2., 7.2., 8.2., 9.2., 10.2., 12.2. und 13.2.1895, (in dänisch unter dem Titel „Hans Fødselsdag”),
in: „Humoresken” und
in: „Humoresken und Erinnerungen”.
Der Rentier Schubert hatte heute Geburtstag. Im vorigen Jahr hatte er den Tag, an dem er vor fünfundvierzig Jahren das Licht der Welt erblickte, festlich begehen wollen, aber der ganze Tag hatte sich nur aus einer Menge von Unannehmlichkeiten zusammengesetzt, und darum wollte er von keiner Geburtsgsfeier mehr etwas wissen.
Es war auch ein Uebermaß des Verdrusses an dem vorjährigen Geburtstag gewesen. Der Morgen hatte damit begonnen, daß drei seiner Miether — Herr Schubert war mehrfacher Hausbesitzer — ihm kündigten. Nicht gerade in der rosigsten Laune hatte er diese Briefe gelesen, aber endlich hatten die Bitten seiner um zehn Jahre jüngeren Frau, sich durch eine solche Kleinigkeit doch nicht den Humor verderben zu lassen, die Wolken von seiner Stirn verscheucht.
Beim zweiten Frühstück hatte der Aerger für das Geburtstagskind erst recht begonnen. Herr Schubert — oder wohl besser gesagt Frau Schubert — hatte sich zu dem festlichen Tage ein Ständchen gewünscht, und endlich hatte er den Bitten nachgegeben und sich eine Kapelle bestellt, die Mittags um ein Uhr bei ihm spielen sollte. Gutmüthig wie er war, wollte er dieses Genusses nicht allein theilhaftig werden, und er versandte zahlreiche Einladungen an seine Freunde zu einem einfachen Frühstück. Man wußte, was bei dem großen Feinschmecker dies „einfach” bedeute, und kam — wer aber nicht kam, war die Kapelle. Eine Stunde vor der festgesetzten Zeit war ein Bote des Dirigenten mit der Meldung erschienen, die Musik könne nicht kommen, da ein Mißverständniß vorliege; er, der Kapellmeister, habe geglaubt, der erste Februar wäre an einem Donnerstag, nun falle er aber auf einen Mittwoch, und ein- für allemal müsse er an diesem Tage zum Frühschoppen in der Gambrinushalle aufspielen.
Herr Schubert war wüthend. Er hatte es sich so schön gedacht, nach den Klängen der Cavalleria rusticana in das Brathun zu beißen und bei den Tönen des Champagner-Liedes das Wohl seiner Gäste auszubringen. In der Freude seines Herzens hatte er allen seinen Freunden anvertraut, welcher Genuß ihnen bevorstände. Sein Zorn wurde dadurch noch mehr entflammt, daß seine Frau ihre Thränen nicht zurückzuhalten vermochte.
Aber auch ohne die Musik hätte das opulente Frühstück wohl allen Theilnehmern ausgezeichnet geschmeckt, wenn Herr Schubert nicht plötzlich durch die Nachricht aufgeschreckt worden wäre, daß in seinem in der Vorstadt gelegenen Hause Feuer ausgebrochen sei.
„Kinder, ich bin gut versichert, bleibt ruhig sitzen und laßt Euch nicht stören,” hatte er seinen Gästen zugerufen. Dann war er davongestürzt, und als er endlich nach vielen Stunden heimkehrte, mußte er sich für mehrere Wochen niederlegen, denn eine Quetschung des linken Fußes, die er sich bei dem Herausschaffen der bedrohten Möbel zugezogen hatte, verursachte ihm starke Schmerzen und machte jedes Aufsetzen und Bewegen des Fußes zur Unmöglichkeit.
„Das ist mein letzter Geburtstag gewesen, den ich feiere,” hatte er sich zugeschworen. Einen solchen Tag noch einmal durchzustehen, dem fühlte er sich nicht gewachsen, und er nahm sich fest vor, nie und nimmermehr jemals wieder von seinem Geburtstag die geringste Notiz zu nehmen.
Sicherlich hätte er auch seinen Vorsatz ausgeführt und mit Leichtigkeit ausführen können, wenn er nicht verheirathet gewesen wäre. Kaum aber hatte seine Frau seinen Entschluß vernommen, als sie in berechtigte Aufregung gerieth. Sie liebte ihren Mann leidenschaftlich, und der Gedanke, ihm gar keine Feier bereiten zu können, erfüllte ihr Herz mit aufrichtiger Betrübniß.
„Gut,” sagte sie endlich, als sie sich einmal wieder, wie in den letzten Monaten täglich, über diesen Punkt gestritten hatten, „Du kannst thun und lassen, was Du willst. Dann feiere ich ihn! Jawohl, das thue ich,” fuhr sie mit erhobener Stimme fort, als sie sein entsetztes Gesicht bemerkte, „ich will den Tag nicht so vorübergehen lassen, denn ich habe alle Ursache, mich über seine Wiederkehr zu freuen. ich will ihn feiern, aber nicht allein, Alle, Alle lade ich sie ein, die Frau Steuerräthin und die Frau Kanzleiräthin, die Frau Landrentmeister und die Frau Rendantin, jawohl, die kommen Alle und noch viel, viel mehr, soviel ich nur irgendwie setzen kann.”
„Erbarmen,” flehte er, „das kannst, das willst Du mir nicht anthun!”
Aber mitleidslos blickte sie ihn an. „Gefeiert wird — entweder Du oder ich — wähle.”
Er hatte einsehen müssen, daß ihm kein anderer Ausweg blieb, und so wollte er denn selber feiern.
Aber das Versprechen, das er in der Noth gegeben hatte, ließ ihm keine Ruhe.
Wie sollte er dem Schrecklichen entgehen? Sich von seiner Frau sein Versprechen zurückgeben lassen? Er kannte sie zu gut, um nicht zu wissen, daß sie trotz ihrer grenzenlosen Güte in manchen Punkten unerweichlich war.
Aber gefeiert werden durfte der Tag nicht, das stand bei ihm fest: die beiden vor einem Jahr gekündigten Etagen standen noch immer leer. Sollte ihm sein Geburtstag noch mehr Kündigungen einbringen?
Es war in dem letzten Drittel des Januar, als er eines Tages, von einem Spaziergang heimkehrend, seine Frau auf der Chaiselongue liegend fand.
„Um Gotteswillen, Kind, wie siehst Du aus? Fehlt Dir etwas?” fragte er, besorgt auf sie zutretend.
„Nicht das Geringste,” antwortete sie verwundert, „wie kommst Du nur auf diese Vermuthung?”
„Sieh in den Spiegel und urtheile dann selbst: diese großen, schwarzen Ränder unter den Augen, die fahle, gelbliche Farbe, sag', was ist Dir?”
In Schrecken versetzt war sie aufgesprungen und vor den Spiegel getreten.
„Aber Mann, ich bitte Dich, ich weiß gar nicht , was Du hast, ich sehe doch nie anders aus. Uebrigens schön, daß Du kommst, die Einladungen müssen heute oder spätestens morgen geschrieben werden.”
„Gewiß,” bestätigte er, sein Notizbuch hervorziehend, „ich will mir gleich die Namen aufschreiben.”
Lange ging der Streit über die unumgänglich nothwendigen Personen hin und her, mitten in der Unterhaltung über das Menu aber sagte Schubert plötzlich: „Ich weiß gar nicht, Kind, was Du hast, Du siehst mit einem Mal wieder so elend aus, so — so —”
Eine gewisse Unruhe ergriff sie. „Du machst mich ja ganz ängstlich, ich würde es Dir doch sagen, wenn ich mich nicht wohl fühlte. Also, Du meinst lieber Schneehühner?”
„Ja gewiß,” pflichtete er ihr bei, „es ist einmal etwas Anderes als diese ewigen Puter mit Trüffeln, bei deren bloßem Anblick man sich schon den Magen verdirbt. Und was meinst Du sonst noch?”
Nach einer weiteren Stunde war das Menu festgesetzt, und mit einem Seufzer der Erleichterung setzte sich der Rentier in seinen Sorgenstuhl, um sich von dieser ebenso angenehmen wie anstrengenden Arbeit zu erholen.
Kaum aber hatte er die neuesten Telegramme in seiner Zeitung gelesen, als die Glocke gezogen wurde und gleich darauf das Mädchen das Zimmer betrat:
„Der älteste Sohn von Herrn Doktor Mannsberg ist da, und der Herr Doktor lassen bitten, ob der Herr Schubert nicht zum Skat kommen wolle, Herr Doktor hätten Besuch bekommen und nun keinen dritten Mann nicht.”
Für gewöhnlich gab es für Herrn Schubert kein größeres Vergnügen als Skat. Heute aber legte sich sein Gesicht in Falten. „Daß man auch nicht einmal den Abend zu Hause sitzen kann! Eben hat man sich die Stiefel ausgezogen, so muß man sich die dummen, unbequemen Dinger gleich wieder anziehen.”
„Aber so laß doch Otto hereinkommen, Du kannst ihn doch nicht ewig auf dem Flur stehen lassen,” mahnte seine Frau.
Otto, der älteste Sohn seines ältesten Freundes, wurde hineingerufen und brachte von Neuem seine Einladung vor.
Mißmuthig ging der Hausherr auf und ab. „Gar keine Lust,” sagte er zu Otto, der ängstlich auf Antwort wartete, denn es war ihm bei Todesstrafe verboten worden, allein nach Haus zu kommen, „gar keine Lust, muß mich erst ganz wieder umziehen.” Plötzlich blieb er stehen: „Herr Gott, die Sache ist ja ganz einfach: sag Deinem Vater, er möchte seinen Besuch mitbringen und bei mir spielen, ich hätte den Schnupfen und könnte heute nicht ausgehen.”
Eine Viertelstunde später war die Skatpartie zusammen, und das Spiel begann, bis endlich die Hausfrau erschien, um die Herren zum Abendbrod zu bitten.
„Sie sollten sich mehr schonen, gnädige Frau,” sagte der alte Hausarzt im Laufe des Gesprächs, „und nicht so viel treppauf, treppab laufen. Sie können sich immer noch nicht an den Gedanken gewöhnen, daß Sie die Zwanzig überschritten haben. Sie sehen etwas angegriffen aus.”
„Nicht wahr,” fragte der Hausherr besorgt, „auch mir ist es schon aufgefallen, aber meine Frau fühlt sich so wohl, daß ich schon glaubte, mich getäuscht zu haben.”
Als die Herren sich in später Stunde trennten, hatte Doktor Mannsberg seinem Freunde das Versprechen gegeben, sich im Laufe des nächsten Tages einmal nach seiner Frau umzusehen. Er hielt Wort, er kam am nächsten Nachmittag vorgefahren, und als Schubert gegen sieben Uhr von seinem Stammtisch heimkehrte, fand er seine Frau auf Befehl des Arztes im Bett.
Er hätte laut aufschreien mögen vor Vergnügen, wußte doch kein Mensch besser als er, daß seiner Frau nicht das Geringste fehle, und daß die Rückkehr des alten Leidens, die der Arzt seiner Frau eingeredet hatte, gar nicht existirte. Sein Plan war zur Hälfte gelungen, nun galt es, ihn zu Ende zu führen.
Lange, das wußte er, würde es selbst den größten ärztlichen Autoritäten nicht gelingen, seine kerngesunde Frau an das Bett zu fesseln, vier, höchstens fünf Tage, dann mußte ihr Leiden behoben sein, wenn sie nicht Argwohn schöpfen sollte.
Der Ausweg, den er sich mit seinem Freunde Mannsberg zusammen entworfen hatte, um der Feier seines Geburtstags zu entgehen, war der denkbar einfachste. Man schrieb jetzt den sechsundzwanzigsten Januar, in fünf Tagen, also am einunddreißigsten, würde seine Frau zum ersten Mal wieder aufstehen. Dann kam es nur darauf an, seine Frau zu überzeugen, daß sein Geburtstag nicht am nächsten, sondern erst am übernächsten Tage sei. Sie würde dann am ersten Februar beginnen, die Vorbereitungen für die nach ihrer Meinung am folgenden Tage stattfindende Gesellschaft zu treffen, sie würde so viel zu thun haben, daß sie gar nicht zum Nachdenken käme, und wenn sie ihm dann am zweiten Morgens ihre Glückwünsche darbrächte, würde er ihr sagen: „Liebes Kind, Deine Wünsche kommen zwar etwas zu spät, denn mein Geburtstag war schon gestern, aber trotzdem quittire ich sie dankend.”
Es galt also nur, seine Frau über den Tag und über das Datum hinweg zu täuschen, und um dies zu erreichen, scheute er keine Mühe und keine Arbeit.
Schon bevor seine Frau sich niederlegte, hatte er den Kalender nicht abgerissen und ihr die Zeitung wie zufällig vorenthalten. er setzte die Dienstboten von seinem Plan in Kenntniß und drohte mit sofortiger Entlassung, wenn sie ihn verriethen; er versprach ihnen goldene Berge, wenn sie ihm helfen würden.
Er ging zu den Lieferanten und verständigte sich mit ihnen, daß sie die in den nächsten Tagen eingehenden Bestellungen nicht ausführen sollten, er hatte sich Ausreden ersonnen, die er auf ihre erstaunten Gesichter hin erzählte. Er unterschlug die einlaufenden Briefe und bestellte die stets am Ersten eingehenden Kontobücher der Krämer auf den Zweiten. Er gab strenge Anweisung, jeden Besuch abzuweisen, und änderte auf dem der Medizinflasche angehängten Zettel das Datum. Er brachte in das Krankenzimmer stets die bereits vierundzwanzig Stunden alten Zeitungen und erzählte ihr als das Allerneueste, was sich am Tag vorher ereignet hatte.
Die Einladungen hatte er alle richtig besorgt, er hatte sie fein säuberlich geschrieben seiner Frau vorlegen müssen, damit sie auch sicher war, daß Niemand vergessen würde, und dann wurden sie in den Kasten geworfen, aber nicht in den Briefkasten, sondern in den Koakskasten und von da mit der Feuerung in den brennenden Ofen.
Er spielte seine Rolle ausgezeichnet, und die Dienstboten, die mit großem Vergnügen auf den Scherz eingingen, unterstützten ihn nach besten Kräften. Die Bestellungen, die sie der gnädigen Frau überbrachten, waren ihnen stets von dem gnädigen Herrn aufgetragen. Er ging hierbei so gewissenhaft zu Werke, daß er auf Filzschuhen unhörbar über den Korridor schlich und dann so laut, daß die Kranke es hören mußte, an der Glocke zog. Unmittelbar darauf betrat dann eins der Mädchen die Schlafstube „mit einer Empfehlung von Herrn und Frau So und So, und es würde ihnen eine Ehre sein, der liebenswürdigen Einladung Folge zu leisten.”
Keine Miene zuckte in seinem Gesicht, als er an das Bett seiner Frau trat und zu ihr sagte: „Denke Dir nur, soeben traf ich Brinken auf der Straße, er war auf dem Wege zu uns, er hat mir abgesagt. Es thut mir sehr leid, er ist der Netteste von ihnen Allen und auf jeden Fall der beste Skatspieler.”
Ernsthaft hatte er mit seiner Frau besprochen, ob und wen man jetzt noch bitten könne; endlich hatten sie einen Herrn gefunden, dem man noch eine Einladung schuldig war. Schubert war gegangen, um die Karte zu schreiben, und war dann mit dem Brief in der Hand wieder in das Zimmer getreten, um seine Frau zu fragen, ob sie vielleicht eine Freimarke besäße. Wie sollte sie da Argwohn schöpfen?
Der Tag brach an, an dem sie von dem Arzt die Erlaubniß erhielt, aufzustehen; es war der Erste Morgens, sein Geburtstag. Mit aller Gewalt hatte die Kranke, um nicht zu sagen die Gesunde, schon am Tage vorher aufstehen wollen, aber Schuberts theurer Freund und Mitverschworener hatte sie überredet, mit Rücksicht auf die bei der bevorstehenden Gesellschaft unvermeidlichen Unruhen lieber noch einen Tag länger im Bett zu bleiben. Und sie folgte, denn jetzt fühlte sie sich wirklich etwas angegriffen, sie hatte von dem vielen Liegen und Schlafen Kopfschmerzen bekommen.
Nun saßen sie zusammen am Kaffeetisch und nahmen ihr erstes Frühstück ein, und das Gespräch drehte sich natürlich um seinen morgigen Geburtstag, und sie sprach davon, dazu Besorgungen zu machen.
„Du willst doch nicht etwa ausgehen?” fragte er, auf das Aeußerste erschrocken, drohte doch das ganze, mit solcher unsagbaren Mühe aufgebaute Gebäude wieder zusammenzubrechen. „Du könntest Dir bei dem scharfen Ostwinde den Tod holen.”
Aber sie bestand auf ihrem Willen, sie hatte noch so schrecklich viel zu besorgen, wie viel, das konnte nur eine Hausfrau beurtheilen.
Das zufällige Eintreten des Arztes machte dem Streit ein Ende, sein energisches Veto ließ ihren Widerspruch verstummen, und in der Hoffnung, daß es schließlich morgen früh auch noch früh genug sei, fügte sie sich endlich in das Unvermeidliche. Die Thränen traten ihr aber in die Augen; sie hatte sich, während sie im Bett lag, noch so Vieles ausgedacht, was sie ihm schenken und bescheeren wollte, sie hatte doch nur ihn auf der Welt, und wenn sie nicht einmal für ihn mehr ausgehen dürfe, dann lohne es sich doch gar nicht zu leben.
In seinem Herzen fühlte er, während sie also zu ihm sprach, sich etwas wie Reue regen.
Einen Augenblick dachte er daran, ihr Alles zu gestehen und sie um Verzeihung zu bitten; da gähnten ihn in Gedanken die leeren Etagen an, und er erinnerte sich an das im vorigen Jahr ausgebrochene Feuer und die erlittene Quetschung; also er legte sich auf seine Chaiselongue, zündete sich seine Pfeife an und vertiefte sich in die Lektüre eines guten Buches. Nun, da die kleinlichen Gewissensskrupel überwunden waren, fühlte er sich wohl und glücklich wie selten, selbst der Tabak, den er nun schon seit Jahren täglich rauchte, schmeckte ihm heute besser denn je, es war doch eigentlich zu schön, so einmal in aller Ruhe, nur mit sich selbst und seinen Gedanken und Erinnerungen Geburtstag zu feiern.
Kein Mensch würde ihn heute stören, dafür hatte er gesorgt, Freunde, Verwandte und Bekannte waren unter dem Vorwand, daß seine Frau leidend sei, gebeten, nicht zu kommen, die Dienstboten waren auf das Genaueste instruirt, die Postsachen wurden gar nicht erst in das Zimmer gebracht, sondern gleich bis morgen früh versteckt, wer also sollte ihn aus seiner Behaglichkeit aufscheuchen?
Da hörte er auf dem Korridor lautes Sprechen, und gleich darauf trat seine Frau in das Zimmer, hochroth im Gesicht, mit allen Anzeichen der höchsten Erregung.
„O — Du — Schändlicher!”
Vernichtet sank sie auf einen Stuhl, und ein Thränenstrom brach aus ihren Augen.
„Hilf, Samiel hilf,” flehten seine Lippen, „ich bin entdeckt, nun heißt es ruhig sein.”
„Wie meinst Du, liebes Kind?” fragte er gelassen, „ich verstand Dich eben nicht.”
„Ja, das glaube ich Dir,” brauste sie auf, „Du willst mich nicht verstehen, mich so zu belügen und zu betrügen, es ist einfach schändlich von Dir!”
„So, nun ist es aber genug,” sagte er streng, „sprich, was ist geschehen, worum handelt es sich?”
„Glaubst Du, daß Du mich zum zweiten Mal irre führen kannst, verstelle Dich nur, so viel Du willst, Du weißt doch ganz genau, daß heute der erste Februar ist.”
Mit einem jähen Satz fuhr er in die Höhe: „Was ist heute? Der erste Februar? Dann wäre ja heute mein Geburtstag? Nicht möglich, wie kommst Du nur auf diesen Unsinn?”
„Der Postbote hat es mir soeben gesagt.”
„Der Kerl ist verrückt.”
„Und hier auf dem Stempel dieses Packetes steht auch 1.2.”
„Der Stempelaufdrücker ist auch verrückt, ich müßte es doch am besten wissen, sieh einmal auf dem Kalender nach.”
Sie that's und schien etwas beruhigt. „Uebrigens kannst Du Dich ja anderweitig erkundigen,” fuhr er im Gefühl der Sicherheit fort, „frage die Mädchen, wenn Du mir allein nicht glaubst, schicke sie herum in der Stadt und laß sie Erkundigungen einziehen. Sieh in die Zeitung. Wo sind Deine Kontobücher, wo ist die Miethe, sprich, wo ist das Alles, und vor allen Dingen, wo ist mein Geburtstagstisch, den Du mir sicher aufgebaut hättest?”
Er hatte seinen Arm um ihre Schultern gelegt und sie zärtlich an sich gezogen, denn wiederum regte sich in seinem Herzen die Reue. „Siehst Du wohl, daß der Postbote krank ist? Nun aber zeig einmal das Unglückspacket her!”
Aber sie wehrte ihn ab: „Nicht heute, morgen, an Deinem Geburtstag!”
„Nein, heute,” bat er, „zu viel auf einmal ist auch nichts werth, und Strafe für Deine grundlosen Beschuldigungen muß sein.”
Endlich gab sie nach, und gemeinsam öffneten sie das kleine Packet. „Absender Konditor Niedermann, im Auftrage des Herrn Konrad Schramm,” lasen sie. Der Inhalt bestand aus einem Marzipanbrod und einer kleinen Kinderjacke, an der ein Zettel befestigt war mit den Worten: „Hoffentlich paßt sie.”
„Der Mensch ist verrückt geworden,” stöhnte Schubert, „total verrückt geworden, nun schickt er mir, der ich fast zwei Meter lang bin, diese Kinderjacke! Hoffentlich paßt sie! Wem? Mir? Dir? oder wem sonst?”
Glühend erröthend barg seine Frau ihr Gesicht an seine Brust: „Aber woher kann er denn das nur schon wissen?” stammelte sie, „ich habe es doch selbst Dir noch nicht gesagt, ich wollte Dich damit überraschen, morgen, an Deinem Geburtstag.”
Einen Augenblick starrte er sie sprachlos an, endlich sollte ihr heißer Wunsch nach einem Kindlein erfüllt werden?
Dann aber schloß er sie jubelnd in seine Arme: „Was, und das sagst Du mir erst jetzt und gerade heute an meinem Geburtstag? Ja, ich will meine Sünden eingestehen, ich habe Dich belogen und betrogen, aber nicht, um Dir eine Freude zu rauben, sondern um mit Dir allein, ohne fremde Menschen den Tag zu feiern. Niemand ist eingeladen, die Briefe liegen im Ofen, der Tag gehört uns und unserem Glück!”
Sie flog davon, ihm seinen Geburtstagstisch aufzubauen, aber als sie ihn zu den Geschenken führte, brachte der Bote ein Telegramm: „Da beide Packete gleich, dieselben bei der Adressirung verwechselt. Bitte sofortige Rücksendung. Konditor Niedermann.”
Traurigen Herzens packten sie die kleine Jacke, die den Ehrenplatz auf dem Tisch gefunden hatte, wieder ein.
„Laß es gut sein, Liebling,” bat er, „wir kaufen eine andere, die dieser gleich ist. Heute über's Jahr, will's Gott, halten wir Kindtaufe, und der bis jetzt noch unbekannte Spender der kleinen Jacke wird dazu eingeladen, denn er hat uns Beiden, ohne es zu wollen, gezeigt, daß die Menschen an dem Geburtstage noch mehr als sonst zusammengehören, und daß manches Geheimniß, das unser Herz birgt, in der Festesfreude geoffenbart wird.”
„Esbjerg Folkeblad” vom 5.2., 6.2., 7.2., 8.2, 9.2.,10.2. und 12.2.12.2.1895