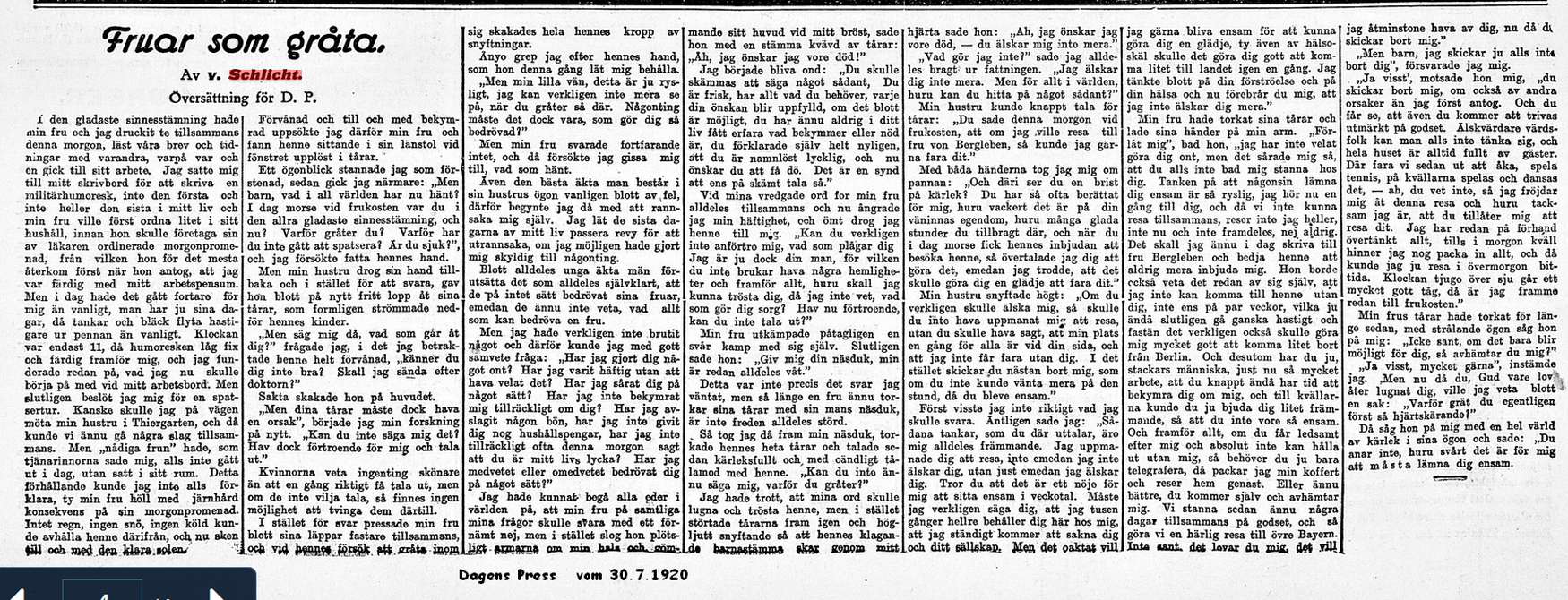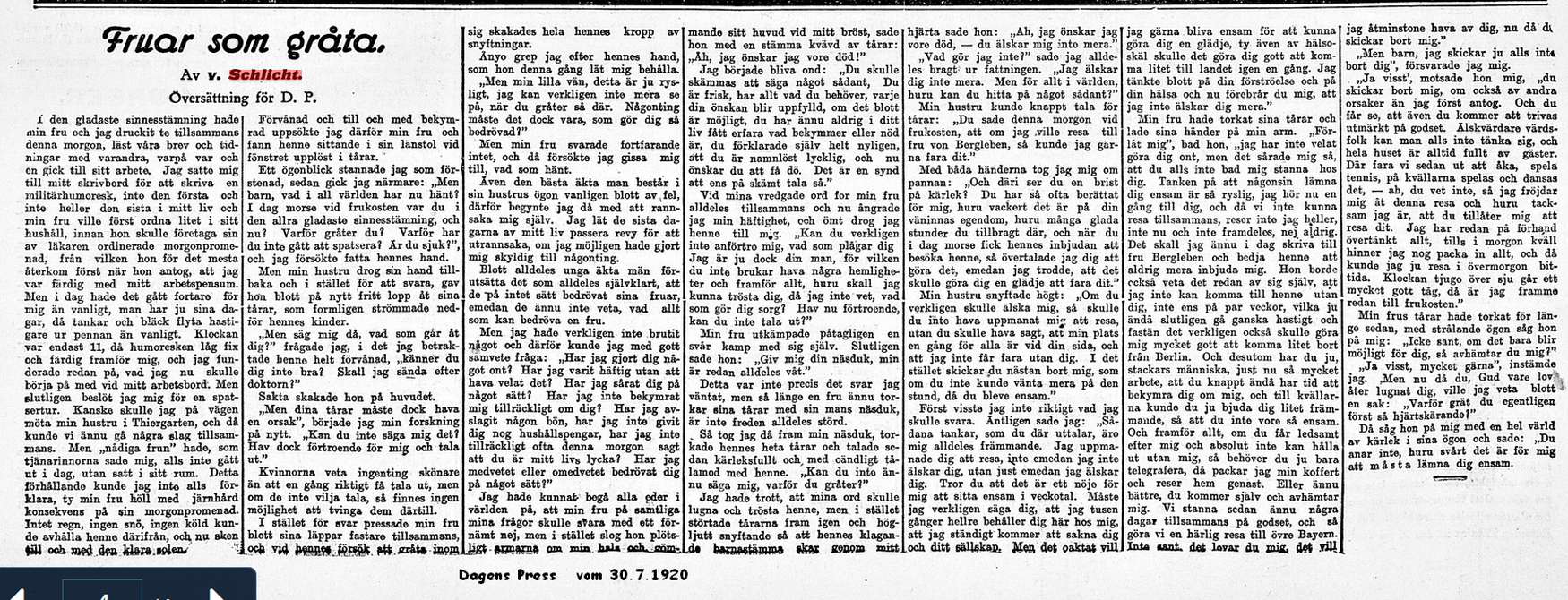
Von Freiherrn von Schlicht.
in: „Hamburger Fremdenblatt” vom 5.Sept. 1909,
in: „Dagens Press” vom 30.7.1920 unter dem Titel „Fruar som gråta” und
in: „Die Frau und meine Frau”.
In der fröhlichsten Stimmung hatten meine Frau und ich morgens den Tee zusammen getrunken, die Zeitungen und Briefe durchgesehen und miteinander besprochen, dann war ein jeder an seine Arbeit gegangen. Ich setzte mich an den Schreibtisch, um nicht die erste und nicht die letzte Militärhumoreske in meinem Leben zu schreiben, und meine Frau wollte sich erst noch um den Haushalt kümmern, bevor sie den ihr vom Arzt verordneten Spaziergang unternahm, vom dem sie meistens erst dann zurückkommt, wenn sie annimmt, daß ich mit meinem Arbeitspensum fertig bin.
Aber heute war es bei mir schneller gegangen als sonst, man hat ja seine Tage, an denen die Gedanken und die Tinte besobnders schnell aus der Feder fließen. Es war erst elf Uhr, als ich die Humoreske fix und fertig vor mir lag und ich überlegte, was ich bis Tisch noch beginnen solle.
Endlich entschloß ich mich zu einem Spaziergang. Vielleicht, daß ich unterwegs in dem Tiergarten meine Frau traf und dann mit ihr noch etwas auf- und abgehen konnte.
Aber die gnädige Frau war, wie die Mädchen mir sagten, heute nicht fortgegangen, sondern säße in ihrem Zimmer.
Das vermochte ich mir gar nicht zu erklären, denn an ihrem Morgenspaziergang hält meine Frau mit eiserner Konsequenz fest. Kein Regen, kein Schnee und keine Kälte vermag sie davon zurückzuhalten, und heute schien sogar die helle Sonne.
So suchte ich denn, verwundert und besorgt zugleich, meine Frau auf und fand sie am Lehnstuhl(1) sitzend, in Tränen aufgelöst.
Einen Augenblick blieb ich wie erstarrt stehen, dann trat ich näher: „Aber Kind, um alles in der Welt, was ist denn nur geschehen? Heute morgen beim Frühstück warst du in der denkbar fröhlichsten Stimmung, und jetzt? Warum weinst du? Warum bist du nicht spazieren gegangen? Bist du krank?” und ich versuchte, ihre Hand zu erfassen.
Aber meine Frau zog ihre Rechte zurück und anstatt zu antworten, liße sie nur von neuem ihren Tränenn freien Lauf — die kullerten ihr förmlich die Wange herunter.
„Aber so sag' mir doch nur, was du hast?” fragte ich, sie ganz verwundert ansehend, „fühlst du dich nicht wohl? Soll ich zum Arzt schicken?”
Leise schüttelte sie den Kopf.
„Aber deine Tränen müssen doch irgend eine Ursache haben?” forschte ich von neuem, „kannst du es mir nicht sagen? Hab' doch Vertrauen zu mir und sprich dich aus.”
Die Frauen kennen nichts Schöneres, als sich einmal ganz gehörig auszusprechen, aber wenn sie sich nicht aussprechen wollen, gibt es keine Möglichkeit, sie zum Sprechen zu bringen.
Anstatt zu antworten, preßte meine Frau die Lippen nur noch fester zusammen, und bei dem Versuch, in sich hineinzuweinen, bebte ihr Körper in konvulsivischen Zuckungen.
Von neuem griff ich nach ihrer Hand, die sie mir dieses Mal auch überließ: „Aber Kleines, das ist doch entsetzlich; ich kann es wirklich nicht mehr mit ansehen, daß du so weinst. Irgend etwas muß dich doch traurig machen?”
Aber meine Frau antwortete immer noch nicht; so versuchte ich zu erraten, was vorlag.
Selbst der beste Ehemann besteht in den Augen seiner Frau zuweilen nur aus Fehlern und Untugenden, so begann ich denn damit, mich selbst zu prüfen. Ich ließ die letzten Tage meines Lebens Revue passieren, ob ich mir vielleicht irged etwas hätte zu schulden kommen lassen.
Nur ganz junge Ehemänner setzen es als selbstverständlich voraus, daß sie ihre Frau in keiner Weise betrübt haben, denn die wissen noch nicht, was alles eine Frau betrüben kann.
Aber ich hatte wirklich nichts verbrochen, und so konnte ich denn mit gutem Gewissen fragen: „Habe ich dir irgend etwas zu leide getan? Bin ich heftig gewesen, ohne es sein zu wollen? Habe ich mich nicht genug um dich gekümmert? Habe ich es an Aufmerksamkeiten irgend welcher Art gegen dich fehlen lassen? Habe ich dir eine Bitte abgeschlagen, dir nicht genug Wirtschaftsgeld gegeben, dir heute morgen nicht oft genug gesagt, daß du das Glück meines Lebens bist, habe ich wissentlich oder unwissentlich irgend etwas getan, das dich traurig macht?”
Ich hätte sämtliche Eide der Welt darauf geschworen, daß meine Frau auf alle meine soeben an sie gerichteten Fragen mit einem lauten vernehmlichen „Nein” antworten würde, statt dessen schlang sie plötzlich die Arme um meinen Hals, und ihren Kopf an meiner Brust verbergend, sagte sie mit tränenerstickter Stimme: „Ach, ich wollte, ich wäre tot!”
Ich begann, böse zu werden: „Du solltest dich schämen, so etwas zu sagen. Du bist gesund, hast alles, was du brauchst, jeder deiner Wünsche wird dir nach Möglichkeit erfüllt, du hast in deinem Leben noch nie kennen gelernt, was Sorge und Not heißt. Du hast mir neulich selbst erklärt, du wärest wunschlos glücklich, und heute willst du sterben. Es ist eine Sünde, wenn auch nur um Scherz, so zu sprechen.”
Meine Frau war bei meinen zornigen Worten zusammengefahren, nun tat mir meine Heftigkeit doch wieder leid und zärtlich zog ich sie an mich: „Kannst du mir denn wirklich nicht anvertrauen, was dich quält? Ich bin doch dein Mann, vor dem du keine Geheimnisse zu haben brauchst, und vor allen Dingen, wie soll ich dich trösten, wenn ich nicht weiß, was dich bedrückt. Hab' doch Vertrauen; kannst du denn wirklich nicht sprechen?”
Meine Frau saß anscheinend in schwerem Kampf da, dann aber sagte sie, immer noch laut schluchzend: „Gib mir dein Taschentuch, mein's ist schon ganz naß.”
Das war zwar nicht gerade die Antwort, die ich erwartet hatte, aber solange eine Frau ihre Tränen noch mit dem Taschentuch ihres Mannes trocknet, ist der Friede noch nicht ganz gestört.
So nahm ich denn das Tuch hervor, trocknete ihr die heißen Tränen und sprach dann mit unendlicher Geduld und Liebe auf sie ein. Dann fragte ich noch einmal: „Kannst du es mir auch jetzt noch nicht sagen, warum du weinst?”
Ich hatte geglaubt, meine Worte hätten sie beruhigt und getröstet, statt dessen stürzten ihr die Tränen jetzt von neuem hervor und so laut aufschluchzend, daß ihre klagende Kinderstimme mir fast das Herz zerschnitt, sagte sie: „Ach, ich wollte, ich wäre tot — du hast mich gar nicht mehr lieb.”
„Was habe ich nicht?” fragte ich fassungslos, „ich habe dich nicht mehr lieb? Aber um alles in der Welt, wie kommst du denn nur darauf?”
Meine Frau vermochte vor Tränen kaum zu sprechen: „Du hast heute morgen bei dem Frühstück gesagt, wenn ich zu Frau von Bergleben wollte, könnte ich gern ein paar Wochen hinfahren.”
Ich faßte mich mit beiden Händen an die Stirn: „Und darin siehst du einen Mangel an Liebe? Du hast mir oft davon erzählt, wie hübsch es auf dem Gut deiner Freundin ist, wieviel frohe Stunden du dort verlebt hast, eine wie nette Gesellschaft du da antriffst, und als heute morgen die Anfrage kam, ob du sie jetzt nicht besuchen wolltest, habe ich dir zugeredet, es zu tun, weil ich glaubte, es würde dir eine Freude bereiten, dorthin zu fahren.”
Meine Frau schluchzte laut auf: „Wenn du mich wirklich lieb hättest, würdest du mir nicht zugeredet haben, sondern hättest mir erklärt, daß mein Platz ein für alle Mal an deiner Seite wäre und daß ich ohne dich nicht fahren dürfe. Statt dessen schickst du mich beinahe fort, als ob du es nicht abwarten könntest, allein zu sein.”
Ich wußte zuerst wirklich nicht, was ich darauf erwidern sollte. Endlich sagte ich: „Solche Gedanken, wie du sie da äußerst, haben mir vollständig ferngelegen. Ich redete dir zu, die Reise zu machen, nicht weil ich dich nicht lieb habe, sondern weil ich dich lieb habe. Glaubst du, daß es für mich ein Vergnügen ist, wochenlang allein zu sitzen? Muß ich dir erst sagen, daß ich dich tausendmal lieber bei mir behielte, daß mir deine Nähe und deine Gesellschaft beständig fehlen wird? Aber trotzalledem, um dir eine Freude zu machen, will ich gern allein bleiben, denn auch gesundheitlich wird es dir sehr gut tun, einmal wieder auf das Land zun kommen. Ich habe nur an deine Zerstreuung und an deine Gesundheit gedacht, und da machst du mir den Vorwurf, ich hätte dich nicht mehr lieb.”
Meine Frau hatte ihre Tränen getrocknet und legte ihre Hände auf meinen Arm: „Entschuldige,” bat sie, „ich habe dir ja nicht wehe tun wollen, aber es hat mich so verletzt, daß du mich gar nicht batest, bei dir zu bleiben. Der Gedanke, dich jemals allein zu lassen, ist mir zu entsetzlich; ich gehöre nun doch einmal zu dir, und wenn wir nicht zusammen reisen können, reise ich auch nicht , weder jetzt noch später, niemals. Das werde ich Frau von Bergleben auch gleich schreiben und sie bitten, mich nie wieder einzuladen. Sie müßte es doch eigentlich von selbst wissen, daß ich ohne dich nicht zu ihr kommen kann, auch nicht auf ein paar Wochen, die ja schließlich schnell vorübergehen, und so gut es mir auch wohl täte, etwas aus Berlin herauszukommen. Und schließlich hast du armer Mensch ja auch gerade jetzt so viel zu arbeiten, daß du doch kaum Zeit findest, dich um mich zu kümmern, und des Abends könntest du dir ja manchmal Besuch einladen, damit du dann wenigstens nicht so allein bist. Und vor allen Dingen, wenn du Sehnsucht nach mir hast und es gar nicht mehr ohne mich aushalten kannst, brauchst du mir ja nur zu telegraphieren, dann packe ich meine Koffer und reise sofort wieder ab. Oder noch besser, du holst mich selbst. Wir bleiben dann noch ein paar Tage auf dem Gut zusammen und machen hinterher noch eine hübsche Reise nach Oberbayern. Nicht wahr, das versprichst du mir, das will ich wenigstens davon haben, daß du mich jetzt fortschickst.”
„Aber Kind, ich schicke dich doch gar nicht fort,” verteidigte ich mich.
„Doch,” widersprach sie, „Du schickst mich fort, wenn auch aus anderen Gründen, als ich vorhin annahm. Und paß nur auf, es wird auch dir auf dem Gut ausgezeichnet gefallen. Liebenswürdigere Wirte lassen sich gar nicht denken, und das ganze Haus ist stets voller Besuch, dann fahren wir spazieren, spielen Tennis, des Abends wird musiziert und getanzt — ach, du weißt ja gar nicht, wie ich mich auf die Reise freue und wie dankbar ich dir bin, daß du mir erlaubst, dorthin zu fahren. Ich habe es mir vorhin schon überlegt, bis morgen abend kann ich alles einpacken und ich könnte dann schon übermorgen früh fahren. Um sieben Uhr zwanzig geht ein sehr guter Zug, dann bin ich gerade zu Tisch an Ort und Stelle.”
Die Tränen meiner Frau waren längst getrocknet, mit strahlenden Augen sah sie zu mir empor: „Nicht wahr, das versprichst du mir aber, wenn es irgend geht, holst du mich ab?”
„Gewiß, sehr gern,” stimmte ich ihr bei. „Aber nun, da du dich Gott sei Dank wieder beruhigt hast, möchte ich nur eins wissen: Warum hast du eigentlich vorhin so herzzerbrechend geweint?”
Da sah sie mich mit einer Welt voll Liebe an und sagte: „Du ahnst ja nicht, wie schwer es mir wird, dich allein lassen zu müssen.”
(1) In der Buchfassung heißt es hier: „und fand sie am Fenster in ihrem Lehnstuhl sitzend”. (zurück)
„Dagens Press” vom 30.7.1920: