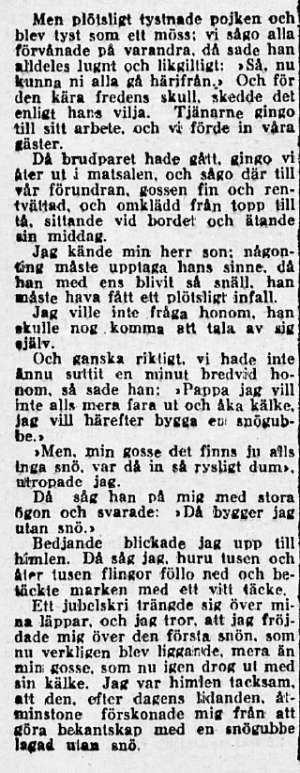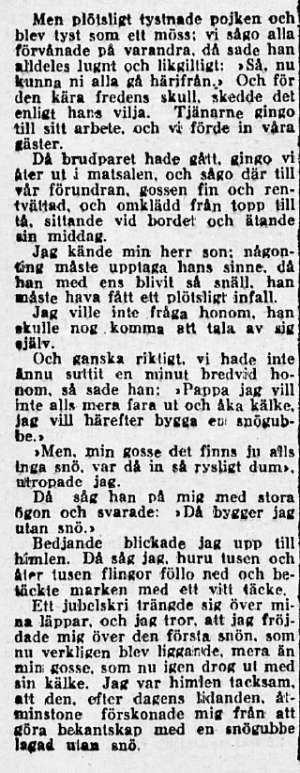
Von Freiherr von Schlicht.
in: „Abendblatt”, (Chicago Ill.), vom 17.01.1899,
in: „Der Deutsche Correspondent” vom 5.2.1899,
in: „Nebraska Staats-Anzeiger” vom 11.1.1900,
in: „Svenska Tidningen” vom 15.11.1919 unter dem Titel „den första snön” und
in: „Ehestandshumoresken”
Wir hatten unserm Jungen zu Weihnachten einen Schlitten geschenkt, und das war eigentlich ein Unsinn, denn am Weihnachtsabend hatten wir das reine Frühlingswetter, es war so warm, daß wir nach der Bescherung am offenen Fenster saßen.
Ich hatte meiner Frau noch am Tage vor dem Fest einzureden versucht, daß ein Schlitten augenblicklich ein Unsinn sei, gebrauchen konnte der Junge ihn ja doch nicht, aber meine schönsten Worte waren zwecklos, sie scheiterten an der ständigen Entgegnung meiner Frau: „Aber er wünscht ihn sich doch so.”
Dagegen ist nichts zu machen, gegen diesen triftigen Grund ist man machtlos, „er wünscht ihn sich so”, folglich mußte er ihn haben, zumal da der Junge unser einziges Kind ist.
Die „einzigen” Kinder haben es eigentlich herrlich, alle Sünden und Vergehen werden ihnen verziehen, und weil es eben „das einzige” ist, bekommt es bei festlichen Gelegenheiten so viel geschenkt, daß es auch für die fehlenden sechs Geschwister mehr als genug wäre.
Das hatten wir so recht bei dem Geburtstag unsers Jungen im Sommer gesehen; was hatte er da nicht alles geschenkt bekommen von uns, den zärtlichen Eltern und noch zärtlicheren Verwandten: von der Trompete, die Gott sei Dank nach der ersten halben Stunde so verbogen war, daß sie keinen Ton mehr von sich gab, bis zu einer Turnerfeuerwehr mit einer kleinen Dampfspritze, vor deren Strahl nichts im Hause sicher war, war alles vorhanden, alles, alles, alles, sogar ein bellender Hund aus Tuch. Dieser Hund bellte, sowie man den Gummiball zusammendrückte, den der Köter an einem Schlauch um den Hals trug, „nur einmal ordentlich drücken, dann bellt er,” hatte mir der Händler in Berlin auf der Friedrichstraße versichert; zu spät merkte ich, daß ich angeführt worden war, der Hund bellte nicht, wenn man den Gummiball zusammendrückte, sondern wenn man selbst mit dem Munde: „Wau-Wau” machte. Dann bellt alles, selbst eine Litfaßsäule.
Staunend hatten wir mit unserem Jungen den Geburtstagstisch bewundert und ihn dann gefragt: „Na, Bengel, freust du dich nun wenigstens darüber, daß alle Menschen deinetwegen so viel Geld ausgegeben haben?”
Da hatte der Knirps von drei und einem halben Jahr mich mit seinen großen blauen Augen angesehen und statt „Danke” nur gesagt:
„Weihnachten bekomme ich einen Slitten, und wenn es denn sneet, denn fahre ich mit dem Slitten spazieren, nich Pappen?”
Was vor ihm auf dem Tische lag, hatte keinen Reiz mehr für ihn, ihn lockte nur das Zukünftige, und „der Slitten” spielte fortan die Hauptrolle in seinem Leben.
Wenn er des Mittags sein Fleisch nicht essen wollte, oder wenn er die „Bratpardoffeln” (Bratkartoffeln) liegen ließ, hieß es: „Wer seinen Teller nicht leer ißt, kann keinen Schlitten bekommen.”
Das half stets Wunder, viele Wochen hindurch, aber einmal verfehlte auch diese Redensart ihre Zauberwirkung; er sollte etwas aufheben, das er im Zorn auf die Erde geworfen hatte. Er war in Güte nicht dazu zu bewegen.
„Gut, dann bekommst du auch keinen Schlitten.”
Da sah der Bengel mich frech an und sagte: „Ich will auch gar keinen haben, das hab' ich man immer so gesagt.”
„Na,” sagte ich, „es ist nur gut, daß ich das weiß, dann kann Wilhelm (unser Diener) den Schlitten ja gleich wieder zu dem Kaufmann bringen,” und ich stand auf, anscheinend, um meine Drohung auszuführen; mit großen Augen sah er mir nach.
Am Nachmittag kam mein Junge zu mir.
„Pappen, zeig' ihn mir mal.”
Ich saß bei der Arbeit und wußte nicht, was Nüter, so wird unser Bube frei nach Hanne Nüte genannt, wollte.
„Du Pappen, zeig' mich 'mal den Slitten.”
Ach so, das war's.
Ich machte mein ernstestes Gesicht, in dem sich schwerer Kummer und die Betrübnis, einen so ungeratenen Sohn zu haben, aussprachen, und sagte dann mit wehmütiger Stimme: „Das geht nun leider nicht, Wilhelm hat den Schlitten heute Nachmittag fortgebracht.” Feierliche Stille.
„Du Pappen,” klang es da wieder.
„Nun?”
„Du Pappen, Wilhelm hat gesagt, das wäre gar nicht wahr.”
Einen Augenblick war ich unangenehm berührt, auf einer Lüge ertappt zu sein, dann sprach ich mit Nachdruck: „Was dein Vater sagt, ist immer wahr, auch wenn Wilhelm sagt, daß es nicht wahr ist, das merke dir, mein Sohn, und nun geh' hin und spiele! Das aber sage ich dir im voraus: wenn du mit deiner Dampfspritze wieder Mamas Gartenhut begießt, damit die daran befindlichen Papierblumen ordentlich wachsen, gibt es Klaps; verstanden?”
Etwas beleidigt zog mein Sohn und Erbe von danen.
Selbstverständlich war der Schlitten vom nächsten Tage an wieder sein Lieblingswunsch, es verging kein Tag, an dem er nicht wenigstens dreimal sagte:
„Und Weihnachten krieg' ich einen Slitten, nich Pappen?”
„Abwarten,” lautete die Antwort.
„Und wenn ich denn ein Slitten hab', denn fahr' ich Slitten, nich Mama?”
Es war, um nervös zu werden.
Und nun war der Schlitten da, ein leichtes, zierliches, dabei aber doch festes und solide gearbeitetes Ding, ein Meisterstück der modernen Baukunst.
Der Jubel des Jungen kannte keine Grenzen, er war so erfreut, daß er gar nicht daran dachte, sich sofort etwas neues zum Geburtstag zu wünschen.
Das tat meinem väterlichen Herzen wohl.
„Morgen fahre ich Slitten, nich Pappen?”
„Gewiß,” gab ich zur Antwort, „wenn morgen Schnee da ist.”
Langes Nachdenken.
„Und wenn kein Snee da ist, fahre ich in der Stube Slitten, nich Mama?”
Aber davon wollte selbst die zärtliche Mama nichts wissen, ihre Teppiche und ihre schön geölten Fußböden lagen ihr denn doch zu sehr am Herzen.
„Das geht nicht, mein Liebling,” gab sie zur Antwort, „Nüter fährt Schlitten, sobald Schnee ist, und wenn Nüter ganz artig ist, schenkt dein Papa dir auch noch einen Zügel mit kleinen Schellen.”
„Das fällt deinem Papa gar nicht ein,” gab ich zur Antwort — in Parenthese sei es hier gleich bemerkt, daß der Jungen, um Wilhelm, der darüber wahrscheinlich sehr erfreut gewesen sein wird, ordentlich einspannen zu können, den Zügel am nächsten Tage doch erhielt.
Als der Herr Sohn am Weihnachtsabend endlich schlafen ging, wollte er natürlich den Schlitten mit zu Bett nehmen; nach langen Unterhandlungen, vielen Tränen und vielen Ermahnungen wurde ein Kompromiß dahin abgeschlossen, daß an dem Schlitten ein Band befestigt wurde, das Herr Nüter während des Schlafens in der Hand behalten durfte.
Am nächsten Morgen, als der Junge Schlitten fahren wollte, war, so weit das Auge reichte, selbst mit Hilfe eines augezeichneten Fernglases keine Schneeflocke zu entdecken.
Kinder wollen mehr wissen, als die sieben Weisen Griechenlands zu beantworten vermöchten, und so sagte der Junge denn:
„Pappen, warum hat es nicht gesneet?”
Eltern müssen stets so tun, als ob sie alles wissen, und so sagte ich denn: „Das kommt, weil du gestern Abend nicht artig zu Bett gegangen bist, das ist die Strafe.”
„Dann will ich nun ganz artig sein, dann gibt das morgen aber auch Snee, nich Papa?”
Am nächsten Morgen war natürlich auch kein Schnee da.
Wieder wollte mein Junge dafür eine Erklärung haben.
Ich erzählte ihm das Märchen von Frau Holle.
„Warum hat Frau Holle denn ihr Bett heute Morgen nicht gemacht?”
„Frau Holle ist verreist,” gab ich zur Antwort.
„Woher weißt du das, Papa?”
„Ich habe heute Morgen einen Brief von ihr erhalten, sieh, hier ist er,” und ich zeigte ihm eine alte Postkarte.
„Warum ist Frau Holle denn verreist?”
Ja, wußte ich es?
„Ihr eines Kind ist krank, aber sobald sie wieder zurück ist, will sie ihr Bett machen, dann kann Nüter schön Schlitten fahren.”
„Kommt sie bald wieder zurück?”
Ich sah nach dem Kalender, es war der 26. Dezember, einmal mußte es doch Winter werden, so sagte ich denn: „Gewiß, sie kommt bald zurück.”
Aber Frau Holle kam nicht.
„Ist das tleine Tind immer noch krank?” fragte mich der Junge nach ein paar Tagen.
„Leider, leider,” sagte ich, „aber es wird nun bald wieder ganz gesund.”
Woche auf Woche ging dahin, und bald sehnte ich den ersten Schnee nicht weniger sehnsüchtig herbei als mein Junge, ich wußte keine Ausreden mehr, die ewigen Fragen: „Pappen, gibt es morgen Snee?” fingen an, mich nervös zu machen.
So kam der siebente Februar heran; nie werde ich den Tag vergessen.
Ich war am Abend vorher in einer Vereinssitzung gewesen und spät, sehr spät nach Hause gekommen.
Ich lag noch im besten Schlummer, als ich davon erwachte, daß mich jemand an meinen Schnurrbarthaaren zog — zu den angenehmsten Gefühlen der Welt gehört dieses gerade nicht.
„Pappen, Pappen, wach doch auf.”
Vor mir stand mein kleiner Junge, so frisch und rosig, daß ich es nicht über mein Herz brachte, ihn wegen der Schmerzen, die er mir verursacht hatte, zu schelten.
„Pappen, bist du wach?”
Ich gab ihm einen Kuß.
„Pappen, weißt du was?”
„Nun?”
„Pappen, es hat gesneet, Frau Holle ihr tleines Tind ist nun wieder ganz gesund, das is man schön, nich Papa? Nun tommt es nicht zum lieben Gott zu unserm kleinen Bruder, nich Papa?”
Herr Nüter machte ein ganz erstauntes Gesicht, als ich ihm anstatt jeder Antwort noch einen Kuß gab.
„Pappen, nun kann ich Slitten fahren.”
„Das versteht sich, ruf einmal Wilhelm, der kann gleich mit dir im Garten spielen.”
„Erst muß ich zur Schule gehen, aber wenn ich dann zurückkomme, dann kann ich mit dem Slitten fahren nich?”
Mein Junge war klüger als ich, im Augenblick hatte ich ganz vergessen, daß er seit einem Vierteljahr den Kindergarten besuchte: jeden Morgen marschierte er, die Füße in warmen Pelzstiefeln, die Hände in der Paletottasche vergraben, stolz zur Schule. Am ersten Tage hatte ich ihn selbst hinbegleitet, für die Kinder der Nachbarschaft war sein erster Schulgang ein Ereignis gewesen. Neugierig und verwundert hatten sie ihn angestarrt, und ein Junge bat: „Nüter, nimm mich mit.”
Da drehte mein Sohn und Erbe sich stolz um und sagte: „Das möchtest du wohl, was?” und ging, ohne seine Spielkameraden eines weiteren Blickes zu würdigen, von dannen.
„Natürlich,” sagte ich, „erst mußt du zur Schule gehen, aber heute Mittag fahren wir zusammen Schlitten. Nun laß Papa aber noch einen Augenblick schlafen, Pappen ist nicht ganz wohl.”
Zärtlich und teilnehmend streichelte er mich mit seinen kleinen weichen Händen, und ich schämte mich, ohne recht zu wissen, warum.
Als ich endlich aufstand und neugierig zum Fenster hinaussah, war kein Schnee zu sehen, die Sonne, die hell und fröhlich schien, hatte ihn wieder geschmolzen, mein Garten sah aus, wie eine große Pfütze.
Mir tat mein Junge leid, aber auch ich sollte die Wahrheit des alten Wortes erfahren, daß die Elter sich oft unnötig um ihre Kinder ängstigen; Herr Nüter kam glückstrahlend aus der Schule zurück.
„Der Junge ist verständiger, als ich dachte,” sprach ich zu mir selber, „er gewöhnt sich beizeiten daran, das Unabänderliche mit Würde zu tragen.”
Ich ging aus, um eine Besorgung zu machen, als ich um zwei Uhr zum Mittagessen heimkehrte, fand ich meine Frau allein.
„Wo ist Nüter?” fragte ich.
„Er fährt mit Wilhelm Schlitten,” lautete die Antwort.
Ich glaubte nicht richtig verstanden zu haben.
„Er wollte so furchtbar gern,” fuhr meine Frau fort, als sie mein erstauntes Gesicht sah, „Wilhelm und er sind mit dem Schlitten fort und suchen eine Stelle, wo noch Schnee liegt.”
„Da können sie lange suchen,” erwiderte ich, „hätte ich das aber im voraus gewußt, so hätte ich mich nicht so damit beeilt, nach Hause zu kommen. Wann essen wir denn?”
„Es ist alles fertig,” gab meine Frau zur Antwort, „ich warte nur auf Minna (unser Kindermädchen), ich habe sie hingeschickt, um Wilhelm zu sagen daß er nach Hause kommt.”
„Weißt du denn, wo Wilhelm ist?”
„Nein,” klang es etwas kleinlaut.
„Nun,” sagte ich, „irgendwo werden sie ja wohl gefunden werden, laß mich rufen, wenn es so weit ist?”
Ich ging in mein Zimmer und wartete eine Viertelstunde nach der anderen, meine schlechte Laune aber nahm von Minute zu Minute zu — ein feuerspeiender Krater war schließlich im Vergleich mit mir ein auf Eis gelegter Eisblock.
Um drei Uhr ging ich zu meiner Frau:
„Wir wollen jetzt essen, laß die Köchin, bitte, auftragen.”
Die Suppe war angebrannt, das Fleisch zähe, die Kartoffeln zerkocht, das Gemüse kalt; es war ein Göttermahl.
Und der Junge war immer noch nicht da.
Schweigend saßen wir uns einander bei Tische gegenüber. Hätten wir mit einander gesprochen, so wäre es zu einem Streit gekommen: den wollten wir beide vermeiden.
Wieder verrann eine Viertelstunde.
Da ertönte auf der Diele ein Geschrei, so schrill und gellend, als ob jemand beim lebendigem Leibe in Stücke geschnitten würde.
„Aha,” sagte ich, „nun ist er da.”
Das Geschrei nahm zu, es schwoll an zu einem Gebrüll, zu einem Geheul, daß es durch das ganze Haus gellte.
Ich erhob mich von meinem Platze, meine Frau stand auch auf.
Zornig trat sie mir entgegen: „Du schlägst ihn nicht, hörst du! Du schlägst ihn nicht, ich will es nicht haben.”
Ein wahrhaft teuflisches Gebrüll scholl zu uns hinüber; wir gingen beide hinaus.
Der Länge nach auf der Erde lag unser Stolz und unsere Freude, an der rechten Hand zog Wilhelm, an der Linken Minna, der Schlitten, den Nüter mit einem Band um die Brust zog, folgte hintendrein.
Ich trat näher: „Du stehst sofort auf!”
Ebenso gut hätte ich die Worte zu einem Toten wie zu meinem Jungen sagen können.
„Ich will Slitten fahren, Slitten will ich fahren!”
„Steh auf!” donnerte ich.
Er rührte sich nicht.
Da gab ich Wilhelm einen Wink, der wußte, wo der Rohrstock lag, und eine Minute später hielt ich das Marterinstrument in der Hand.
„Wie denken wir nun?” fragte ich.
„Ich will Slitten fahren.”
„Zunächst werde ich einmal mit dir Schlitten fahren,” sagte ich, und ich hob den Jungen von der Erde empor.
Gleich darauf aber legte ich ihn wieder hin; nein, wie sah der Bengel aus! Hätte er nicht noch beständig geschrieen, so hätte ich geglaubt, eine Schokoladenpuppe im Arm gehabt zu haben: er war braun von oben bis unten, sein Gesicht, seine Hände, seine blonden Haare waren braun, der ganze Junge war bespritzt, nein angestrichen mit flüssiger Schokolade.
Und das war mein Kind — schaudernd wandte ich mich ab.
Eine Minute später lag er aber dennoch über dem väterlichen linken Knie, und er bleib da lange liegen.
„So,” sagte ich endlich, „mein Junge, nun kannst du weiter Schlitten fahren.”
Ich dachte, die Lust wäre ihm vergangen für alle Zeiten, aber laut brüllend, den Schlitten hinter sich herziehend, stürzte er zur Haustür hinaus.
Wie die wilde Jagd wir alle hinter ihm her.
Nach wenigen Sekunden war er gefangen.
Wir redeten mit Güte und mit Langmut auf ihn ein; alles war vergebens.
„Liegt denn irgendwo Schnee?” fragte ich den Diener.
„Nirgends,” gab er zur Antwort, „wir haben in der Allee gespielt, da war es ganz entsetzlich schmutzig. Nüter saß auf dem Schlitten, den ich ziehen mußte, und wenn er hinunterfiel, drehte er sich immer ein paarmal herum, ehe er wieder aufstand.”
Und Herr Nüter brüllte, daß die Fensterscheiben klirrten.
Aus der Küche kam ungerufen die Köchin, ein großes Stück Marzipan, seine höchste Wonne, in der Hand haltend; es half nichts, er schrie weiter.
Da klingelte es an der Tür — Wilhelm öffnete.
„Nehmen die Herrschaften Besuch an?”
Es war ein junges Brautpaar, das auf der Visitentour war.
Verleugnen konnten wir uns ja nicht, so traten sie auf die Diele, und halb lachend, halb verlegen weihten wir sie in die Veranlassung dieser Familienszene ein.
„Aber wer wird denn so unartig sein?” sagte die junge Braut freundlich. „Komm gib Händchen.”
Und ehe ich es verhindern konnte, hatte der Junge seine Schokoladenhand in den feinen, weißen Glaceehandschuh gelegt.
Mich rührte beinahe der Schlag, und ich stammelte Worte der Entschuldigung.
Jetzt waren der Zuschauer sieben: wir alle umstanden Nüter, der auf seinem Schlitten saß und ein Geheul ausstieß, im Vergleich mit dem das berühmte Siegesgeschrei der Sioux-Indianer Totenstille ist.
Auf einmal war der Junge still, ganz mäuschenstill: noch sahen wir uns alle verwundert an, da sagte er ganz ruhig und gelassen: „So, nun könnt Ihr alle weggehen.”
Und um des lieben Friedens willen geschah nach seinem Willen: die Dienstboten gingen an ihre Arbeit, wir führten unseren Besuch in das Wohnzimmer.
Als das Brautpaar uns verlassen hatte, gingen wir wieder in das Eßzimmer und sahen dort zu unserem Erstaunen den Jungen fein säuberlich gewaschen und von oben bis unten umgezogen am Tisch sitzen und Mittag essen.
Ich kannte meinen Herrn Sohn: irgend etwas mußte sein Inneres beschäftigen, daß er mit einemmal so artig war, ein plötzlicher Einfall mußte ihm gekommen sein.
Ich wollte ihn nicht fragen, er würde schon von selbst sprechen.
Und richtig, wir saßen noch keine Minute neben ihm, da sagte er: „Pappen, ich will gar nicht mehr Slittenfahren, ich will nachher einen Sneemann bauen.”
„Aber Junge, es liegt doch gar kein Schnee, sei doch nicht so fürchterlich dumm,” rief ich erregt.
Da sah er mich groß an und sagte: „Dann bau' ich ohne Snee.”
Flehend blickte ich zum Himmel empor. Da sah ich, wie tausend und abertausend Flocken niederfielen und die Erde mit einem weißen Mantel bedeckten.
Ein Jubelschrei entrang sich meinen Lippen, und ich glaube, ich habe mich über den ersten Schnee, der nun wirklich liegen blieb, mehr gefreut wie mein Junge, der nun mit seinem Schlitten wieder von dannen zog. Ich war dem Himmel dankbar, daß er mir nach den Leiden des heutigen Tages wenigstens die Bekanntschaft mit einem Schneemann, der ohne Schnee erbaut war, ersparte.
Wie hätte der Schneemann, und last not least wie hätte wohl mein Junge ausgesehen? Darüber schweigt des Sängers Höflichkeit.
„Svenska Tidningen” vom 15.11.1919: