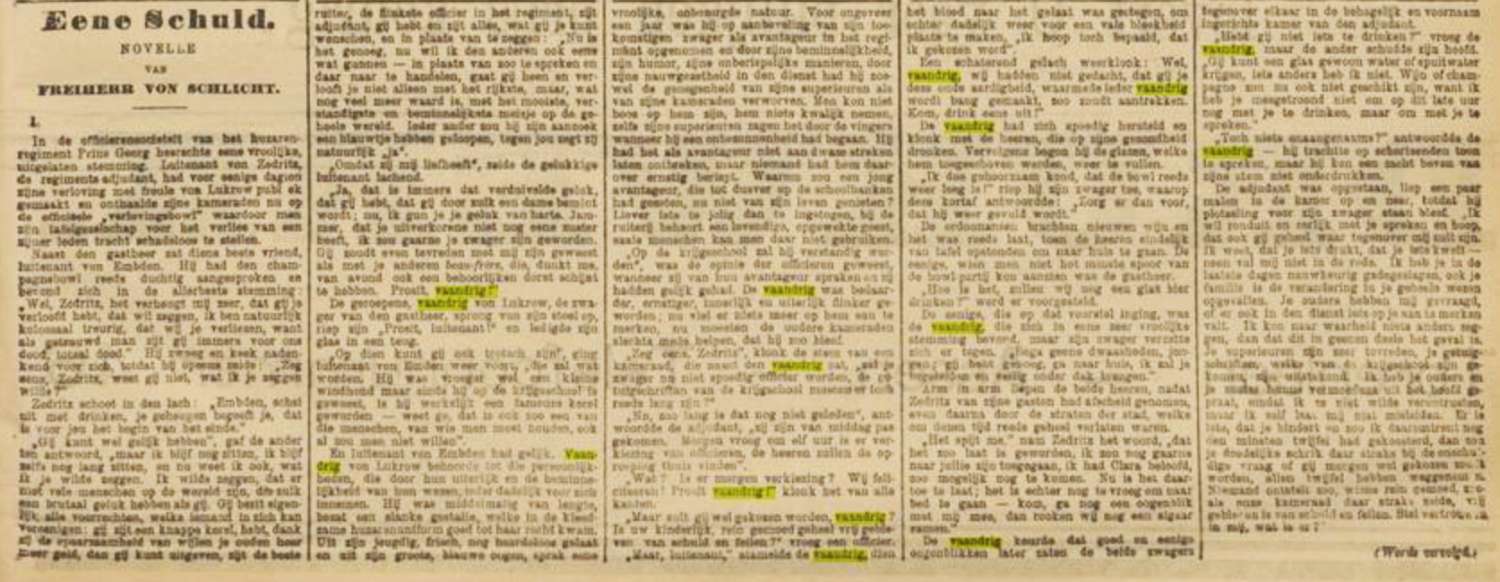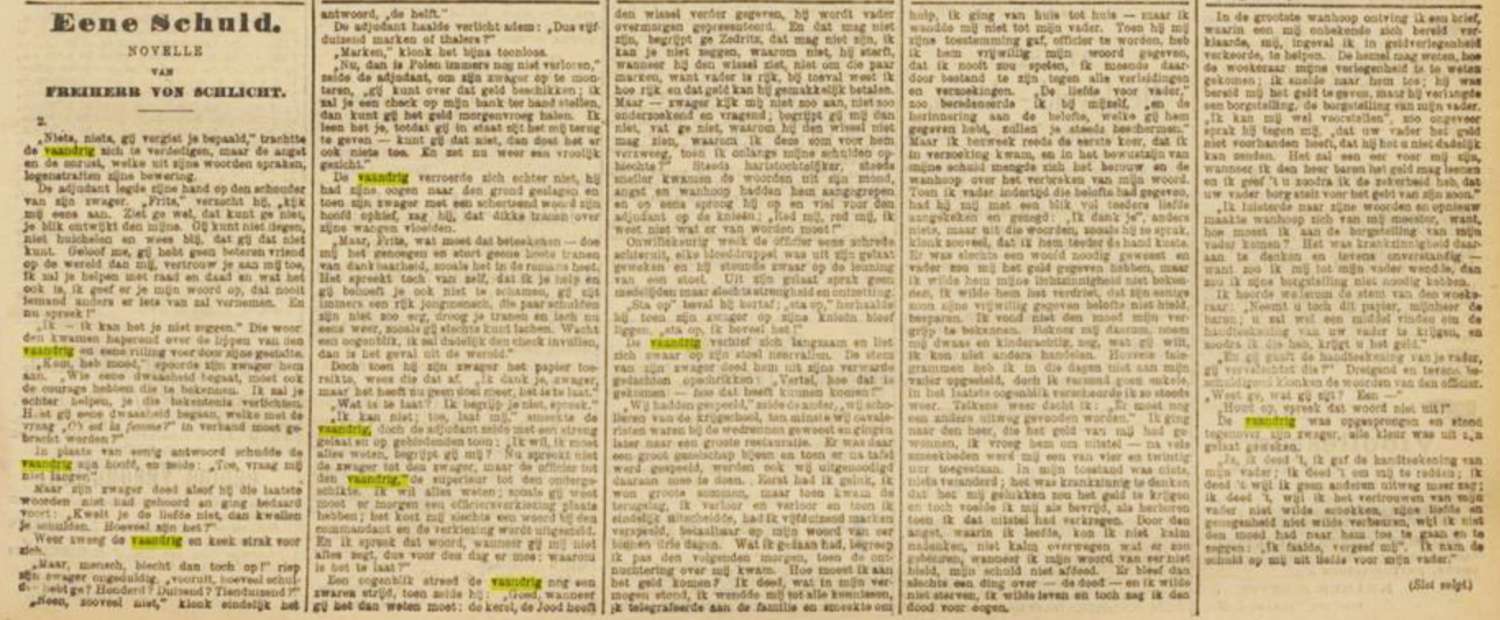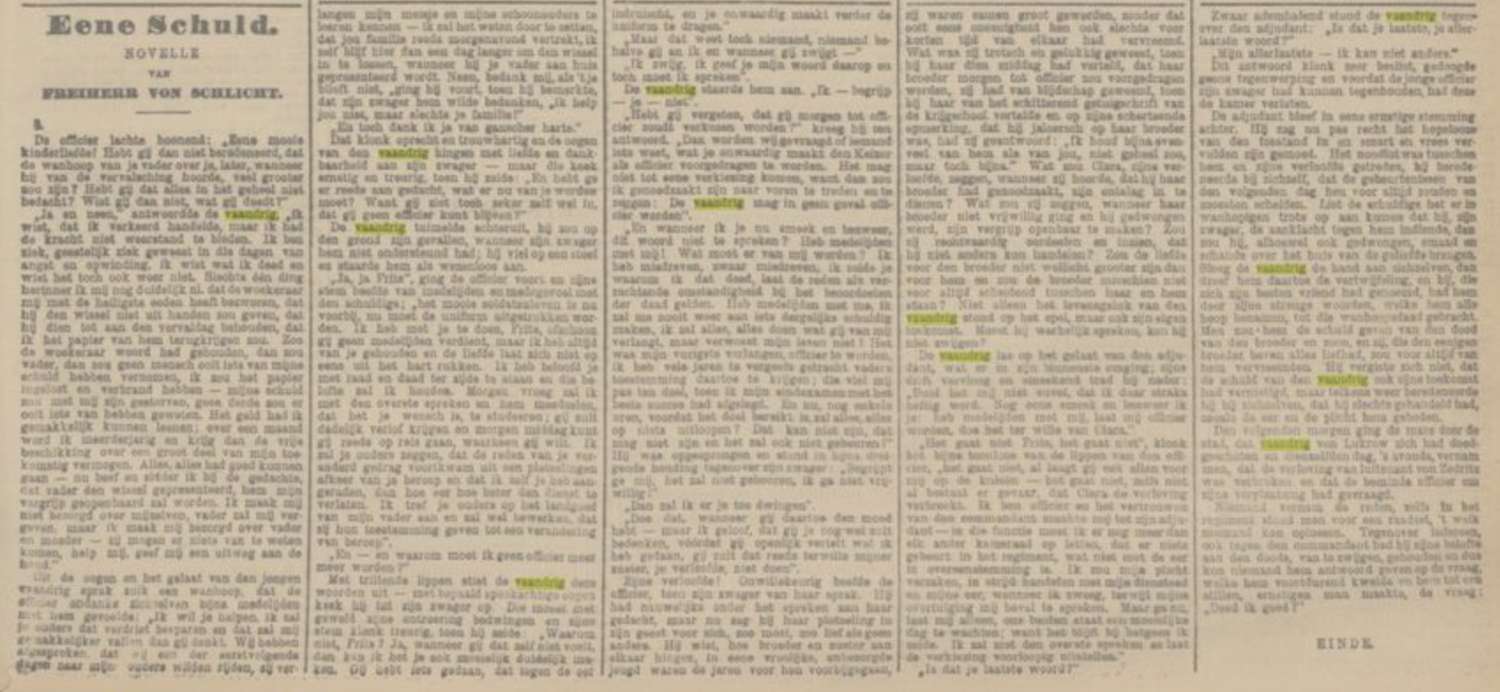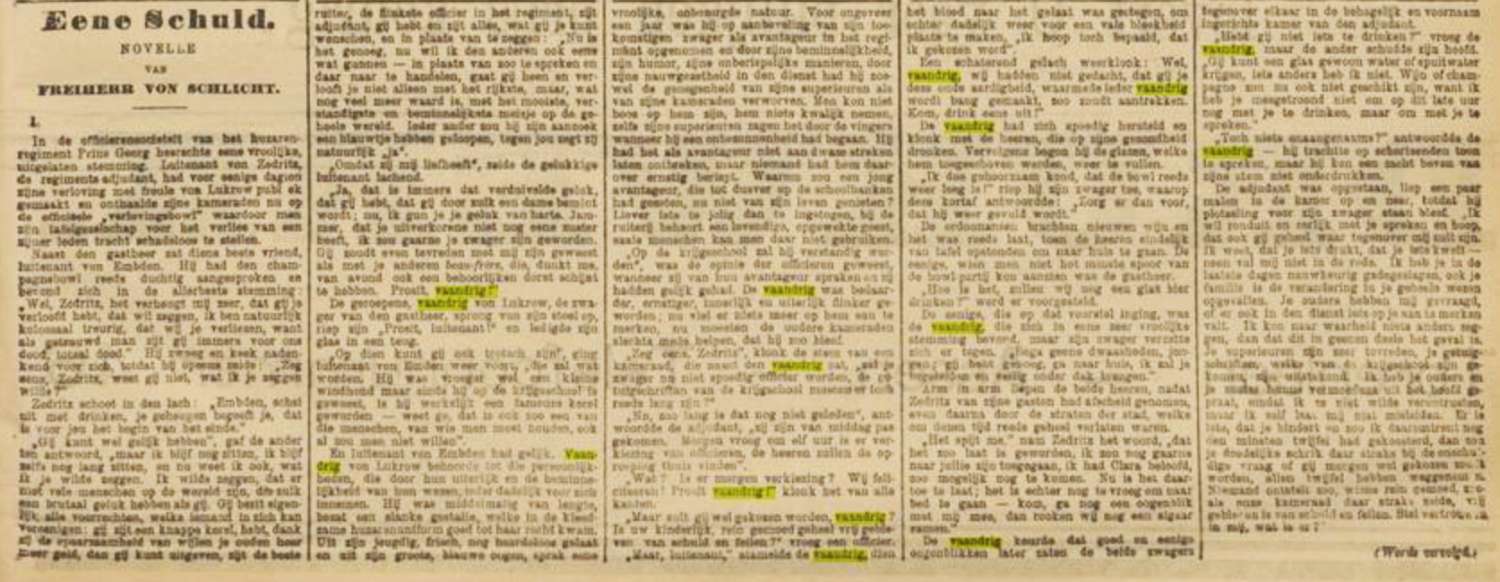
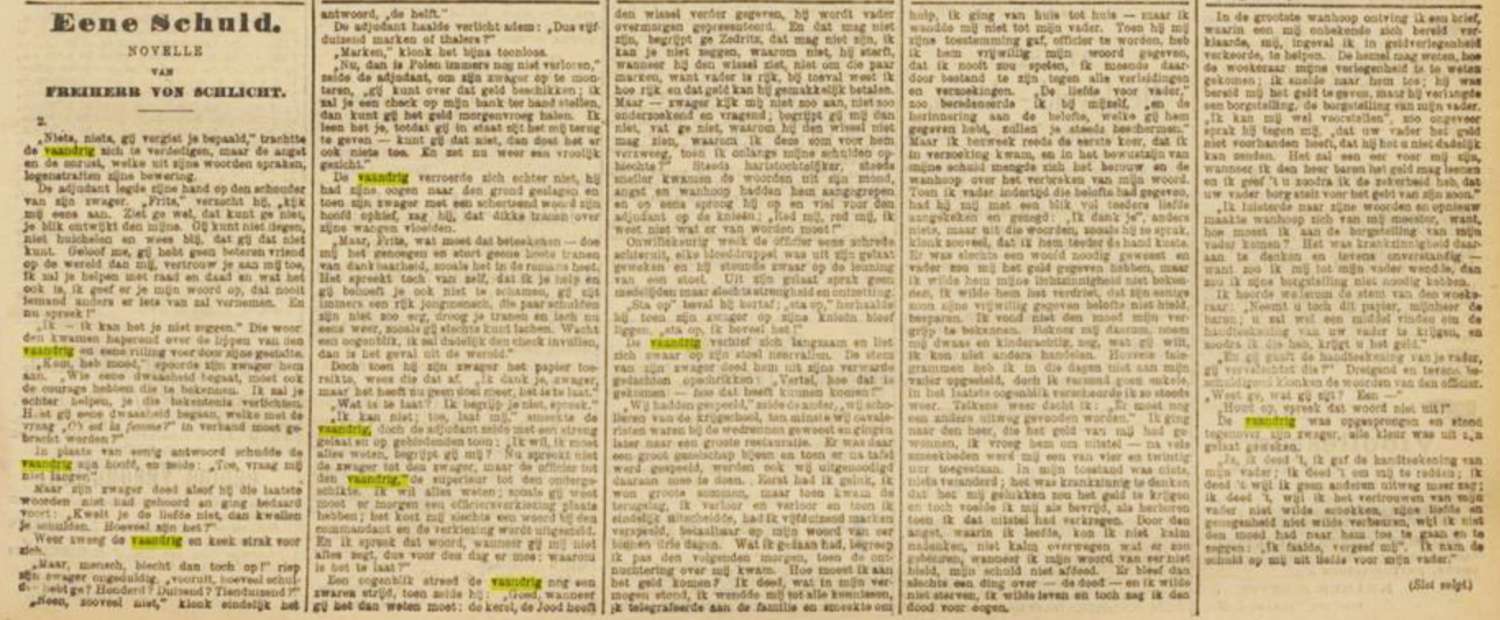
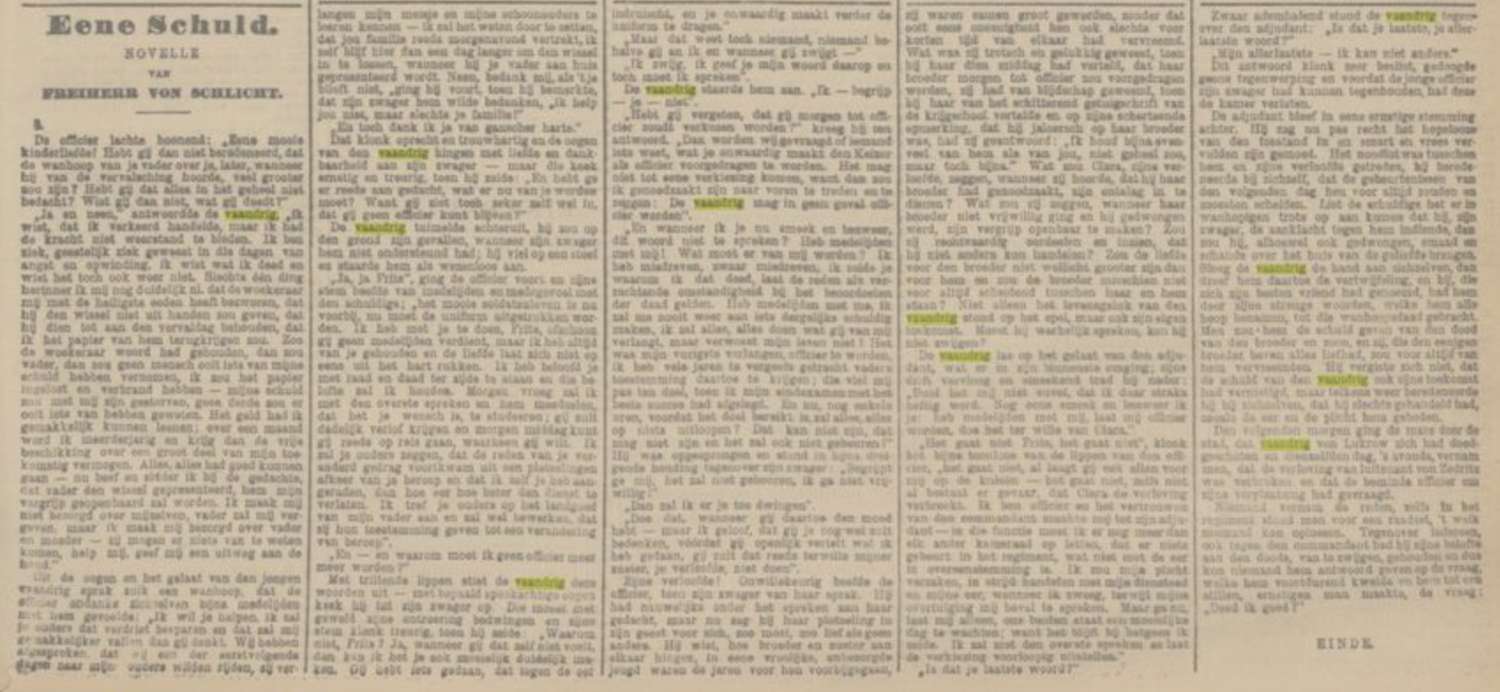
Erzählung von Freiherrn von Schlicht.
in: „Provinciale Drentsche en Asser courant” vom 4. bis 7.12.1909,
in: „Um Ehre.”.
In dem Offizierkasino des Husarenregiments Prinz Georg herrschte eine fröhliche, ausgelassene Stimmung. Leutnant von Zedritz, der Regimentsadjutant, hatte vor einigen Tagen seine Verlobung mit Fräulein von Lukrow veröffentlicht und gab nun seinen Kameraden die offizielle „Verlobungsbowle”, durch die man die Tischgesellschaft für den Verlust eines ihrer Mitglieder zu entschädigen sucht.
Neben dem Gastgeber saß dessen bester Freund, der Leutnant von Embden. Er hatte der schweren Sektbowle schon fleißig zugesprochen und befand sich in der denkbar besten Laune: „Weißt du, Zedritz, daß du dich verlobt hast, freut mich zu sehr, das heißt, ich bin natürlich kolossal traurig, daß wir dich verlieren, denn als Ehemann bist du für uns ja tot, ganz tot.” Er schwieg und sah nachdenklich vor sich hin, dann sagte er plötzlich: „Sag mal, Zedritz, weißt du nicht, was ich dir sagen wollte?”
Der lachte laut auf: „Embden, hör auf zu trinken, dein Gedächtnis verläßt dich, das ist für dich der Anfang vom Ende.”
„Recht magst du haben,” gab der andere zur Antwort, „aber ich bleib noch sitzen, ich bleib sogar noch lange sitzen, und nun weiß ich auch, was ich dir sagen wollte. Ich wollte sagen, daß es Menschen, die solches unverschämtes Glück wie du auf der Welt haben, überhaupt nicht wieder giebt. Du hast eigentlich alle Vorzüge, die ein Mensch in sich vereinen kann: du bist ein hübscher Kerl, hast dank der Sparsamkeit deines seligen alten Herrn mehr Geld, als du ausgeben kannst, bist der beste Reiter, der tüchtigste Offizier im Regiment, bist Adjutant, du hast und bist alles, was du dir wünschen kannst, und anstatt daß du gesagt hättest: ,Nun ist es genug, jetzt will ich den anderen auch einmal etwas gönnen,' — anstatt so zu sprechen und demgemäß zu handeln, gehst du hin und verlobst dich nicht nur mit dem reichsten, sondern, was noch viel mehr wert ist, mit dem hübschesten, klügsten und liebenswürdigsten Mädchen in der ganzen Welt. Jeder andere hätte bei seinem Antrag einen Korb bekommen, bei dir sagt sie natürlich ,Ja'.”
„Weil sie mich liebt,” lachte der glückliche Leutnant.
„Ja, das ist ja eben der Dusel, den du hast, daß du von einer solchen Dame geliebt wirst; na, ich gönne dir dein Glück von Herzen. Schade, daß deine Fräulein Braut nicht noch eine Schwester hat, ich wäre gern dein Schwager geworden — hättest mit mir ebenso zufrieden sein sollen wie mit deinem andern beau-frère, der übrigens heute auch einen gehörigen Durst zu haben scheint. Prosit, Fähnrich!”
Der Angerufene, Fähnrich von Lukrow, der Schwager des Gastgebers, sprang wie ein Blitz in die Höhe, rief sein „Prosit, Herr Leutnant!” und leerte sein Glas auf einen Zug.
„Auf den kannst du ja auch stolz sein,” nahm Leutnant von Embden wieder das Wort, „der wird werden. Früher war er ja ein kleiner Windhund, aber seitdem er auf Kriegsschule gewesen ist, ist er wirklich ein famoser Kerl geworden — weißt du, das ist auch so einer von den Menschen, denen man gut sein muß, auch dann, wenn man nicht will.”
Und Leutnant von Embden hatte recht mit seinen Worten: Fähnrich von Lukrow gehörte zu jenen Persönlichkeiten, die durch ihr Aeußeres und die Liebenswürdigkeit ihres Wesens alle sofort für sich einnehmen. Er war von mittelgroßer, schlanker Figur, die in der kleidsamen Husarenuniform zur besten Geltung kam, aus seinem jugendfrischen, noch bartlosen Gesicht und aus seinen großen, blauen Augen sprach eine heitere, sorglose Natur. Vor ungefähr einem Jahr war er auf die Empfehlung seines jetzigen Schwagers hin als Avantageur im Regiment aufgenommen worden, und durch seine persönliche Liebenswürdigkeit, durch seinen Humor, durch seine tadellosen Manieren und durch seine dienstliche Gewissenhaftigkeit hatte er es erreicht, daß sowohl die Vorgesetzten wie auch die Kameraden ihn in ihr Herz geschlossen hatten, und daß er sich überall der größten Beliebtheit erfreute. Man konnte ihm nicht gram sein, ihm nichts übelnehmen, selbst die Vorgesetzten ließen ihm gegenüber manchmal Milde walten, wenn er eine Dummheit begangen hatte. An thörichten Streichen hatte er es als Avantageur nicht fehlen lassen, aber niemand hatte ihn deswegen ernstlich getadelt. Warum sollte ein junger Avantageur, der bisher die Schulbank gedrückt hatte, jetzt nicht sein Leben genießen? Lieber etwas zu flott als zu philisterhaft, zur Reiterei gehört ein frischer, lebendiger Geist, Stubenhocker kann man da nicht gebrauchen.
„Auf Kriegsschule wird er vernünftig werden,” hatte die Meinung der Offiziere gelautet, wenn sie von ihrem Avantageur sprachen, und sie hatten recht behalten mit ihrer Ansicht. Der Fähnrich war ruhiger, ernsthafter geworden, er hatte mehr innere und äußere Haltung bekommen, jetzt war gar nichts mehr an ihm auszusetzen, jetzt hatten die älteren Kameraden nur darauf zu achten, daß er so blieb.
„Sagen Sie einmal, Zedritz,” erklnag da die Stimme eines Kameraden, der neben dem Fähnrich saß, „wird denn Ihr Schwager nun nicht bald Offizier werden, die Zeugnisse von der Kriegsschule müssen doch schon lange da sein?”
„Na, so ganz lange ist es noch nicht her,” gab der Adjutant zur Antwort, „sie sind heute mittag erst gekommen. Morgen vormittag um elf Uhr ist Offizierswahl, die Herren werden den Befehl zu Hause vorfinden.”
„Was? Morgen ist die Wahl? Wir gratulieren! Prosit Fähnrich!” erklang es von allen Seiten.
„Werden Sie denn aber auch gewählt werden, Fähnrich? Haben Sie sich auch ganz frei von Schuld und Fehle bewahrt die kindlich reine Seele?” fragte da ein Offizier.
„Aber, Herr Leutnant,” stammelte der Fähnrich, dessen Wangen sich dunkelrot gefärbt hatten, um gleich darauf eine fahle Blässe anzunehmen, „aber, Herr Leutnant, ich hoffe doch bestimmt, daß ich gewählt werde.”
Ein schallendes Gelächter erhob sich: „Na, Fähnrich, daß auch Sie auf diesen alten Witz, mit dem jeder Fähnrich bange gemacht wird, hineinfallen würden, haben wir nun allerdings nicht geglaubt. Na, Prosit, Fähnrich, trinken Sie mal aus!”
Der Fähnrich hatte sich schnell wieder gefaßt und that den Herren, die ihm zutranken, Bescheid. Dann schickte er sich an, die Gläser, die ihm zugeschoben wurden, aus der vor ihm stehenden Bowle wieder zu füllen.
„Ich melde ganz gehorsamst, daß die Bowle schon wieder leergetrunken ist!” rief er seinem Schwager zu, worauf dieser kurz erwiderte: „So sorge dafür, daß sie wieder gefüllt wird.”
Die Ordonnanzen brachten neuen Wein, und es war schon spät, als die Herren sich endlich vom Tisch erhoben, um nach Haus zu gehen. Der einzige, dem man auch nicht die geringste Spur der langen Sitzung anmerkte, war der Gastgeber.
„Wie ist es, gehen wir noch ein Glas Bier trinken?” wurde da der Vorschlag gemacht.
Der einzige, der zustimmte, war der Fähnrich, der sich in der heitersten Stimmung befand, aber sein Schwager legte ein Veto ein. „Mache keine Dummheiten, Junge, du hast genug, geh nach Haus, ich werde dich begleiten und dich sicher hinbringen.”
Arm in Arm schritten die beiden Herren, nachdem Zedritz sich von seinen Gästen verabschiedet hatte, gleich darauf duch die Straßen der Stadt, die von Passanten um diese Zeit schon völlig leer waren.
„Es thut mir leid,” nahm Zedritz das Wort, „daß es heute so spät geworden ist, ich wäre gern zum Abendessen zu euch nach Haus gegangen, ich hatte Klara versprochen, wenn irgend möglich noch zu kommen. Nun ist's zu spät, zum Schlafengehen ist es aber noch zu früh — komm noch einen Augenblick mit zu mir hinauf, wir rauchen noch eine Zigarre zusammen.”
Der Fähnrich willigte ein, und wenig später saßen sich die beiden Schwäger in der behaglich und vornehm eingerichteten Wohnung des Adjutanten gegenüber.
„Hast du nicht irgend etwas zu trinken?” bat der Fähnrich, aber der Schwager lehnte es ab: „Ein Glas Wasser oder ein Glas Soda steht zu deiner Verfügung, etwas anderes giebt es nicht. Wein oder Champagner wäre jetzt auch nicht ganz am Platze, denn ich habe dich zu mir gebeten, nicht um mit dir zu später Nachtstunde noch zu zechen, sondern um mit dir zu sprechen.”
„Hoffentlich nichts Unangenehmes?” entgegnete der Fähnrich — er versuchte in scherzhaftem Ton zu sprechen, aber er konnte ein leises Zittern seiner Stimme nicht unterdrücken.
Der Adjutant war aufgestanden, ging ein paarmal im Zimmer auf und ab und blieb dann plötzlich vor seinem Schwager stehen: „Laß mich ganz offen und ehrlich zu dir sprechen, und versprich auch du mir, ganz offen und wahr mir gegenüber zu sein. Ich weiß, daß dich irgend etwas bedrückt, daß dich etwas quält — nein, bitte, unterbrich mich nicht und widersprich nicht. Ich habe dich in den letzten Tagen scharf beobachtet, auch den Deine ist die Veränderung, die mit dir vorgegangen ist, nicht verborgen geblieben, sie haben mit mir darüber gesprochen, mich gefragt, ob du dir dienstlich irgend etwas hättest zu schulden kommen lassen. Der Wahrheit gemäß konnte ich nur sagen, daß dies in keiner Weise der Fall ist. Deine Vorgesetzten sind mit dir sehr zufrieden, die Zeugnisse, die von der Kriegsschule gekommen sind, sind ausgezeichnet. Ich habe deinen Eltern und deiner Schwester ihre Bedenken ausgeredet, weil ich sie nicht beunruhigen wollte, ich selbst aber lasse mich nicht täuschen, dich quält irgend etwas, und wenn ich noch den leisesten Zweifel daran gehabt hätte, so hätte dein tödliches Erschrecken bei Tisch auf die harmlose Frage, ob du morgen auch gewählt werden würdest, jeden Zweifel beseitigen müssen. So erschrickt niemand, der, wie der Kamerad sagte, sich die reine Seele bewahrt hat vor Schuld und Fehle. Hab Vertrauen zu mir, was ist's?”
„Nichts, nichts, du irrst dich, ganz bestimmt,” versuchte sich der Fähnrich zu verteidigen, aber die Angst und die Unruhe, die aus seinen Zügen sprachen, straften ihn Lügen.
Der Adjutant legte seinem Schwager die Hand auf die Schulter: „Fritz,” bat er, „sieh mich einmal an. Siehst du , du kannst es nicht, dein Blick weicht dem meinen scheu aus. Du kannst nicht lügen, dich nicht verstellen, freue dich, daß du es nicht kannst, wie auch ich mich darüber freue. Glaube mir, du hast keinen besseren Freund auf der Welt, als mich, vertraue dich mir an, ich will dir helfen mit Rat und That, und was es auch sei, ich gebe dir mein Wort darauf, daß niemals ein andrer etwas davon erfahren soll, und nun sprich.”
„Ich — ich kann es dir nicht sagen.” Stoßweise kamen die Worte über die Lippen des Fähnrichs, und ein Zittern und Beben ging durch seine Gestalt.
„Na, nur Mut,” ermunterte der Schwager, „wer eine Dummheit macht, muß auch die Courage haben, sie einzugestehen. Ich will dir aber helfen, dir dein Geständnis erleichtern. Hast du irgend eine Thorheit begangen, die mit der Frage ,où est la femme?' in Einklang zu bringen ist?”
Statt jeder Antwort schüttelte der Fähnrich den Kopf, dann sagte er: „Bitte, bitte, frag mich nicht weiter.”
Aber der Schwager that, als wenn er die letzten Worte nicht gehört hätte, und fuhr ruhig fort: „Quält dich die Liebe nicht, so quält dich nur ein anderes: Schulden. Wieviel sind es?”
Wieder schwieg der Fähnrich und blickte starr vor sich hin.
„Aber Menschenkind, so beichte doch!” rief der Schwager unwillig, „heraus mit der Sprache, wieviel Schulden hast du? Hundert, Tausend? Zehntausend?”
„Nein so viel nicht,” kam da endlich die Antwort, „die Hälfte.”
Der Adjutant atmete erleichtert auf: „Also fünftausend. Mark oder Thaler?”
„Mark,”erklang es fast tonlos.
„Na, dann ist Polen ja noch nicht verloren,” scherzte der Adjutat, um seinem Schwager Mut zu machen, „das Geld steht dir zur Verfügung; ich werde dir einen Check auf meine Bank ausstellen, und du kannst das Geld dir morgen früh abholen. Ich leihe es dir, bis du in der Lage bist, es mir zurückgeben zu können, — kannst du das nicht, so schadet das auch nichts. Und jetzt mach wieder ein fröhliches Gesicht.”
Aber der Fähnrich rührte und regte sich nicht, er hatte den Blick zur Erde gesenkt, und als sein Schwager ihm mit einem Scherzwort den Kopf in die Höhe hob, sah er, daß schwere, heiße Thränen ihm die Wangen hinunterliefen.
„Aber, Fritz, was soll denn das heißen — thue mir den einzigen Gefallen und weine mir hier nicht heiße Thränen der Dankbarkeit, wie es immer in den Romanen heißt; daß ich dir helfe, ist doch ganz selbstverständlich, und zu schämen brauchst du dich auch nicht, du bist ja ein reicher Mensch, da sind die paar Schulden nicht so schlimm, trockne deine Thränen, und nun lach einmal wieder, wie nur du lachen kannst. Warte einen Augenblick, ich will gleich den Check ausfüllen, und dann ist der Fall erledigt.”
Aber als er seinem Schwager den Schein hinreichte, wehrte dieser ab: „Ich danke dir, Schwager, aber es hat keinen Zweck mehr, es ist zu spät!”
„Was ist zu spät? Ich verstehe dich nicht, sprich.”
„Ich kann nicht; bitte, bitte, erlaß es mir,” bat der Fähnrich, aber mit strenger Miene herrschte sein Schwager ihn an: „Ich will, ich muß alles wissen, verstehst du mich? Jetzt spricht nicht der Schwager zum Schwager, sondern der Offizier zum Fähnrich, der Vorgesetzte zum Untergebenen. Ich will alles wissen, du weißt, morgen ist Offizierswahl, es kostet mich ein Wort beim Kommandeur, und die Wahl wird aufgeschoben. Und ich spreche das Wort, wenn du mir nicht alles sagst, also nun heraus mit der Sprache: warum ist es zu spät?”
Einen Augenblick kämpfte der Fähnrich noch einen schweren Kampf, dann sagte er: „Gut, wenn du es denn wissen mußt: der Kerl, der Jude, hat den Wechsel weitergegeben, er wird übermorgen dem Vater präsentiert werden, und das darf nicht sein, verstehst du, Schwager, das darf nicht sein, ich kann dir nicht sagen, warum nicht, er stirbt, wenn er den Wechsel sieht, nicht wegen der paar Mark, denn der Vater ist reich, durch Zufall weiß ich wie reich, und das Geld kann er leicht bezahlen. Aber — Schwager, sieh mich nicht so an, nicht so forschend und fragend; verstehst du mich denn nicht, kannst du es dir denn nicht selbst sagen, warum er den Wechsel nicht sehen darf, warum ich ihm diese Summe verschwieg, als ich neulich meine Schulden beichtete?” Immer leidenschaftlicher, immer lebhafter kamen die Worte aus seinem Munde, Angst und Verzweiflung hatten ihn gepackt, und mit einem Male sprang er auf und stürzte seinem Schwager zu Füßen: „Rette mich, rette mich, ich weiß nicht was werden soll!”
Unwillkürlich trat der Offizier einen Schritt zurück, jeder Blutstropfen war aus seinem Gesicht gewichen, und schwer stützte er sich auf die Lehne eines Stuhls. Aus seinen Zügen sprach kein Mitleid, sondern nur Strenge und Entsetzen.
„Steh auf!” befahl er kurz; „steh auf,” wiederholte er, als sein Schwager auf den Knieen liegen blieb, „steh auf, ich will es!”
Langsam erhob sich der Fähnrich und ließ sich schwer auf seinen Stuhl zurückfallen. Aus seinen wirren Gedanken riß ihn die Stimme seines Schwagers: „Erzähle, wie das gekommen ist — wie das hat kommen können!”
„Wir hatten gespielt,” klang es zurück, „wir Kriegsschüler, wenigstens wir Kavalleristen waren auf dem Rennen gewesen und gingen hinterher in ein großes Restaurant. Eine große Gesellschaft war dort versammelt, und als nach Tisch das Spiel begann, wurden auch wir aufgefordert, uns zu beteiligen. Zuerst hatte ich Glück, ich gewann große Summen, dann aber kam der Umschlag, ich verlor und verlor, und als ich endlich aufhörte, hatte ich fünftausend Mark verspielt, zahlbar auf Ehrenwort innerhalb von drei Tagen. Was ich gethan, wurde mir erst am nächsten Morgen klar, als die Ernüchterung über mich kam. Wie sollte ich die Schuld tilgen, wie das Geld beschaffen? Ich that, was in meinen Kräften stand, ich wandte mich an alle Bekannten, ich telegraphierte an die Verwandten und bat um Hife, ich ging von Haus zu Haus — nur an den Vater wandte ich mich nicht. Als er mir seinerzeit die Erlaubnis gab, Offizier zu werden, habe ich ihm freiwillig mein Wort darauf gegeben, nie zu spielen, ich glaubte dadurch gefeit zu sein gegen alle Verführungen und Versuchungen. ,Die Liebe zum Vater,' so sagte ich mir, ,und die Erinnerung an das Versprechen, das du gegeben hast, werden dich stets schützen.' Aber ich unterlag, ich unterlag beim erstenmal, da die Versuchung an mich herantrat, und in das Bewußtsein meiner Schuld mischte sich die Reue und die Verzweiflung über meinen Wortbruch. Als ich dem Vater damals das Versprechen gegeben, hatte er mich mit einem Blick grenzenloser Liebe angesehen und gesagt: ;Ich danke dir,' weiter nichts, aber aus diesen Worten, wie er sie sprach, klang so viel hervor, daß ich ihm zärtlich die Hand küßte. Es hätte eines Wortes bedurft, und der Vater hätte mir das Geld gegeben, aber ich wollte ihm meinen Leichtsinn nicht eingestehen, ich wollte ihm den Kummer, daß sein einziger Sohn ein freiwillig gegebenes Versprechen nicht hielt, ersparen. Ich fand nicht den Mut, mein Vergehen einzugestehen. Schilt mich deswegen, nenne mich thöricht und knabenhaft, sage, was du willst, ich konnte nicht anders handeln. Wieviel Depeschen habe ich an jenen Tagen nicht an meinen Vater aufgesetzt, aber ich sandte keine einzige ab, im letzten Augenblick zerriß ich sie stets wieder. Immer und immer wieder dachte ich: ,Es muß sich noch ein anderer Ausweg finden.' Ich ging zu dem Herrn, der das Geld von mir gewonnen, hin, ich beschwor ihn um Aufschub — nach vielen, vielen Bitten erreichte ich einen solchen von vierundzwanzig Stunden. An meiner Lage hatte sich nichts, nichts geändert; es war ein Wahnsinn, zu denken, daß es mir gelingen würde, das Geld zu schaffen, dennoch fühlte ich mich wie erlöst, wie neugeboren, als ich die Stundung durchgesetzt hatte. Die Angst, in der ich lebte, nahm mir die ruhige Ueberlegung, das ruhige Denken; was sollte werden, wenn ich mein Ehrenwort nicht hielt, meine Schuld nicht einlöste? Dann blieb nur eins — der Tod — und ich wollte nicht sterben, ich wollte leben, und doch sah ich den Tod vor Augen. Da, in der höchsten Not, in der größten Verzweiflung erhielt ich einen Brief, in dem ein mir Unbekannter sich bereit erklärte, mir, falls ich einmal in Geldnot sei, zu helfen. Der Himmel mag wissen, woher der Wucherer von meiner Not erfahren hat; ich eilte zu ihm; er war bereit, mir das Geld zu geben, aber er verlangte Sicherheit, Bürgschaft, die Bürgschaft des Vaters. ,Ich kann mir's denken,' so etwa sprach er auf mich ein, ,daß Ihr Herr Vater das Geld nicht flüssig hat, daß er es nicht gleich kann abschicken an Sie; wird mir das sein eine Ehre, wenn ich darf leihen dem Herrn Baron das Geld, und ich geb's, wenn ich hab die Sicherheit, daß der Herr Vater sagt gut für die Schuld seines Sohnes.'
„Ich hörte seine Worte an, und von neuem ergriff mich die Verzweiflung; was sollte werden, wenn auch er mir das Geld gab? Er mußte mir die Summe leihen, und doch — wie sollte ich die Bürgschaft des Vaters bekommen? Es war ein Wahnsinn, daran zu denken, ein Wahnsinn und eine Unklugheit zugleich — wandte ich mich an den Vater, so hätte ich seiner Bürgschaft nicht bedurft.
Da hörte ich von neuem die Stimme des Wucherers: ,Nehmen der Herr Baron nur mit das Papier, der Herr Baron werden schon finden einen Ausweg, zu erhalten die Unterschrift von Herrn Vater, und sobald ich werd' haben die Unterschrift, werden der junge Herr Baron haben das Geld.'”
„Und du gabst die Unterschrift deines Vaters, du fälschtest sie?” Drohend und anklagend zugleich kamen die Worte aus dem Munde des Offiziers. „Weißt du, was du bist? Ein —”
„Halt ein, sprich das Wort nicht aus!”
Der Fähnrich war aufgesprungen und stand seinem Schwager gegenüber, jede Farbe war von seinen Zügen gewichen.
„Ja, ich that's, ich gab die Unterschrift des Vaters; ich that's, um mich zu retten; ich that's, nur weil ich keinen andern Ausweg mehr sah; ich that's, weil ich dem Vater nicht als Schuldiger gegenübertreten, sein Vertrauen, seine Liebe und seine Zuneigung zu mir nicht erschüttern wollte, weil ich nicht den Mut hatte, vor ihn hinzutreten und zu sagen: ,Ich fehlte, verzeihe mir.' Ich lud die Schuld auf mich aus Liebe zu meinem Vater.”
Der Offizier lachte höhnisch auf: „Eine schöne Kindesliebe! Machtest du dir denn nicht klar, daß die Verzweiflung deines Vaters über dich später, wenn er von der Fälschung erführe, viel größer sein würde? Hast du dir denn das alles gar nicht überlegt? Wußtest du denn gar nicht, was du thatest?”
„Ja und nein,” gab der Fähnrich zur Antwort; „ich wußte, daß ich unrecht handelte, aber ich hatte nicht die Kraft, zu widerstehen. Ich bin krank, geistig krank gewesen in jenen Tagen vor Angst und Aufregung, ich wußte, was ich that, und wußte es dennoch nicht. Nur das eine ist mir noch klar in der Erinnerung, daß der Wucherer mir mit den heiligsten Eiden schwur, den Wechsel nicht aus der Hand zu geben, daß er ihn bis zum Verfalltage behalten, daß ich das Papier aus seiner Hand zurückerhalten sollte. Hätte der Wucherer sein Wort gehalten, so hätte der Vater, so hätte kein Mensch jemals etwas von meiner Schuld erfahren, ich hätte das Papier eingelöst und es verbrannt — meine Schuld wäre mit mir selbst gestorben, kein dritter hätte je davon gewußt. Das Geld hätte ich hier leicht geliehen bekommen; in einem Monat werde ich mündig und erhalte dann die freie Verfügung über einen großen Teil meines dereinstigen Vermögens. Alles, alles hätte gut gehen können — nun bebe und zittere ich bei dem Gedanken, daß dem Vater der Wechsel präsentiert, ihm mein Vergehen offenbart werden wird. Nicht meinetwegen sorge ich mich, der Vater wird mir verzeihen, aber für den Vater sorge ich und für die Mutter — sie dürfen nichts davon erfahren, hilf du mir, nenne mir einen Ausweg!”
Aus den Augen und aus den Mienen des jungen Fähnrichs sprach eine solche Verzweiflung, eine solche Betrübnis, daß den Offizier fast wider Willen Mitleid ergriff: „Ich will dir helfen, ich will deinen Eltern den Schmerz ersparen, und es wird mir dies leichter, als du denkst. Wir haben verabredet, daß wir an einem der nächsten Tage zu meinen Eltern fahren wollten, sie wünschen, meine Braut und meine Schwiegereltern kennen zu lernen — ich werde es durchzusetzen wissen, daß die Deinen schon morgen abend abreisen, ich selbst bleibe einen Tag länger hier und löse den Wechsel, wenn er deinem Vater ins Haus gebracht wird, ein. Nein, bitte, danke nicht,” fuhr er fort, als er bemerkte, daß sein Schwager ihm danken wollte, „ich betone es: ich helfe nicht dir, sondern nur den Deinen!”
„Und dennoch danke ich dir von ganzem Herzen.”
Das klang so warm, offen und treuherzig, und die Augen des Fähnrichs hingen mit Liebe und Dankbarkeit an seinem Schwager, — der aber blickte gar ernst und traurig drein, als er sagte: „Und hast du dir schon klar gemacht, was nun aus dir werden soll? Denn daß du nicht Offizier werden kannst, siehst du doch wohl selbst ein?”
Der Fähnrich taumelte zurück, er wäre zu Boden gefallen, wenn der Schwager ihn nicht gestützt hätte; er fiel in einen Stuhl und starrte ihn wie gesitesabwesend an.
„Ja, ja, Fritz,” sprach der Offizier weiter, und seine Stimme bebte vor Mitleid und Mitgefühl mit dem Schuldigen, der ihm gegenübersaß, „das schöne Soldatenleben ist nun vorbei, nun heißt es, den bunten Rock ausziehen und etwas anderes werden. Du thust mir leid, Fritz, trotzdem du kein Mitleid verdienst, aber ich hab dich immer lieb gehabt, und die Liebe läßt sich nicht auf einmal aus dem Herzen reißen. Ich habe versprochen, dir mit Rat und That zur Seite zu stehen, und ich thue es. Morgen früh will ich für dich mit dem Oberst sprechen und ihm mitteilen, es wäre dein Wunsch, zu studieren; du wirst sofort Urlaub bekommen, und morgen mittag schon kannst du reisen, wohin du willst. Mit deinen Eltern spreche ich, ich werde ihnen sagen, du hättest dich mir anvertraut und mir mitgeteilt, daß der Grund zu deinem veränderten Benehmen in der plötzlichen Unlust an deinem Beruf läge, und ihnen ferner sagen, daß ich dir selbst zugeraten hätte, dann je eher je lieber zu gehen. Ich treffe mit deinen Eltern auf dem Gut meines Vaters zusammen, laß es meine Sorge sein, ihre Einwilligung zu deinem Berufswechsel zu erlangen.”
„Und — und warum soll ich denn nicht mehr Offizier werden?”
Mit blutleeren, zuckenden Lippen stieß der Fähnrich diese Worte hervor, — mit wahrhaft geisterhaften Augen blickte er zu seinem Schwager empor. Der mußte sich gewaltsam zwingen, nicht von Mitleid und Erbarmen übermannt zu werden, und seine Stimme klang traurig, als er sagte: „Warum nicht, Fritz? Ja, wenn du das selbst nicht fühlst und empfindest, so kann auch ich dir das schwer klar machen. Du hast etwas gethan, das gegen die Ehre verstößt, du hast eine schwere Schuld auf dich geladen, die dich unwürdig macht, ferner die Uniform zu tragen.”
„Aber das weiß doch keiner, keiner außer dir und mir, und wenn du schweigst —”
„Ich schweige, ich geb dir mein Wort darauf, und dennoch muß ich sprechen.”
Hoffnungslos sah der Fähnrich ihn an. „Ich — verstehe — dich — nicht.”
„Hast du vergessen, daß morgen deine Offizierswahl ist?” klang es zurück; „da werden wir gefragt, ob einer irgend etwas weiß, das dich unwürdig macht, dem Kaiser als Offizier vorgeschlagen zu werden. Es darf nicht zur Wahl kommen, denn sonst wäre ich gezwungen, vorzutreten und zu erklären: ,Der Fähnrich darf unter keinen Umständen Offizier werden.'”
„Und wenn ich dich nun bitte, dich nun anflehe und beschwöre, dieses Wort nicht zu sprechen? Hab Mitleid, hab Erbarmen mit mir! Was soll aus mir werden? Ich habe gefehlt, schwer gefehlt, ich sagte dir, warum ich es that, laß den Grund mildernd bei der Beurteilung der That gelten. Habe Mitleid mit mir, nie, nie wieder will ich mir das geringste zu schulden kommen lassen, ich will alles, alles thun, was ihr von mir verlangt, aber zerstöre mir mein Leben nicht! Es war mein sehnlichster, mein heißester Wunsch, Offizier zu werden, lange Jahre habe ich vergebens die Einwilligung des Vaters zu erlangen gesucht; sie ward mir erst zu teil, nachdem ich mein Abiturientenexamen mit dem besten Zeugnis bestanden hatte. Und nun, wenige Stunden, bevor ich am Ziel bin, soll alles, alles in ein Nichts zusammenstürzen? Das kann nicht sein, es darf nicht sein, und es soll auch nicht sein!” Er war aufgesprungen und stand in fast drohender Haltung seinem Schwager gegenüber: „Verstehst du mich, es soll nicht sein, ich gehe nicht freiwillig!”
„So werde ich dich zwingen.”
„Thue es, wenn du den Mut hast — aber ich glaube, im letzten Augenblick wirst du dich doch besinnen, ehe du öffentlich erzählst, was ich that, das wirst du schon meiner Schwester, deiner Braut wegen nicht thun.”
Seine Braut! Unwillkürlich zitterte der Offizier, als sein Schwager von ihr sprach. Während der ganzen Unterredung hatte er kaum an sie gedacht, nun sah er sie plötzlich im Geiste vor sich, so schön, so lieb wie keine andere. Er wußte, wie Bruder und Schwester aneinander hingen, zusammen waren sie im Elternhause auferzogen, in fröhlicher, sorgloser Jugend waren für sie die Jahre vergangen, sie waren miteinander groß geworden, ohne daß je ein Streit oder ein Zank sie, wenn auch nur für kurze Zeit, getrennt hatte. Es gab keine bessere Freundschaft, keine bessere Kameradschaft, als sie unter den Geschwistern herrschte. Wie war sie stolz und glücklich gewesen, als er ihr heute mittag erzählte hatte, daß der Bruder morgen zur Wahl gestellt werden würde; sie hatte vor Freude geweint, als er mit ihr von dem glänzenden Kriegsschulzeugnis sprach, und auf eine neckende Bemerkung seinerseits hin, daß er auf ihren Bruder eifersüchtig wäre, hatte sie zur Antwort gegeben: „Ich habe ihn beinahe so lieb wie dich, nicht ganz so, aber doch beinahe.” Was würde Klara, seine Braut, sagen, wenn sie erführe, daß er ihren Bruder veranlaßt hätte, seinen Abschied einzureichen? Was würde sie sagen, wenn ihr Bruder nicht freiwillig ginge, sondern wenn er gezwungen würde, sein Vergehen zur Anzeige zu bringen? Würde sie gerecht genug urteilen, um einzusehen, daß er nicht anders handeln konnte? Würde die Liebe zu ihrem Bruder nicht vielleicht größer sein als die Liebe zu ihm? Würde sie ihn nicht vielleicht mit harten Worten anklagen, und würde nicht, vielleicht für immer, der Bruder trennend zwischen ihr und ihm stehen? Nicht nur das Lebensglück des Fähnrichs stand auf dem Spiel, nicht darum handelte es sich, sondern auch um seine ganze Zukunft. Mußte er wirklich sprechen, konnte er nicht schweigen?
Der Fähnrich las in dem Gesicht seines Schwagers, was in dessen Innerem vorging; sein Zorn, seine Aufwallung verflog, und bittend trat er näher: „Zürne mir nicht, wenn ich vorhin heftig wurde, und noch einmal bitte und beschwöre ich dich: hab Mitleid mit mir, laß mich Offizier werden, thue es Klaras wegen.”
„Es geht nicht, Fritz, es geht nicht,” kam es fast tonlos von den Lippen des Offiziers; „es geht nicht, und wenn ihr alle auf den Knieen vor mir läget und mich anflehen würdet — es geht nicht, selbst auf die Gefahr hin nicht, daß Klara die Verlobung auflöst. Ich bin Offizier, und das Vertrauen des Kommandeurs machte mich zu seinem Adjutanten — als solcher habe ich noch mehr als jeder andere Kamerad darauf zu achten, daß nichts im Regiment geschieht, was nicht mit der Ehre in Einklang zu bringen ist. Ich würde fehlen gegen meine Pflicht, gegen meinen Diensteid und gegen meine Ehre, wenn ich schwiege, wo zu reden mir meine Ueberzeugung befiehlt. Und nun geh, laß mich allein, ein schwerer Tag steht uns beiden morgen bevor: es bleibt bei dem, was ich sagte. Ich spreche mit dem Oberst und lasse die Wahl vorläufig aufschieben.”
„Ist das dein letztes Wort?”
Keuchend, schwer atmend stand der Fähnrich seinem Schwager gegenüber, und heiß ging der Atem aus seinem Munde: „Ist das dein letztes, dein allerletztes Wort?”
„Mein allerletztes — ich kann nicht anders.”
Fest, kurz und bestimmt klang diese Antwort, keinen Widerspruch geltend lassend, und ehe der Offizier seinen Schwager hätte zurückhalten können, hatte dieser, davoneilend, das Zimmer verlassen.
In ernster Stimmung blieb der Adjutant zurück. Die ganze Schwere der Situation wurde ihm erst jetzt klar, und Schmerz und Furcht erfüllten seine Seele. Das Schicksal war verhängnisvoll zwischen ihn und seine Braut getreten, er sagte sich, daß die Ereignisse des kommenden Tages sie auf ewig trennen würden und müßten. Ließ der Schuldige in verzweifeltem Trotz es darauf ankommen, daß er, der Schwager, die Anklage wider ihn erhöbe, so hatte er, wenn auch gezwungen, Schmach und Schande auf das Haus der Geliebten herabgezogen. Legte der Fähnrich die Hand an sich, so trieb ihn dazu die Verzweiflung, in die er, der sich seinen besten und treuesten Freund genannt, ihn durch seine strengen und jede Hoffnung raubenden Worte gestürzt hatte. Man würde ihm Schuld an dem Tode des Bruders und Sohnes geben, und auch diese Lösung des traurigen Verhältnisses mußte ihn der, die den einzigen Bruder über alles liebte, für immer entfremden. Er täuschte sich nicht, daß die Schuld des Fähnrichs auch seine Zukunft vernichtet habe, aber immer wieder sagte er sich, daß er nur gehandelt habe, wie die Ehre und die Pflicht es ihm geboten.
Am nächsten Morgen durcheilte die Kunde die Stadt, daß Fähnrich von Lukrow sich erschossen habe, und am Abend desselben Tages erfuhr man, daß die Verlobung des Leutnants von Zedritz aufgehoben, und daß der beliebte Offizier um seine Versetzung eingekommen sei. Niemand erfuhr den Grund, selbst im Regiment stand man vor einem Rätsel, das keiner zu lösen vermochte. Gegen jedermann, auch gegen den Kommandeur, hatte er das dem Toten gegebene Versprechen, zu schweigen, gehalten, und so konnte ihm niemand Antwort geben auf die Frage, die ihn beständig quälte und ihn zu einem stillen, ernsten Mann machte, die Frage: „That ich recht?”
„Provinciale Drentsche en Asser courant” vom 4.12., 6.12. und 7.12.1909: