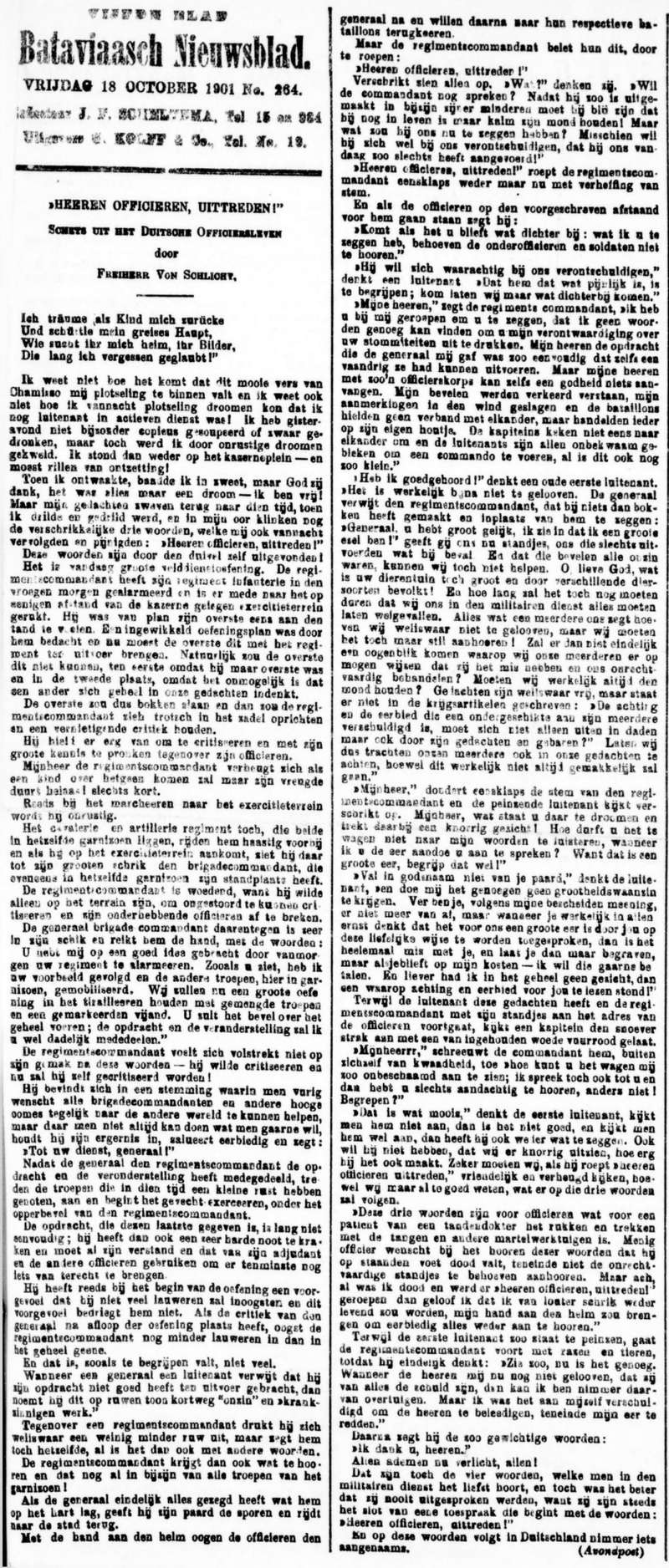
Skizze aus dem Offiziersleben.
Von Freiherrn v. Schlicht (Dresden).
in: „Frankfurter Zeitung und Handelsblatt” vom 21.8.1901,
in: „Neue Hamburger Zeitung” vom 31.8.1901,
in: „Bataviaasch nieuwsblad” vom 18.10.1901 und
in: „Der höfliche Meldereiter”
|
Ich träume als Kind mich zurücke |
Ich weiß nicht, wieso mir plötzlich dieser schöne Vers von Chamisso einfällt, ich weiß auch nicht, wie mir heute Nacht plötzlich träumen konnte, ich sei noch aktiver Leutnant? Ich habe gestern Abend keine schwerverdaulichen Speisen gegessen und auch sonst nicht extravagirt, aber wüste Träume quälten mich dennoch. Ich stand wieder auf dem Kasernenhof — Erbarmung! Als ich erwachte, war ich in Schweiß gebadet, Gott sei Dank, es war Alles nur ein Traum — ich bin frei. Aber meine Gedanken schweifen zurück nach jener Zeit, da ich drillte und gedrillt wurde und an mein Ohr klingen die schrecklichen Worte, die mich auch heute Nacht verfolgten und peinigten, die drei Worte: „Bitte, einen Augenblick.”
Die hat der Teufel selbst erfunden.
Es ist große Felddienstübung, Der Oberst hat das ihm unterstellte Infanterie–Regiment am frühen Morgen alarmirt und ist mit ihm in die militärische Welt, in das Gelände, abgerückt. Die Sache war großartig gedacht — er wollte seinem „Etatsmäßigen” einmal auf den hohlen Zahn fühlen. Er hatte sich eine wunderschöne Uebung zurechtgelegt, er hatte eine geniale Idee geboren und Sache des Etatsmäßigen oder wie es jetzt heißt: des Oberstleutnant beim Stabe, war es nun, die Idee so durchzuführen, wie der Herr Oberst sich das gedacht hatte. Natürlich würde der Oberstleutnant das nicht können, einmal, weil er nur Oberstleutnant war, dann aber auch, weil es eigentlich ganz unmöglich ist, daß ein Anderer sich ganz in unsere Gedanken hineindenken kann. Der Oberstleutnant würde Unfug machen, vielleicht sogar höheren Unfug und dann würde der Herr Oberst sich stolz im Sattel aufrichten und eine vernichtende Kritik abhalten. Er liebte es sehr, zu kritisiren und seine Leuchte der Wissenschaft im hellsten Scheine erstrahlen zu lassen.
Der Herr Oberst freut sich wie ein Kind auf das, was da kommen soll, aber keine Freude währet ewiglich. Schon während des Anmarsches zum Rendez–vous–Platz wird der Herr Oberst unruhig. Das Kavallerie– und das Artillerie–Regiment, die mit ihm in derselben Garnison stehen, jagen an ihm vorbei und als er endlich den Sammelplatz erreicht, sieht er zu seinem Schrecken dort den Herrn Brigade–Kommandeur, der ebenfalls in der Garnison seinen Sitz hat.
Der Herr Oberst ist wüthend, denn er wollte der alleinige Herr im Gelände sein, der Herr General dagegen ist sehr vergnügt und reicht dem Kommandeur die Hand.
„Sie haben mich da auf eine sehr gute Idee gebracht, als Sie heute Morgen alarmirten,” redet er den Untergebenen an. „Ich bin, wie Sie sehen, Ihrem Beispiel gefolgt und habe die anderen Truppen mobil gemacht. Wir werden jetzt eine größere Gefechtsübung mit gemischten Waffen gegen einen markirten Feind abhalten. Sie selbst werden den Befehl über das Detachement übernehmen, den Auftrag und die Gefechtslage werde ich Ihnen sofort mittheilen.”
Dem Oberst wird schlecht — er wollte kritisiren und wird nun selbst kritisirt werden, nun wird man sein eigenes Gebiß auf hohle Zähne hin untersuchen! Zwar ist er gestern erst beim Zahnarzt gewesen, aber er weiß, daß der Mann ihm doch nicht allzuviel helfen kann.
Der Oberst befindet sich in einer Stimmung, in der man den Wunsch hat, alle Vorgesetzten, die es auf der ganzen Welt gibt, mit einemmal umzubringen, aber da man nicht immer thun kann, was man möchte, beschränkt er sich darauf, das zu thun, was er darf: er schluckt allen Aerger hinunter, legt die Hand an den Helm und sagt:
„Zu Befehl!”
Nach einer Rast von einer kleinen Stunde, während der der Gegner aufgebaut wird, tritt das Detachement unter dem Oberbefehl des Herr Oberst den Vormarsch an. Der Auftrag, der ihm zu Theil wurde, ist gar nicht so einfach, wie er zuerst auch gar nicht aussah, es ist eine verdammt harte Nuß, die er da knacken muß, und der Oberst nimmt seinen ganzen eigenen Verstand und den seines Adjutanten zu Hilfe, um die Sache so gut wie möglich zu machen.
Eine Ahnung sagt ihm, daß er nicht allzu viel Lorbeeren ernten wird und diese Ahnung trügt ihn nicht. Als die Kritik am Mittag erfolgt, erntet der Herr Oberst noch weniger Anerkennung als gar keine.
Und das ist bekanntlich nicht viel.
Wenn ein General einem Leutnant sagt, daß das, was dieser „mit Gott für König und Vaterland” im Gelände verbrochen hat, nichts wie Unsinn ist, so sagt er das mit klaren, dürren Worten, er nennt es dann kurz und schmerzlos „Unsinn, Blödsinn, Wahnsinn”, manchmal spricht der hohe Herr dann auch von einer erwachsenen „Ferkelei”.
Einem Oberst gegenüber drückt man sich etwas weniger keck aus: man sagt ihm zwar dasselbe, aber man sagt es mit anderen Worten. Dem sprachkundigen Vorgesetzten steht ein reicher Wortschatz zur Verfügung, um seinem Untergebenen auseinanderzusetzen, daß dieser kein Genie ist.
Als der Herr General Alles gesagt hat, was sein Herz bedrückt, wendet er sein Pferd und reitet zur Stadt zurück.
Mit der Hand am Helm sehen die Offiziere dem hohen Vorgesetzten noch einen Augenblick nach, dann schicken sie sich an, zu ihren Bataillonen zurückzukehren.
Aber der Herr Oberst hält die Herren seines Regiments zurück.
„Bitte, einen Augenblick, meine Herren!”
Erstaunt sehen Alle auf. Was? der Oberst will noch reden? Nachdem er sich so unsterblich blamirt hat, sollte er doch froh sein, noch das Leben zu haben und gefälligst den Mund halten und den geringen Athem, der ihm noch geblieben ist, nicht unnöthig entweichen zu lassen. Was will er denn nur? Na, vielleicht wird er sich bei uns entschuldigen, daß er uns heute so hundsmiserabel führte.
„Bitte, einen Augenblick, meine Herren,” beginnt der Herr Oberst wiederum, „bitte treten Sie etwas näher; was ich Ihnen zu sagen habe, brauchen die Unteroffiziere und Mannschaften nicht zu hören.”
„Er will sich wahrhaftig bei uns entschuldigen” denkt ein Leutnant, „daß ihm das etwas peinlich ist, kann man sich ja denken; thun wir ihm den Gefallen, treten wir näher.”
„Meine Herren,” sagt der Oberst, „ich habe Sie für einen Augenblick gebeten, um Ihnen zu sagen, daß es mir für Ihre Leistungen überhaupt an Worten fehlt. Meine Herren, die Aufgabe, die der Herr General mir stellte, war so einfach, daß ein Fähnrich sie hätte lösen können. Aber meine Herren, mit einem solchen Offizierkorps, da kann selbst ein Gott nichts anfangen. Meine Befehle werden falsch verstanden, meine Anordnungen nicht richtig ausgeführt, die Bataillone handeln nicht im Rahmen des Ganzen, sondern jedes kämpft auf eigene Faust. Die Herren Hauptleute kümmern sich absolut nicht umeinander, von denen macht Jeder, wess' er lustig ist, na und die Herren Leutnants haben davon, wie sie ihren Zug führen sollen, nicht die denkbar leiseste Ahnung.”
„Ist die Möglichkeit,” denkt ein alter Oberleutnant, „es ist wirklich garnicht zu glauben. Dem Oberst wird klar und deutlich bewiesen, daß er nichts wie Unsinn machte, aber anstatt nun in sich zu gehen, an seine Brust zu schlagen und mit dem Brustton tiefinnerster Ueberzeugung zu sagen: „Herr General, Sie haben ja so Recht, ich sehe es ein, ich war und bin ein Esel.” Anstatt nun so zu sprechen, wird der Mann uns grob, uns, die wir nur das ausführten, was uns befohlen wurde, na, und dafür, daß das Unsinn war, können wir doch nichts. Herrgott, wie ist dein Thiergarten groß und wie weit gesteckt ist die Grenze dessen, was man sich bieten lassen muß! Aber Eins möchte ich der Wissenschaft halber doch wissen: hat man eigentlich nöthig, sich dies gefallen zu lassen? Zu glauben braucht man ja gottlob nur das Wenigste von dem, was einem gesagt wird, aber muß man Alles mitanhören? Darf man denn nicht ein einziges Mal vorne und hinten ausschlagen? Muß man wirklich zu Allem den Mund halten? Gedanken sind ja zwar zollfrei, aber in den Erklärungen zu den Kriegsartikeln steht geschrieben: „Die Achtung und Ehrerbietung, die der Untergebene dem Vorgesetzten schuldet, soll sich nicht nur in Thaten, sondern auch durch das ganze Denken und Empfinden äußern, sowie durch Mienen und Geberden.” Verscheuchen wir sie, alle insubordinationsmäßigen Gedanken — achten und ehren wir den Vorgesetzten, dem der Himmel seine Rede verzeihen möge, durch Gedanken und Geberden. So ganz leicht wird es zwar nicht sein, aber versuchen wir es.”
„Herrrr,” donnert ihn da die Stimme des Herrn Oberst an, „Herrrr, was machen Sie da für ein Gesicht? Herrrr, wie können Sie es überhaupt wagen, ein Gesicht zu machen, wenn ich Ihnen die Ehre anthue, mit Ihnen zu sprechen? Denn das ist eine Ehre für Sie, Herr Leutnant, merken Sie sich das.”
„Fall um Gottes Willen nur nicht vom Pferd,” denkt der Leutnant, „und thue mir den einzigen Gefallen, keinen Größenwahnsinn zu bekommen. Viel ist nach meiner subalternen Meinung mit Dir so wie so nicht mehr los, aber wenn Du Dir allen Ernstes einbildest, es sei eine Ehre für uns, von Dir in dieser lieblich groben Weise angesprochen zu werden, dann laß Dich begraben, aber bitte auf meine Kosten — das will ich gerne bezahlen. Und wenn Du keinen Werth darauf legst, in meinem holden Antlitz „Achtung und Ehrerbietung” zu lesen, dann mache ich eben gar kein Gesicht.”
„Einen Augenblick, mein Herr,” unterbricht der Herr Oberst seine schöne Rede, in der er inzwischen fortgefahren ist, „bitte einen Augenblick, Herr Leutnant!”
Er sieht den Herrn Ober durchbohrend und vernichtend an, und dieser tritt einen Schritt vor.
„Herrrr,” haucht ihn der Vorgesetzte an, „Herr, wie können Sie es wagen, ein so impertinent gleichgiltiges Gesicht zu machen, wenn ich zu Ihnen Allen spreche.”
„Nun schlägts dreizehn,” denkt der Herr Ober, „mache ich ein Gesicht, soll ich gar keins machen und mache ich keins, dann soll ich eins machen — ja, in des drei Teufels Namen, was soll ich denn nun eigentlich? Soll ich hier vielleicht mit freudig verklärten Mienen stehen, weil ich die hohe Ehre und den ganz besonderen Vorzug habe, ein Leutnant zu sein? Sollen meine Mienen ein Hallelujah ausdrücken, weil an mein Ohr die Worte: „Bitte, einen Augenblick” klangen — jene drei Worte, unter denen ein Offizier leidet, so lange er dient?”
„Diese drei Worte sind für den Untergebenen das, was für den Zahnkranken bei dem Arzt das Klappern der verschiedenen Zangen und der anderen Marterinstrumente, das Heranziehen der amerikanischen Tretmaschine ist — dann weiß man auch, mach Dich auf große Dinge gefaßt, mit der Freude am Leben ist es jetzt fürs erste vorbei, schließ' Deine Rechnung mit dem Himmel ab, wer kanns wissen, vielleicht bleibst Du todt. Ach, wenn man doch todt bliebe — nur ein einziges Mal. Aber ich glaube, selbst das würde nicht viel nützen. Läge man auf dem Todtenbett und schlügen die Worte: „Bitte, einen Augenblick” an mein Ohr, dann würde ich vor lauter Schrecken wieder lebendig werden, gehorsamst würde ich die Hand an den Kopf legen und der Dinge lauschen, die mir da erzählt werden.”
Während der Herr Ober meditirt — wie stets beim Militär ohne den denkbar geringsten Erfolg — macht der Herr Oberst seinen Leutnant herunter mit einer Ausdauer, die einer besseren Sache würdig wäre.
Dann fährt der Herr Oberst fort, sein gesammtes Offizierkorps herunterzumachen, bis er endlich denkt: „So, nun ist es wohl genug. Wenn die Herren mir jetzt noch nicht glauben, daß sie an dem heutigen désastre schuld sind, dann kann ich ihnen und mir nicht helfen. Aber diese Ehrenrettung, den Herren grob zu werden, war ich mir schuldig.”
Dann spricht er das große Wort:
„Ich danke sehr, meine Herren.”
Alle athmen erleichtert auf, Alle, Alle, Alle.
Das sind drei Worte, die man beim Militär am allerliebsten hört und doch würde man sehr, sehr gerne auf sie verzichten, denn sie bilden stets den Schluß einer Rede, die mit den Worten beginnt: „Bitte, einen Augenblick.”
Und aus dem Anfang wird nie etwas Gutes.
„Bataviaasch nieuwsblad” vom 18.10.1901:
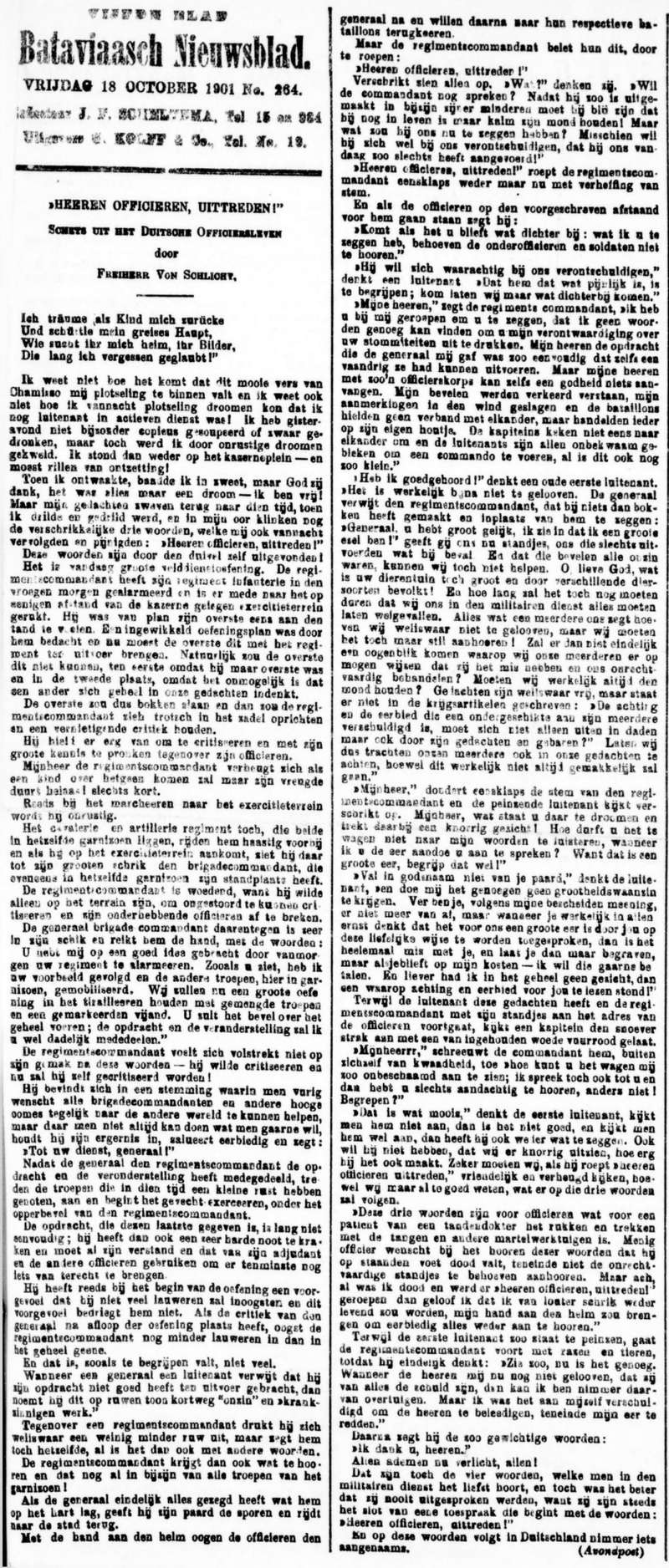
![]()
zu Schlichts Seite
© Karlheinz Everts