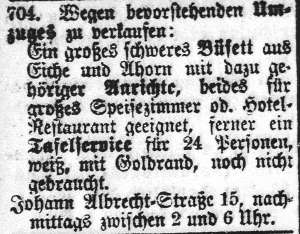

Von Freiherr von Schlicht
in: „Auer Tageblatt und Anzeiger für das Erzgebirge” vom 06.06.1914,
in: „Unterhaltungsblatt”, Tägl- Gratisbeilage zum „Dortmunder General-Anzeiger&rdquo, vom 10.6.1914,
in: „Emser Zeitung” vom 17. und 18.6.1914,
in: „Odenkirchener Annoncenblatt” vom 11., 18. und 25.7.1914,
in: „Aachener Anzeiger” vom 8.8.1914,
in: „Tägliche Omaha-Tribüne” vom 10.3.1915,
in: „Neue Westfälische Volks-Zeitung” vom 5.6.1915,
in: „Westungarischer Grenzbote” vom 19.5.1916,
in: „Die Ehestifterin”
Meine Frau war zur Stadt gegangen, um sich ein Paar neue Handschuhe zu kaufen, nur ein Paar, denn sie hatte so viele, daß es eigentlich ein Unsinn war, sich auch noch dieses eine Paar zu kaufen. Aber sie wollte es sich trotzdem kaufen, nur, um sich überhaupt etwas zu kaufen und diese Gelegenheit des Einkaufes wollte sie dazu benutzen, um meine Bitte zu erfüllen und um für mich in der Stadt einen Tausendmarkschein zu wechseln. Allerdings, ob das Handschuhgeschäft in der Lage sein würde, den Schein zu wechseln, wußte meine Frau nicht und selbst meine Frau war der Ansicht, daß es eigentlich praktischer sei, zur Bank zu gehen, um dort den Schein gegen kleinere Münze einzutauschen. Und praktischer war es sicher auch, aber meine Frau fand, es sähe so dumm aus, wenn man ein Bankhaus nur beträte, um dort zu wechseln. Ja, wenn sie dort tausend Mark auf das Sparkonto einzahlen oder noch lieber zweitausend Mark von dem Konto abheben solle, dann ja, aber nur wechseln? Da genierte sie sich vor dem Kassierer, denn bei diesem Wechselgeschäft verdiente die Bank doch nichts.
So blieb es also dabei, meine Frau wollte sich, um den Tausendmarkschein klein zu bekommen, in der Stadt ein Paar Handschuhe besorgen. Ein Paar weiße Glacéhandschuhe mit den modernen schwarzen Raupen, oder ein Paar ganz weiße, oder ein Paar schwarze, oder vielleicht ein Paar hellgraue, das wußte sie noch nicht, das würde der Augenblick ihr schon eingeben und schließlich war es ja auch ganz egal, was sie sich für Handschuhe kaufte, wenn es nur ein Paar Handschuhe waren. Den Rest des Geldes würde sie mir dann selbstverständlich wiedergeben.
Wenn eine Frau schon „selbstverständlich” sagt! Für die ist gewöhnlich alles das selbstverständlich, was für uns Männer unbegreiflich ist. Und wenn ich trotzdem für gewöhnlich jeden Glauben an dieses Wort „selbstverständlich” aus dem Munde meiner Frau verloren habe., dieses Mal glaubte ich ihr wirklich und ich wurde für diesen Glauben bitter bestraft, denn als meine Frau, die zur Stadt gegangen war, um sich ein Paar Handschuhe zu kaufen, am Mittag wieder nach Hause kam, hatte sie sich statt der Handschuhe ein Haus gekauft und damit der Kauf von beiden Seiten nicht wieder rückgängig gemacht werden könne, hatte sie gleich meinen Tausendmarkschein auf das Haus angezahlt.
Wer sich bei einer Frau noch über irgend etwas wundert, verdient nicht geschieden, sondern standesamtlich noch mit zwei weiteren Frauen verheiratet zu werden, damit er es bald und gründlich verlernt, sich noch zu wundern. Wunder gibt es heutzutage nur noch in der Ehe und das größte aller Wunder war, ist und bleibt die Frau. Das ist mir schon lange bekannt und deshalb, nein, der Wahrheit die Ehre, trotzdem sah ich meine Frau völlig verständnislos an und kniff mich in die Nase und in die Beine, um mich davon zu überzeugen, ob ich wirklich wache, oder ob ich das, was meine Frau mir da eben erzählte, nur geträumt habe. Auf jeden Fall machte ich ein mehr als schafsdämliches Gesicht und den Umstand benutzte meine Frau, um mir freudestrahlend und triumphierend zuzurufen: „Ich sehe es dir an, wie du dich mit mir freust und wie glücklich du mit mir bist, daß wir nun endlich aus unserer großen Villa herauskommen, die für uns zwei doch viel zu viel Zimmer hat, die eine zu hohe Miete kostet und viel zu viel Personal erfordert. Ach, ich bin ja so glücklich, daß ich dieses neue, entzückende kleine Häuschen gefunden habe, aber am glücklichsten bin ich doch darüber, daß ich es dir anmerke, wie du dich mit mir über diesen Kauf freust, denn da mußt du mir doch recht geben, ein Paar Handschuhe hätte ich mir unmöglich kaufen können. Ein Paar kauft sich doch nur ein Dienstmädchen, das abends mit ihrem Schatz auf den Ball geht, ich hätte mir mindestens ein Dutzend kaufen müssen und das wäre wirklich Verschwendung gewesen, wo ich ohnehin so viele habe und anstatt, daß ich dein Geld für nutzlose Dinge ausgebe, ist es doch viel besser, ich habe es gleich auf das Haus angezahlt.”
„Aber du solltest das Geld doch gar nicht ausgeben,” schalt ich erregt, „du solltest es doch nur wechseln.”
„Wenn du den Schein wirklich nur gewechselt haben wolltest, dann hättest du deine Sekretärin mit dem zur Stadt schicken müssen, nicht mich,” verteidigte meine Frau sich erregt, um dann hinzuzusetzen: „Du, der du schon so viele Bücher über uns Frauen geschrieben hast, du müßtest uns doch wenigstens so weit kennen, um zu wissen, daß keine Frau es fertig bringt, einen Schein nur zu wechseln. Eine Frau, die soviel Geld in Händen hat, wie ich heute morgen, die muß kaufen, ob sie will oder nicht und wozu ist das Geld denn da, wenn es nicht ausgegeben werden soll?”
Gegen diese Logik war ich machtlos, ich machte auch gar nicht erst den Versuch, meine Frau zu einer anderen Ansicht zu bekehren, sondern bat nur: „Nun aber erzähle mal im Zusammenhang, ob es denn wirklich wahr ist, daß du dir ein Haus gekauft hast, ein richtiggehendes Haus aus Mauersteinen und Ziegeln, mit einer Dachrinne und mit allem, was sonst noch dazu gehört, als da ist eine Zentralheizung — —”
„Meinst du, ich hätte ein Haus ohne Zentralheizung gekauft?” fiel mir meine Frau schnell in das Wort, um dann hinzuzusetzen: „Mich für so dumm zu halten, ist beinahe beleidigend. Natürlich ist die Zentralheizung da, das heißt, offen gestanden, noch ist sie nicht da, vorläufig sind in dem Hause nur Dauerbrandöfen, aber die Heizung kann und wird hineingelegt werden, wie mir der Besitzer erklärte. Die Sache ist gar nicht teuer, es kostet alles in allem höchstens dreitausend Mark.”
„Na sei so gut,” schalt ich ingrimmig, „höchstens dreitausend Mark ist gut. Ich finde überhaupt, du wirfst in einer Art und Weise, ohne mich auch nur zu fragen, mit meinen Tausendmarkscheinen um dich — —”
„Erlaube mal,” verteidigte meine Frau sich abermals, „von deinen Tausendmarkscheinen ist doch gar nicht die Rede, sondern nur von meinen. Ich habe das Haus gekauft, nicht du, deshalb werde ich es auch ganz allein bezahlen, ebenso alle baulichen Veränderungen, die noch vorgenommen werden müssen und selbstverständlich auch die tausend Kark, die ich heute morgen anzahlte. Die werde ich dir natürlich wiedergeben, ich will gleich an meinen Bankier telegraphieren, daß er mir Geld schickt.”
„Das Telegramm kanst du dir sparen,” widersprach ich, „denn soviel müßtest du eigentlich wissen, daß keine auswärtige Bank auf eine telegraphische Order hin Geld absenden darf, das schon deshalb nicht, weil sie aus der Unterschrift doch nicht feststellen kann, wer die Depesche in Wirklichkeit aufgegeben hat.”
„Schön,” meinte meine Frau nach kurzem Besinnen, „dann werde ich gleich mit der Bank telephonieren.”
„Auch das hätte keinen Zweck,” warf ich ein, „denn auch telephonische Aufträge dürfen von einer Bank nicht ausgeführt werden.”
„Gott, wie umständlich,” schalt meine Frau, bis sie mir dann plötzlich zurief: „Ja, wenn es denn keine Möglichkeit gibt, dir ein Geld zurückzuerstatten, dann kann ich es dir natürlich auch nicht geben.”
„Vielleicht könntest du dein Bankhaus heute noch brieflich bitten, dir den Betrag sofort zu überweisen,” meinte ich, „die Leute kennen doch deine Unterschrift seit Jahren und schriftliche Aufträge werden sofort ausgeführt.”
„Mein Gott, wie leichtsinnig von der Bank,” rief meine Frau, „wenn die Leute schon bei telegraphischen oder telephonischen Bestellungen so vorsichtig sind, dann müßten sie es bei schriftlichen doch erst recht sein, denn wie oft kommt es heutzutage nicht vor, daß jemand die Handschrift und die Unterschrift fälscht. Nein, schreiben möchte ich deswegen auf keinen Fall, das ist mir zu gefährlich. Ich habe mir ohnehin in der letzten Zeit schon soviel Geld schicken lassen, daß mein Bankier seinen Augen nicht trauen würde, wenn er schon wieder einen Brief von mir bekäme. Er würde da sicher an eine Täuschung glauben, nein, brieflich geht es nicht, höchstens telegraphisch oder telephonisch und da das auch nicht geht, kann ich dir deine tausend Mark also doch nicht wiedergeben. Hoffentlich bist du mir deswegen nicht böse, an meinem guten Willen liegt es ja nicht, aber einer force majeure gegenüber ist man ja nun einmal machtlos.”
„Das kommt mir auch so vor,” stimmte ich meiner Frau anscheinend sehr ernsthaft bei, dann aber fragte ich: „Wo liegt denn eigentlich das Haus, das du kauftest, kenne ich es überhaupt?”
Und ich erfuhr, daß ich es kannte, es lag nicht weit von unserer bisherigen Villa(1), wir waren oft daran vorübergegangen und ebensooft hatten meine Frau und ich den Wunsch geäußert, die kleine Villa(2), wenn sie einmal frei werden sollte, zu mieten, da unser jetziges Haus wirklich zu groß ist. Als meine Frau heute morgen wieder an dem Hause vorüberging, hatte sie den Hauswirt getroffen, der ihr erzählte, der bisherige Mieter(3) habe plötzlich und unerwartet die Nachricht von seiner Versetzung erhalten. Der müsse schon in den nächsten Tagen ausziehen, die Villa werde leer, aber sie sei nicht wieder zu vermieten, sondern nur noch zu verkaufen, da der Hauswirt sich dem nicht wieder aussetzen wolle, daß er abermals einen Mieter so plötzlich und so schnell verliert. Nur um das Haus zu bekommen und damit kein anderer Käufer ihr zuvorkomme, hatte meine Frau den Kauf gleich abgeschlossen und sie war ja so glücklich: „Ach, weißt du, ich freue mich zu sehr, natürlich nur deinetwegen. Du bekommst das Zimmer mit dem offenen ausgebauten Balkon, du kannst ja nun einmal ohne einen solchen im Sommer nicht leben. Aber natürlich wird der Balkon zugebaut und mit zu dem Zimmer genommen, schon damit das größer wird und oben auf den ausgebauten Balkon lasse ich mir ein kleines Türmchen setzen, paß mal auf, das wird sehr hübsch aussehen. Ich habe schon alles mit dem Hauswirt besprochen. Allerdings, auf den Balkon muß du dann verzichten, ich persönlich liebe einen solchen ja überhaupt nicht und ich sehe auch gar nicht ein, wozu du einen brauchst, denn den ganzen Sommer sind wir auf Reisen und wenn du dich trotzdem darüber ärgern solltest, daß du keinen Balkon hast, dann kann ich mir in der ersten Etage das ausgebaute Zimmer ja für mich nehmen, du bekommst dann für dich die große Stube im Parterre, das ist auch viel praktischer, da brauchen nicht alle Leute, die dich besuchen, oder die geschäftlich zu dir kommen, erst die Treppe hinaufzugehen. Du hast da unten dein Reich für dich allein. Und da unten hast du auch einen Balkon. Du brauchst von deiner Stube nur durch das Bibliothekzimmer, von da durch die Eßstube und von der durch das Garderobenzimmer zu gehen, dann bist du gleich draußen, da hast du deinen Balkon also gewissermaßen direkt neben deinem Schreibtisch, bequemer kannst du es doch gar nicht haben.”
„Wenigstens gewissermaßen nicht,” stimmte ich meiner Frau bei, bis ich dann fragte: „Und hast du schon mit dem Hauswirt besprochen, was der Umbau und was insonderheit dein Türmchen ungefähr kosten wird?”
„Selbstverständlich,” rief meine Frau schnell, „die genauen Kostenüberschläge müssen natürlich erst noch gemacht werden, aber der Hauswirt schätzte die Kosten des Umbaues höchstens auf zehntausend Mark.”
„Sagen wir also ruhig zwanzigtausend Mark,”warf ich ein, „denn das weißt du doch sicher auch, bei einem Bau kommt alles doppelt so teuer, wie man denkt.”
„Natürlich weiß ich das,” rief meine Frau mir zu, „das habe ich dem Hauswirt auch erklärt, aber der widersprach und meinte, mehr als fünfundzwanzigtausend käme es ganz bestimmt nicht, dafür wolle er die Garantie übernehmen und das ,Mehr' aus seiner Tasche bezahlen, wenn ich ihm die eine Hälfte dazu gebe.”
Das war wenigstens ein kleiner Trost, der mir die Gewißheit dafür bot, daß die Kosten nicht in das Unendliche steigen würden, dann aber meinte ich: „Wenn dein Hauswirt alles so genau mit dir besprach, dann wird der dir auch sicher erklärt haben, daß deine ganzen Abmachungen mit ihm ungültig sind, wenn ich als dein Ehemann nicht meine ausdrückliche Erlaubnis dazu gebe, daß du dir das Haus kaufst.”
Meine Frau sah mich völlig verständnislos an, dann meinte sie: „Ich brauche dazu deine Erlaubnis? Aber warum denn nur? Wir sind doch Gott sei Dank ohne Gütergemeinschaft miteinander verheiratet, du hast dein Geld, ich habe meins, ich kann damit machen, was ich will und ich kann mir von meiner Bank soviel schicken lassen, wie ich brauche, um das Haus und die Kosten des Umbaus zu bezahlen.”
„Gewiß kannst du das,” pflichtete ich meiner Frau bei, „aber jeder Häuserkauf muß auf dem Amtsgericht protokolliert werden und da muß ich, einerlei, ob wir Gütertrennung haben oder nicht, zu dem von dir beabsichtigten oder abgeschlossenen Kaufe als Ehemann meine Genehmigung geben und tue ich das nicht, dann — —”
Wieder sah mich meine Frau einen Augenblick völlig verständnislos an, dann aber bat sie mich plötzlich mit einer so zärtlichen Stimme, als hätte ich ihr am Vormittag zehn neue Hüte geschenkt: „Nicht wahr, das versprichst du mir, daß du im letzten Augenblick auf dem Standesamt, ich meine natürlich auf dem Amtsgericht nicht „nein” sagst, denn ich habe auf dem Standesamt doch auch „ja” gesagt. Du darfst auch nicht „nein” sagen, denn was soll dann aus dem Hause und vor allen Dingen aus meinem Türmchen werden, auf das ich mich schon heute so freue?” Und mit flehender Stimme schloß sie: „Nicht wahr, das schwörst du mir, daß du mir später keine Schwierigkeiten bereitest?”
„Das kommt ganz darauf an, wie mir die neue Villa gefällt,” gab ich zur Antwort, „bisher kenne ich die nur von außen. Sobald aber die jetzigen Mieter ausgezogen sind, werde ich mir das Haus auch sehr genau von innen ansehen und wenn es mir so gut gefällt, wie ich hoffe, dann gebe ich dir meinen Segen, denn auch ich will froh sein, wenn wir aus unserer jetzigen Villa herauskommen.”
Und als ich mir dann wenige Tage später das Haus ansah, da gefiel es mir ganz ausgezeichnet. Nur eins war mir völlig unklar, wie meine Frau in den sieben Räumen, die wir in Zukunft zur Verfügung haben würden, all die Sachen unterbringen wollte, die jetzt bei uns in mehr als zwölf Stuben herumstanden.
„Wenn es weiter nichts ist,” beeilte meine Frau sich, mich zu beruhigen, „darüber brauchst du dir keine Sorgen zu machen, denn selbstverständlich habe ich mir alles schon längst reiflich überlegt. Ich werde die Möbel, soweit wir sie hier nicht stellen können, verkaufen, ich habe sie sogar schon von einem Sachverständigen abschätzen lassen und ich bekomme alles in allem dafür mindestens fünftausend Mark, wenn nicht sogar sechs. Das große Büfett mit der Anrichte ist allein auf fünfzehnhundert Mark taxiert, viel ist es ja nicht, wenn man bedenkt, daß es vor ein paar Jahren zweitausendfünfhundert Mark gekostet hat und heute noch so gut wie neu ist. Aber trotzdem für fünfzehnhundert Mark gebe ich es fort, etwas muß man ja im Preise heruntergehen, wenn man verkauft, aber fünfzehnhundert Mark bringt es sicher, schon weil es so groß ist.”
Es war sogar noch größer, es war ein Monstrum an Länge, Breite, Höhe und Gewicht und was meine Frau sich dabei gedacht hatte, als sie vor vielen Jahren dieses Möbelstück nach ihren eigenen Angaben anfertigen ließ, das vermochte sie später niemals anzugeben. Seinen ganzen Abmessungen nach kam das Büfett(4) nur für einen großen Speisesaal in Frage und mir persönlich erschien es sehr zweifelhaft, ob wir überhaupt einen Käufer dafür finden würden, aber ich hütete mich, das auszusprechen, um meiner Frau die Freude an den fünfzehnhundert Mark nicht zu nehmen, mit denen sie bereits rechnete, als hätte sie die schon in der Tasche. Aber sie rechnete nicht nur mit diesen fünfzehnhundert Mark, sie rechnete schon mit den ganzen fünf- bis sechstausend, die ihr der Ausverkauf bringen würde und kaufte sich als erstes von diesem noch gar nicht eingenommenen Gelde einen diebes- und feuersicheren Kasten für hundertzwanzig Mark, den sie in dem Eßzimmer auf die Anrichte stellte. In diese Kassette sollte unser Hausmädchen, dem der Ausverkauf anvertraut wurde, immer gleich das Geld hineinwerfen, das die Käufer zahlen würden. Denn daß die Käufer kamen, unterlag für meine Frau nicht dem leisesten Zweifel.
Und die kamen auch wirklich, als ich in einer sehr schön abgefaßten Zeitungsannonce auf all die Herrlichkeiten hingewiesen hatte, die wir umzugshalber zu billigen, aber unbedingt festen Preisen abgeben wollten.
Die Käufer kamen schon aus Neugierde und sie brachten soviel Schmutz in das Haus, weil keiner sich die Füße rein machte, daß eins von unseren Mädchen weiter nichts zu tun hatte, als hinter jedem Käufer herzurollern. Es kamen so viele Käufer, daß unser Haus manchmal einem Warenhaus glich und daß zuweilen die Haustür geschlossen werden mußte, um ein lebengefährliches Gedränge zu vermeiden. Es kamen Hunderte und Hunderte, aber nicht ein einziger kaufte. Allen waren die Sachen zu teuer, das große Büfett wollte kein Mensch geschenkt haben, weil sie es doch nicht stellen konnten und für die anderen Sachen boten sie nicht einmal die Hälfte von dem, was verlangt wurde. Ja, für die schöne eiserne Geldkassette, die gar nicht zu verkaufen war, sondern die nur das Geld der Käufer in sich aufnehmen sollte, bot einer sogar nur zehn Mark. Die Leute handelten und feilschten, daß es schon nicht mehr schön war und meine Frau wurde immer empörter, bis ich sie dann eines Tages dadurch zu beruhigen versuchte, daß ich ihr zurief: „Erinnerst du dich noch, wie oft ich dir erklärte, ich begriffe es nicht, daß du bei deinen Einkäufen auf dem Markte oder in den Geschäften die Preise, wenn auch nur um ein paar Groschen, zu drücken versuchst? Weißt du noch, wie oft ich dir sagte, das sei deiner unwürdig und entweder sollst du bezahlen, was die Leute forderten, oder von dem Kauf ganz absehen? Nun erfährst du es mal an deinem eigenen Leibe und an deinem eigenen Geldbeutel, wie es ist, wenn gehandelt wird.”
„Das soll doch nicht etwa heißen, daß du diese unverschämten Menschen auch noch in Schutz nimmst?” meinte meine Frau ganz erregt. „Die Leute haben gar kein Recht, zu handeln und wenn ich das zuweilen tue, ist das etwas anderes.”
„Weil du es tust?” warf ich ein.
„Nein, weil alle hier es tun,” verteidigte meine Frau sich, „weil die Geschäftsleute es hier gar nicht anders kennen, als daß ihnen die Preise gedrückt werden, weil die Verkäufer sich über jeden im stillen lustig machen, der das bezahlt, was angeblich für die Ware gefordert wird.”
„Vielleicht fürchten deine Käufer, auch von dir ausgelacht zu werden, wenn sie dir den vollen Preis bezahlen,” entgegnete ich, um dann zu fragen: „Gib einmal der Wahrheit die Ehre, würdest du nicht auch zu handeln versuchen, wenn du in einem Ausverkauf, wie in dem deinigen, etwas erstehen wolltest?”
Meine Frau blieb darauf die Antwort schuldig, das aber natürlich nur deshalb, weil ein paar Minuten später das Mädchen in das Zimmer trat, um meiner Frau zu melden, es sei eine Dame da, die eine Chaiselongue kaufen wolle, aber nicht zu dem angesetzten Preis von neunzig Mark, sondern nur für fünfunddreißig. Fünf Mark wolle sie gleich anzahlen und den Rest in monatlichen Raten von zehn Mark.
Meine Frau war außer sich: fünfunddreißig Mark statt neunzig! Es hätte nicht viel gefehlt, so hätte sie angefangen zu weinen. Und sie weinte wirklich, als das Mädchen hinzusetzte: die Dame lasse fragen, ob sie nicht eine von den echten Meißner Pozellanvasen umsonst dazu bekäme, wenn sie soviel für die alte Chaiselongue bezahlte.
Meine Frau weinte wirklich und um diese Tränen zu trocknen, ging ich selbst hinunter, um mit der Dame zu sprechen und als ich dann zurückkehrte, gelang es mir leicht, meine Frau zu beruhigen. Die Dame hatte zwar keine neunzig Mark bezahlt, wohl aber fünfundsiebzig und diese bar. Das Geld klapperte als erster Erlös des Ausverkaufes in der eisernen Kassette.
Meine Frau strahlte, sie war so glücklich, daß sie ganz vergaß, mich danach zu fragen, wie ich es fertiggebracht hätte, einen so hohen Preis und noch dazu sofortige Bezahlung zu erzielen, und das war mir sehr lieb, denn sonst hätte ich mich am Ende doch verraten und meine Frau hätte es mir vielleicht angemerkt, daß ich die fünfundsiebzig Mark aus eigener Tasche in die Kassette legte, nachdem die Dame mir persönlich noch die fünf Mark Anzahlung heruntergehandelt hatte, „weil wir doch so reich wären, weil wir doch soviel Geld hätten, daß es uns auf ein paar Mark mehr oder weniger nicht ankäme.”
Meine Frau war mehr als glücklich, aber leider hielt ihr Glück nicht lange an, denn plötzlich begann sie, mir Vorwürfe zu machen: „Weißt du, es ist mit den fünfundsiebzig Mark ja ganz schön und ich freue mich über die, schon weil die das erste Geld sind, das ich bei dem Ausverkauf eingenommen habe, aber trotzdem hättest du die Chaiselongue nicht unter dem festen Preise fortgeben dürfen, hat die Dame fünfundsiebzig Mark bezahlt, hätte sie auch neunzig gegeben. Ich kenne uns Frauen doch. Natürlich machen wir den Versuch zu handeln, aber wenn wir einsehen, daß wir damit nicht zum Ziele kommen, zahlen wir auch den vollen Preis.”
„Oder ihr geht fort, ohne etwas gekauft zu haben,” verteidigte ich mich, „denn wenn du mit deiner Auffassung recht hättest, dann würden doch auch all die anderen Käufer, als sie sahen, daß wir nichts nachließen, an den früheren Tagen etwas gekauft haben.”
„Die kommen schon noch wieder,” warf meine Frau ein, „die warten es nur ab, ob wir wirklich feste Preise haben, aber wenn die nun erfahren, daß du die Chaiselongue so billig fortgegeben hast, dann werden die anderen natürlich erst recht handeln! Tue mir deshalb den einzigen Gefallen und kümmere du dich in Zukunft nicht wieder um den Verkauf. Ich will es ja gern dankbar anerkennen, daß du mir wenigstens diese fünfundsiebzig Mark verschafft hast, aber wenn du auch in Zukunft die Sache unter dem Preise fortgibst, dann verdirbst du mir das ganze Geschäft. Nicht wahr, du versprichst mir, daß du dich in Zukunft nicht mehr um den Verkauf kümmerst?”
Ich mußte an mich halten, um es nicht zu verraten, wie gern ich in Zukunft den weiteren Verkauf der Möbel den Mädchen überließ und ich hielt Wort. Ich kümmerte mich wirklich nicht mehr darum, bis meine Frau mich doch eines Tages wieder um meine Hilfe bat. Es war ein Käufer da, der für eine elektrische Krone nur hundertundvierzig Mark geben wollte. Dreihundert Mark war der feste Preis, ich sollte versuchen, ob er nicht wenigstens zweihundertundneunzig gäbe.
Ich sah es voraus, das Geschäft würde mich bestimmt einhundertundfünfzig Mark kosten und die hätte ich mir gern gespart. So versuchte ich denn meine Frau dahin zu bringen, daß sie mit zweihundert Mark zufrieden wäre, noch lieber mit hundertfünfundsiebzig, aber sie blieb unerbittlich: „Zweihundertundneunzig Mark, nicht einen Pfennig billiger. Hättest du damals nicht die Chaiselongue so heruntergelassen, würde ich auf den dreihundert Mark bestehen, jetzt aber müssen wir auch diesem Käufer entgegenkommen. Tu mir den Gefallen und sprich du einmal mit dem Mann.”
Und ich sprach mit ihm und nicht ohne Erfolg, denn plötzlich erklärte er mir, hundertundvierzig Mark sei für die Krone doch eigentlich sehr viel Geld, sie sei ja zwar noch sehr hübsch, aber doch immerhin schon alt und gebraucht, er wolle es sich nochmals zu Hause überlegen, ob er soviel ausgeben könne.
Ich bin zwar kein gelernter Verkäufer, aber soviel hatte ich inzwischen von dem Verkaufsgeschäft doch gelernt, daß kein Käufer wiederkommt, der sich einen Kauf zu Hause nochmals in aller Ruhe überlegen will. So hielt ich den Mann denn nicht nur mit Worten, sondern auch mit beiden Händen fest und endlich nach einer Stunde waren wir handelseinig. Nur um mir gefällig zu sein, nahm er die Krone für hundert Mark, anstatt für hundertundvierzig und anstatt hundertundfünfzig mußte ich hundertundneunzig Mark aus der eigenen Tasche hinzulegen.
„Siehst du wohl,” frohlockte meine Frau, als das Geld in der Kassette klapperte, „siehst du wohl, die Leute zahlen schon.”
„Aber es macht auch genug Arbeit, sie dahin zu bringen,” warf ich ein.
„Tust du es denn für mich nicht gern?” fragte meine Frau. „Und schließlich war die Arbeit doch nicht so groß. Ich habe nach der Uhr gesehen, es hat noch keine halbe Stunde gedauert und so schnell verdienst du nicht einmal an deinem Schreibtisch hundertundfünfzig Mark für mich.”
Da hatte meine Frau recht, aber was ich an meinem Schreibtisch verdiente, verdiente ich wirklich, während ich bei diesem anderen Geschäft verdammt zusetzte und zwar soviel zusetzte, daß ich meiner Frau nach weiteren acht Tage, als ich zwei Perserteppiche, vier Tische und drei Schränke verkauft hatte, kategorisch erklärte, ich hätte keine Lust und keine Zeit mehr, mich weiter mit den Leuten herumzuärgern.
Meine Frau sah es absolut nicht ein, weshalb ich keine Zeit und keine Lust mehr haben sollte und sie konnte es erst recht nicht einsehen, warum es da für mich irgendwelchen Ärger gäbe, denn im großen und ganzen bekäme ich doch immer die Preise, die ich forderte.
Da hatte meine Frau wieder recht, ich bekam die Preise, die ich verlangte, aber doch erst dann, wenn ich nicht nur mit den Käufern, sondern auch mit mir selbst jedesmal lange herumgehandelt hatte. Und so teilte ich denn meiner Frau am nächsten Tage mit, ich sei bereit, ihre Bitte zu erfüllen und die Sachen weiter zu verkaufen, jedoch nur dann, wenn sie sich entschließen könne, dieselben ganz bedeutend im Preise herunterzusetzen, weil es meinem christlichen Empfinden widersprach, mit den Käufern herumzuhandeln, als sei ich ein polnischer Jude, zweitens, weil ich Besseres zu tun hätte, als drei Stunden auf zwei Menschen einzureden, nur damit die gemeinsam einen Meißner Teller kauften und schließlich, weil wir wirklich mit den Preisen heruntergehen mußten, wenn wir den Rest der Sachen noch los werden wollten.
Und die Sachen mußten zum Hause hinaus und zwar bald, denn ich fühlte ganz deutlich die Anzeichen einer herannahenden Gehirnentzündung. Dieser Ausverkauf machte mich nicht nur pleite, sondern er machte mich vollständig verrückt. Wenn ich des Morgens in das Zimmer meiner Frau trat, sagte sie nicht wie sonst „guten Morgen”, sondern sie begrüßte mich mit den Worten: „Glaubst du, daß heute ein gutzahlender Käufer kommen wird?” Und des Abends wünschte sie mir keine „gute Nacht”, sondern sie verabschiedete sich, indem sie mir zurief: „Wenn du es wirklich gut mit mir meinst, dann betest du jetzt noch etwas zu dem lieben Gott, danit er mir wenigstens morgen einen guten Käufer schickt.”
Wenn wir spazierengingen, rief meine Frau dem Hausmädchen zu: „Berta, verkaufe inzwischen möglichst viele Sachen.” Während des Spazierganges sprach sie mit mir darüber, ob Berta wohl etwas verkaufe und wenn wir nach Hause kamen, war die erste Frage: „Na, Berta, was haben Sie denn inzwischen verkauft?”
Dieser Ausverkauf fing an, mich mehr als nervös zu machen, aber nicht nur mich, sondern erst recht meine Frau und deren Nervosität zeigte sich darin, daß sie bei keinem Blatt weißen Papiers vorübergehen konnte, ohne nicht auf diesem Blatt zu rechnen und immer aufs neue wieder zu berechnen, was der Ausverkauf der anderen Möbel im besten Falle noch bringen könne und was er im schlimmsten Falle noch bringen würde. Und das Resultat war jedesmal ein anderes, je nachdem meine Frau an dem betreffenden Tage optimistisch oder pessimistisch gelaunt war.
Einmal erhoffte sie für einen weißen Wäscheschrank, der ihr selbst 350 Mark gekostet hatte, 340 Mark und befürchtete gleichzeitig, ihn schlimmstenfalls für 300 Mark fortgeben zu müssen. Am nächsten Tage erhoffte sie für den Schrank im besten Falle 220 Mark und befürchtete, schlimmstenfalls für ihn nicht mehr als 180 Mark zu erhalten.
Meine Frau rechnete auf sämtlichen Blättern, die sie nur im ganzen Hause fand und wenn sie einmal ausnahmsweise nicht rechnete, schrieb sie an unsere sämtlichen Bekannten Briefe und bat diese, ihr doch auch etwas abkaufen zu wollen und das mit dem Erfolg, daß fortan alle Bekannten uns in einem großen Bogen aus dem Wege gingen. Ich persönlich fühlte das den Leuten vollständig nach und dachte nicht daran, ihnen daraus einen Vorwurf zu machen, aber meine Frau beurteilte den Fall wesentlich anders und rief mir zu: „Siehst du, da lernt man die Menschen wieder einmal in ihrer ganzen Schlechtigkeit kennen. Wenn wir sie zu uns bitten, um bei uns gut zu essen und zu trinken, dann kommen sie alle und bleiben solange sitzen, als könnten sie den Weg nicht wieder nach Hause finden, aber wenn sie sich für die vielen Liebenswürdigkeiten, die wir ihnen erwiesen, nun einmal dadurch ein klein wenig dankbar erweisen sollen, daß sie mir einen Stollenschrank, den großen alten Mahagonitisch, oder sonst eine Kleinigkeit für ein paar hundert Mark abkaufen, dann wissen sie plötzlich nicht mehr, wo wir wohnen. Na, soviel steht bei mir fest, ich lade die Leute in das neue Haus nicht wieder ein.”
Es gab wirklich nur eins, wenn meine Frau sich nicht mit allen Bekannten erzürnen und wenn wir beide nicht ganz verrückt werden sollten, der Rest der Sachen mußte baldmöglichst zur Tür hinaus und wenn meine Frau sich auch noch so sehr dagegen sträubte, ich setzte es eines Tages doch durch, daß sie in eine große Reduzierung der Preise willigte. Allerdings tat sie es erst, nachdem sie abermals auf ein paar Dutzend Blättern stundenlang gerechnet hatte. Endlich willigte sie ein, aber nur unter der Bedingung, ich mußte ihr schwören, daß ich bei dem großen Büfett und bei der Anrichte an dem Preis von 1500 Mark festhalten solle, sie habe bei den übrigen Sachen schon soviel zugesetzt, daß sie unmöglich auf ihre Kosten käme, wenn das Büfett sie nicht herausrisse.
Und dabei hatten wir auf das Büfett überhaupt noch kein Angebot erhalten.
Meine Frau stand vor mir wie ein Untersuchungsrichter, der dem Zeugen den Eid abnehmen soll und sagte mit kategorischer Stimme: „Schwöre — 1500 Mark und nicht einen Pfennig weniger.”
Ich wand mich wie ein Ohrwurm, um diesem Eid zu entgehen, denn woher sollte ich die 1500 Mark nehmen, um auch noch dieses Büfett zu bezahlen? Um nicht schwören zu müssen, war ich einen Agenblick dicht daran, meiner Frau alles zu gestehen, aber ich wollte sie nicht betrüben, ihr die Freude nicht rauben, bisher bei dem Ausverkauf wenigstens soviel verdient zu haben, als da jetzt in der feuer- und diebessicheren Kassette lag. Nein, ich brachte es nicht fertig, der Wahrheit die Ehre zu geben, aber bevor ich diesen Eid leistete — —
„Schwöre!” rief mir meine Frau noch einmal zu, „1500 Mark und nicht einen Pfennig weniger!”
Und ich schwur! Was blieb mir weiter übrig. Half ich ihr nicht bei dem Verkauf des Büfetts, dann mußte ich ihr das fehlende Geld doch später so oder so geben, es blieb schließlich Jacke wie Hose.
Bis sie mich dann am nächsten Tage wieder selbst von diesem Eid entband. Und das aus einem sehr einfachen Grunde. Sie hatte in der Stadt mit einer Bekannten über das Büfett gesprochen und diese Dame hatte ihr geraten, das Büfett keinesfalls unter 2000 Mark fortzugeben, auch dieser Preis sei noch sehr niedrig.
Es war ein Glück, daß meine Frau mir den Namen dieser Bekannten nicht verriet, sonst wäre ich zu der hingegangen und hätte ihr erbarmungslos das Genick umgedreht.
Um das Büfett nebst der Anrichte los zu werden, inserierte ich aufs neue in allen in Betracht kommenden Zeitungen und der Erfolg blieb nicht aus. Es kam ein Möbelhändler von auswärts, der sich das Büfett wegen seiner Größenverhältnisse zuerst allerdings nur kopfschüttelnd betrachtete, bis dann doch ein vertrauenerweckender Zug in seinem Gesicht bemerkbar wurde und mein Vertrauen wuchs, als der Mann den Zollstock aus der Tasche zog, das Büfett nach Länge und nach Höhe ausmaß, bis er sich dann an den Tisch setzte und seinerseits zu rechnen begann. Es dauerte lange, bis er damit fertig war, dann aber rief er mir zu: „Wenn Sie mir das Büfett für 200 Mark lassen wollen, nehme ich es und lasse es morgen abholen.” Und weil ich so sprachlos war, daß ich tatsächlich keine Worte fand, hatte er Zeit, fortzufahren: „So, wie das Büfett und die Anrichte sind, kann ich die natürlich nicht gebrauchen, die nimmt mir kein Mensch ab. Ich muß beides wenigstens um die Hälfte verkleinern und aus dem übrigen Holz lasse ich noch einen Tisch, eine Kommode und zwei Stühle anfertigen. Das kostet mir eine Menge Geld. Dazu kommen noch die Transportkosten, aber immerhin, 200 Mark will ich geben, meinetwegen auch 210 Mark.”
Und in demselben Augenblick trat das Mädchen in das Zimmer, um mir heimlich einen Zettel meiner Frau zuzustecken und auf dem stand geschrieben: „Gib das Büfett keinesfalls unter 2000 Mark fort, ich vergaß dir heute mittag zu sagen, daß ich in der Stadt am Vormittag eine Bekannte traf, die mir sagte, 2000 Mark seien für das schöne Büfett viel zu wenig, ich könnte ruhig 2500 Mark verlangen!”
„Warum nicht gleich 25 000 Mark,” schrieb ich auf den Zettel, den ich dem Mädchen wieder übergab, dann nahm ich mir den Möbelhändler vor und redete ganze Bände auf ihn ein. Kein Provisionsreisender hat jemals einen Kunden mit solcher Ausdauer bearbeitet, wie ich den Fremden. Ich sprach mir drei Pfund Fett vom Leibe und redete mir einen halben Lungenflügel zum Teufel und meine Ausdauer wurde belohnt. Der Mann legte fünf Mark zu: statt 210 215 Mark, das sei aber auch das Allerhöchste.
Kraftlos sank ich in einem Stuhl zusammen, dann aber raffte ich mich wieder empor und schmiß den Mann mit dem letzten Rest meiner Kräfte zur Tür hinaus.
Am nächsten Tage teilte er mir mit, er sei bei dem Herauswurf mit dem Kopfe gegen die Tür geflogen und würde mich wegen Körperverletzung verklagen, es müsse denn sein, daß ich sein unwiderruflich letztes Angebot annähme: nicht 215 Mark, sondern 217,50 Mark, er würde morgen wiederkommen und sich Bescheid holen.
Um meine Frau nicht zu betrüben, hatte ich ihr nichts davon erzählt, was der Mann mit dem Büfett anfangen wolle, hatte ihr auch gar nicht den Preis genannt, den er bot, sondern ihr nur mitgeteilt, es sei wegen seines Angebotes zwischen uns zu einer kleinen Meinungsverschiedenheit gekommen. So war sie denn glücklich, als sie erfuhr, der Käufer werde morgen wieder vorsprechen. Ach, sie war ja so glücklich, denn sicher würde er morgen 2000 Mark bezahlen, denn sonst könnte er sich den Weg doch abermals sparen.
Meine Frau sah es voraus, sie würde die ganze Nacht vor Freude nicht schlafen können und ich wußte, daß es mir ebenso gehen würde, wenn auch nicht gerade vor Freude. So lag ich denn tatsächlich eine Stunde nach der anderen wach und rechnete und rechnete, wen auch nicht gerade auf tausend Blättern, so desto mehr im Kopfe. Gewiß, die 2000 Mark würden mir sehr fehlen, aber was half das alles, es mußte sein, wenn wir anders überhaupt noch einmal wieder zur Ruhe kommen wollten. Als ich am nächsten Morgen aufstand, war mein Entschluß gefaßt. Ich telephonierte mit einem meiner Verleger und bat diesen, mir telegraphisch an die Adresse meines Anwaltes einen Vorschuß von 2000 Mark zu senden. Zwei Stunden später hatte ich das Geld in Händen und als der Käufer am Nachmittag wieder zu mir kam, wurden wir uns schnell handelseinig. Er zahlte mir 217,50 Mark, die ich in meine eigen Tasche steckte, damit ich bei dem Geschäft für meine Person doch wenigstens etwas verdiente, dann ließ ich ihn sämtlich Eide schwören, niemandem zu verraten, was er mit dem Büfett und der Anrichte anfangen wolle und was er in Wahrheit dafür bezahlt habe. Wenig später händigte ich meiner Frau die beiden neuen Tausendmarkscheine ein.
Gott sei Dank, der Ausverkauf war beendet, denn die wenigen Sachen, die nun noch übrig waren, würden mit Leichtigkeit auf einer Auktion fortgehen, die ein Auktionator kurz vor dem Umzug veranstalten sollte. Um das Weitere brauchte ich mich nun nicht mehr zu kümmern und das war auch gut, denn ich war finanziell pleite und es würde lange dauern, bis ich mich von diesen Einnahmen, die meine Frau erzielt hatte, erholte.
Meine Frau war glücklich, ja, mehr als das, sie weinte plötzlich vor Freude und es dauerte beinahe eine Stunde, bis sie sich endlich beruhigt hatte, dann aber rief sie mir zu: „Weißt du, weshalb ich so namenlos glücklich bin? Weil ich bei der Gelegenheit erfahren habe, wie lieb du mich hast. Wenn du mit den Käufern unterhandeltest, habe ich immer im Zimmer nebenan an der Tür gestanden und gelauscht. Ich weiß, was die Leute in Wirklichkeit gaben und wieviel du aus deiner eigenen Tasche zulegtest. Ich wollte dir das nur nicht sagen, um dir nicht die Freude zu nehmen, mir eine Freude zu machen.”
Starr und fassungslos sah ich meine Frau an, dann meinte ich: „Das wußtest du und trotzdem — hättest du da nicht wenigstens mit dem Büfett etwas billiger sein können?”
Da sah meine Frau mich ganz traurig an und sagte: „Es ging wirklich nicht. ich habe es hin und her überlegt, aber ich brauche die 2000 Mark zu notwendig, tausend unbedingt für mich und die anderen für dich, denn ich bin dir doch noch die tausend Mark schuldig, die ich auf die neue Villa angezahlt habe. Die konnte ich dir doch unmöglich noch länger schuldig bleiben. Heute kann ich dir das Geld nun endlich zurückgeben, einzig und allein nur deshalb bestand ich auf dem hohen Preis. Hier hast du das Geld wieder, aber wenn du mich wirklich lieb hast, wenn du mir noch mehr als bisher beweisen willst, wie lieb du mich hast, nicht wahr, dann verlangst du nicht von mir, daß ich dir das Geld wirklich wiedergebe, denn du hast mich doch lieb?”
Und ich bewies es ihr, obgleich ich es ihr in den letzten Wochen doch sicher schon genug bewiesen hatte.
Aber wo ist die Frau. die den Beweisen unserer Liebe glaubt? Und wenn eine Frau wirklich einmal diesen Beweisen glaubt, dann ist es so süß, ihnen glauben zu dürfen, daß sie immer wieder nach neuen Beweisen verlangt — — immer wieder nach Geld!
(1) Schlicht/Baudissin wohnte bis März 1914 Johann-Albrecht-Straße 15 (Eigentümer: Rentner Paulin). (Zurück)
(2) Es handelt sich hier um die Villa Berkaer Straße 19 (Eigentümer: ebenfalls Rentner Paulin). (Zurück)
(3) Oberstabsarzt Gritzka. (Zurück)
(4) In der „Weimarer Landeszeitung Deutschland” an den Tagen vom 11. bis 21.Febr.1914 sind Anzeigen über den Verkauf dieses Büfetts erschienen.
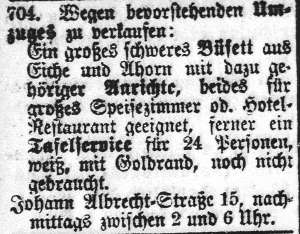

(Zurück)