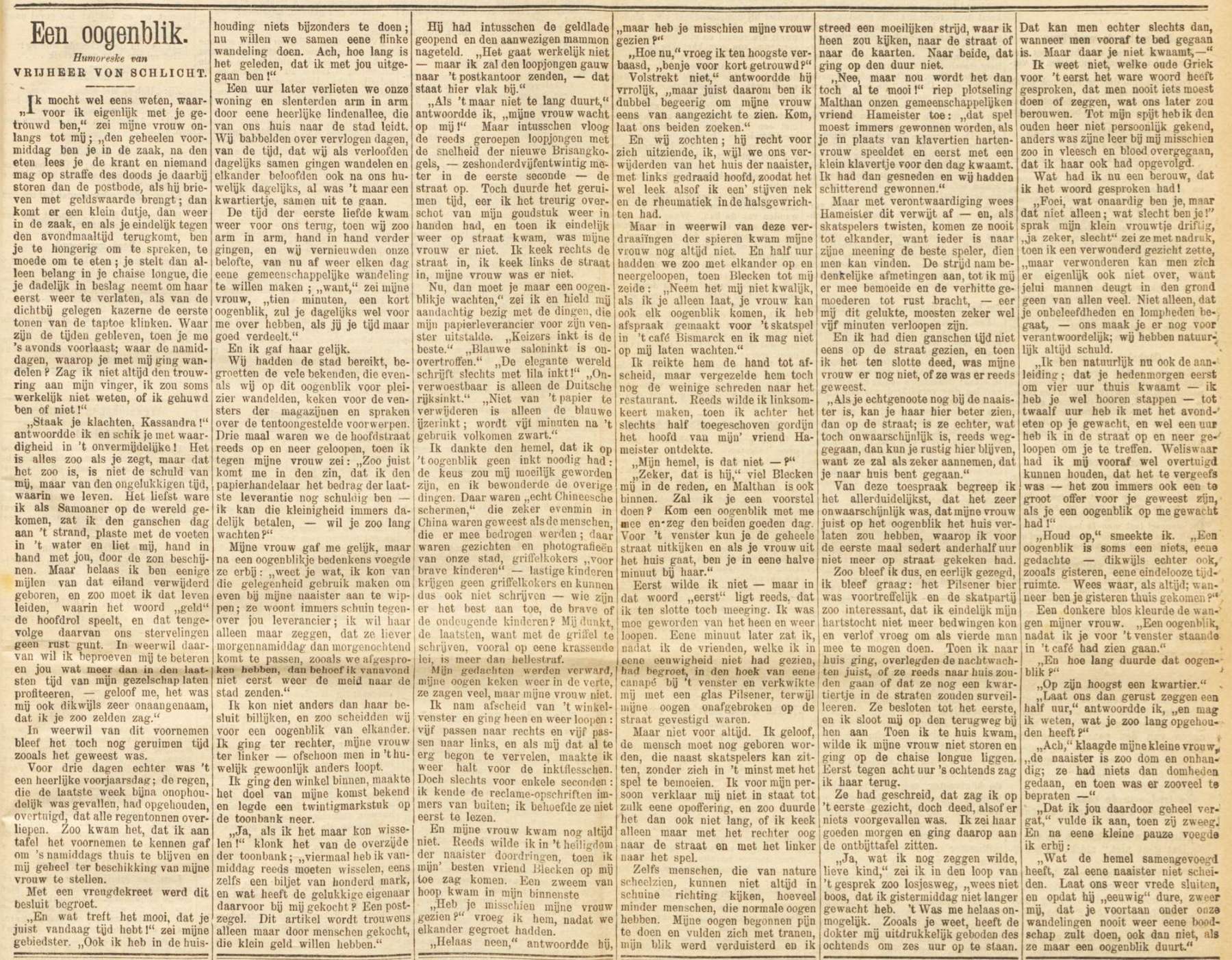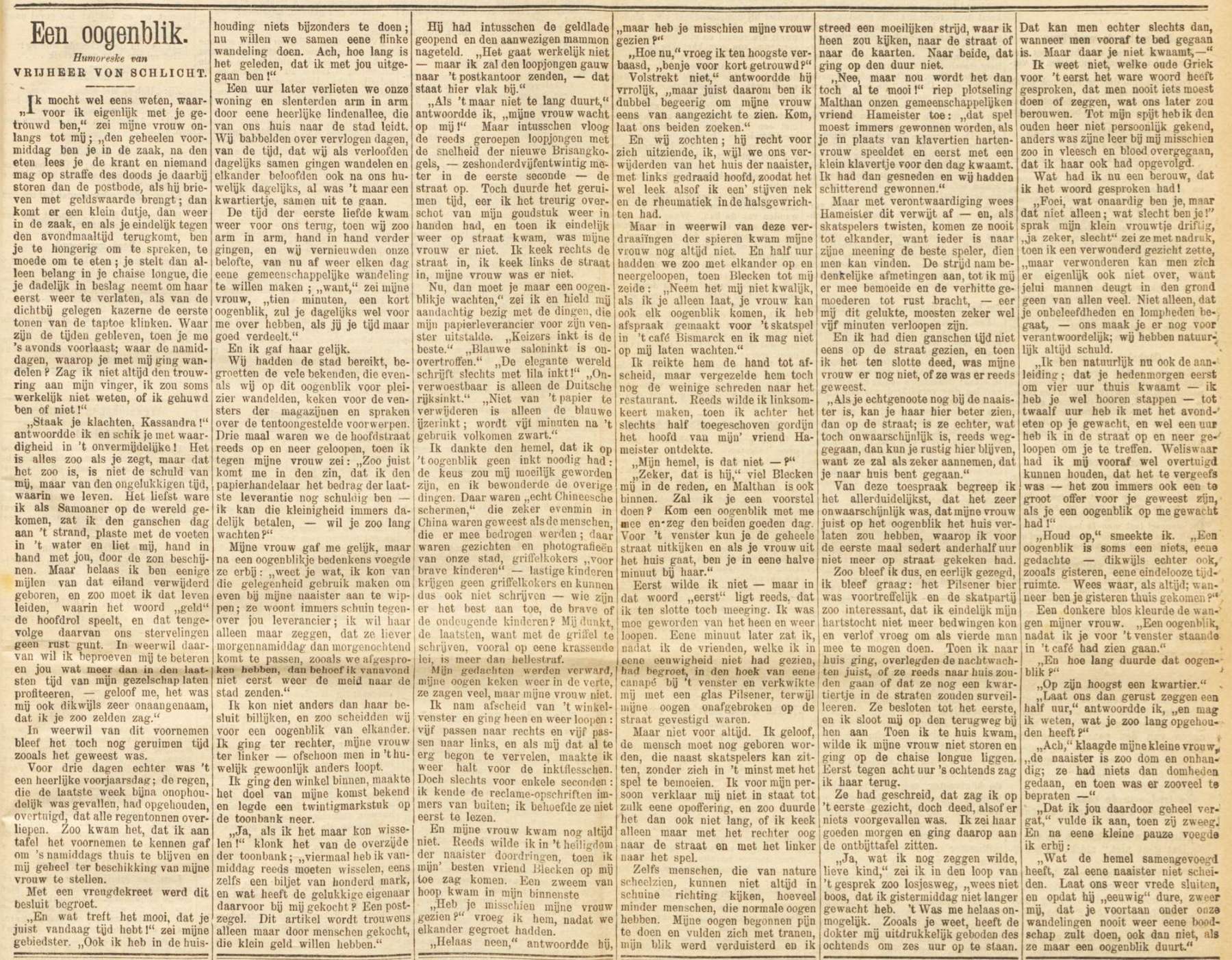

Humoreske von Freiherrn von Schlicht.
in: „Deutsche Lesehalle”, Sonntags-Beilage zum Berliner Tageblatt, Nr. 23 vom 7.Juni 1896,
in: „Nieuwsblad van het Noorden” vom 13.6. 1896, unter dem Titel „Een Oogenblik”,
in: „Pittsburger Volksblatt” vom 26.6.1896,
in: „Freie Presse für Texas” vom 1.7.1896,
in: „Pittsburger Volksblatt” vom 2.7.1896,
in: „Abendblatt”, (Chicago), vom 03.07.1896.
in: „Nebraska Staats-Anzeiger” vom 16.7.1896,
in: „Libausche Zeitung” vom 7.10.1898,
in: „Nebraska Staats-Anzeiger und Herold” vom 10.6.1904 und
in: „Meine kleine Frau und ich”.
„Ich möchte wohl einmal wissen, wozu ich mit Dir verheirathet bin,” sprach meine Frau neulich zu mir; „den ganzen Vormittag über bist Du im Geschäft, nach dem Frühstück liest Du Deine Zeitung, wobei Dich mit Ausnahme des Geldpostboten Niemand bei Todesstrafe stören darf; dann kommt ein kurzer Schlummer, dann abermals ein Gang ins Geschäft, und wenn Du endlich zum Abendbrod heim kehrst, bist Du zu hungrig, um zu sprechen, zu müde um zu essen, Du hast dann nur Interesse für Deine Chaiselongue, die Du gleich darauf mit Beschlag belegst, um sie erst wieder zu verlassen, wenn von der nahe gelegenen Kaserne die ersten Töne des Zapfenstreichs erklingen. Wo sind die Zeiten geblieben, da Du mir Abends vorlasest, wo die Nachmittage, an denen Du mit mir spazieren gingst? Sähe ich nicht immer den Trauring an meiner Hand, ich wüßte manchmal wirklich nicht, ob ich verheirathet bin oder nicht!”
„Laß Deine Klage, Kassandra!” gab ich zurück, „und füge Dich mit Würde in das Unvermeidliche! Es ist so, wie Du sagtst, — aber daß es so ist, ist nicht meine Schuld, sondern die jener unglücklichen Zeit, in der wir leben. Am liebsten wäre ich als Samoaner auf die Welt gekommen, säße den ganzen Tag am Strand, plätscherte mit den Füßen im Wasser und ließe mich, Hand in Hand mit Dir, von der Sonne bescheinen. Leider bin ich aber einige Meilen von jenem Eiland geboren, und so muß ich jenes Leben führen, in dem das Wort „Geld” die Hauptrolle spielt, und das infolgedessen uns Sterblichen keine Ruhe läßt. Trotzdem aber will ich versuchen, mich zu bessern und Dir meine Gesellschaft etwas mehr als in der letzten Zeit zu widmen, — glaube mir, auch ich habe es oft schmerzlich empfunden, Dich so selten zu sehen.”
Trotz dieses meines Vorsatzes blieb es dennoch eine geraume Weile so, wie es gewesen war.
Vor drei Tagen aber war ein köstlicher Frühlingstag; der Regen, der die letzte Woche fast unaufhörlich gefallen war, hatte sich endlich davon überzeugt, daß alle Regentonnen überliefen. So kam es, daß ich bei Tisch die Absicht äußerte, am Nachmittag zu Hause zu bleiben und mich ganz zur Verfügung meiner Frau zu stellen.
Mit einem Freudenschrei wurde dieser Entschluß begrüßt.
„Und wie schön es sich trifft, daß Du gerade heute Zeit hast!” sprach meine Gebieterin. „Auch ich habe in der Wirthschaft nicht Besonderes zu thun, da wollen wir einen ordentlichen Spaziergang zusammen machen. Ach, wie lange ist es her, daß ich mit Dir ausgegangen bin!”
Eine Stunde später verließen wir unser Haus und schlenderten Arm in Arm durch eine herrliche Lindenallee, die von unserer Wohnung zur Stadt führt. Wir plauderten von vergangenen Tagen, von der Zeit, da wir als Brautpaar täglich zusammen spazieren gegangen waren und uns vorgenommen hatten, auch nach unserer Verheirathung täglich, wenn auch nur für eine Viertelstunde, gemeinsam zu gehen. Die Zeit der ersten Liebe stieg vor uns wieder auf, als wir so, Arm in Arm, Hand in Hand, einherschritten, und wir erneuerten unser Gelöbniß, von nun an wieder jeden Tag einen gemeinsamen kurzen Spaziergang zu unternehmen; „denn,” so sagte meine Frau, „zehn Minuten, einen kurzen Augenblick wirst Du bei richtiger Zeiteintheilung täglich für mich übrig haben.”
Und ich stimmte ihr bei.
Wir hatten die Stadt erreicht, begrüßten die vielen Bekannten, die gleich uns zu dieser Zeit lustwandelten, sahen in die Schaufenster und sprachen über die ausgelegten Gegenstände. Dreimal waren wir die Hauptstraße schon auf und ab gegangen, als ich zu meiner Frau sagte: „Mir fällt soeben ein, daß ich beim Papierhändler noch die letzte Lieferung schulde — ich kann die Kleinigkeit ja gleich bezahlen, — willst Du so lange warten?”
Meine Frau stimmte mir bei, fügte dann aber nach kurzem Besinnen hinzu: „Weißt Du, ich könnte die Gelegenheit benutzen, rasch bei meiner Schneiderin vorzusprechen, sie wohnt Deinem Lieferanten ja schräg gegenüber, ich will ihr nur bestellen, daß sie lieber morgen Nachmittag statt am Morgen, wie wir verabredet haben, zur Anprobe kommt, dann brauche ich heute Abend das Mädchen nicht erst wieder zur Stadt zu schicken.”
Ich konnte ihren Entschluß nur billigen, und so trennten wir uns für einen Augenblick. Ich ging zur Rechten — meine Frau zur Linken — obgleich man in der Ehe ja sonst für gewöhnlich anders geht.
Ich betrat den Laden, erklärte den Zweck meines Kommens und legte ein Zwanzig–Markstück auf den Tisch des Hauses nieder.
„Ja, wenn ich nur wechseln könnte!” klang es von der anderen Seite des Ladentisches zurück; „viermal habe ich heute Mittag schon wechseln müssen, einmal sogar einen Hundertmarkschein, und was hat der glückliche Besitzer dafür bei mir gekauft? Eine Freimarke. Dieser Artikel wird überhaupt nur von Leuten gekauft, die kleines Geld haben wollen.”
Er hatte inzwischen die Ladenkasse geöffnet und den vorhandenen Mammon nachgezählt. „Es geht wirklich nicht — aber ich werde den Laufjungen rasch zur Post schicken — die liegt ja nebenan.”
„Wenn's nur nicht zu lange dauert,” versetzte ich, „meine Frau wartet auf mich!” — Aber schon flog der inzwischen herbeigerufene Knabe mit der Geschwindigkeit der neuen Brisangmunition — sechshundertfünfundzwanzig Meter in der ersten Sekunde — von dannen. Trotzdem aber dauerte es eine geraume Zeit, ehe ich den traurigen Rest meines goldenen Besitzthums wieder in Händen hatte, und als ich endlich auf die Straße zurücktrat, war meine Frau nicht da.
Ich sah die Straße rechts hinauf, ich sah die Straße links hinunter, meine Frau war nicht da.
„Na, dann mußt Du eben noch einen Augenblick warten,” sprach ich zu mir selbst und beschäftigte mich eingehend mit den im Schaufenster meines Papierlieferanten ausgelegten Sachen: „Kaisers schwarze Tinte ist die beste.” „Blaue Salon-Tinte ist unübertrefflich.” „Die elegante Welt schreibt nur mit lila Tinte.” „Unzerstörbar allein ist die deutsche Reichstinte.” „Unauslöschbar ist nur die blaue Eisentinte: wird fünf Minuten nach Gebrauch tiefschwarz.”
Ich dankte meinem Schöpfer, daß ich augenblicklich keine Tinte nöthig hatte, die Wahl wäre mir schwer geworden, und bewunderte die anderen Sachen. Da waren „echt chinesische Schirme”, die sicher ebenso wenig in China gewesen sind wie die Leute, die mit ihnen angeführt werden; da waren Ansichten und Photographien unserer Stadt, „Griffelkasten für artige Kinder”, — unartige Kinder bekommen keine Griffel, folglich können sie auch nicht schreiben, — wer ist im Vortheil, die artigen oder die unartigen Kinder? Ich meine, die letzteren, denn mit dem Griffel zu schreiben, besonders auf einer „quietschenden” Tafel, ist mehr als Höllenstrafe.
Meine Gedanken verwirrten sich, meine Augen schweiften wieder in die Ferne, — sie sahen vieles, nur meine Frau nicht.
Ich nahm von meinem Ladenfenster Abschied und ging auf und ab; fünf Schritte nach rechts und fünf Schritte nach links, und als mir das zu langweilig wurde, machte ich wieder vor den Tintenflaschen Halt. Aber nur für Sekunden: ich kannte die Reklameaufschriften ja auswendig, ich brauchte sie nicht erst zu lesen.
Und meine Frau kam noch immer nicht. Schon wollte ich in die heiligen Hallen der Schneiderin eindringen, als ich meinen lieben Freund Blecken auf mich zukommen sah. Ein Hoffnungsschimmer durchdrang mich.
„Hast Du vielleicht meine Frau gesehen?” fragte ich ihn, nachdem wir uns begrüßt hatten.
„Leider nein,” gab er zurück; „aber hast Du vielleicht meine Frau gesehen?”
„Nanu,” fragte ich, auf das Höchste erstaunt, „bist Du denn neuerdings verheirathet?”
„Keineswegs,” gab er lustig zurück, „aber gerade darum bin ich doppelt begierig, meine Frau endlich einmal von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Komm, laß uns Beide suchen.”
Und wir suchten: er mit geradeaus gestelltem Kopf, ich, da wir uns von dem Hause der Schneiderin entfernten, mit links gedrehtem Haupte, so daß ich aussah, als wenn ich einen steifen Hals und die Genickstarre hätte.
Aber trotz dieser Gliederverrenkungen kam meine Frau immer noch nicht. Eine halbe Stunde waren wir so mit einander auf- und abgewandert, als Blecken zu mir sagte: „Nimm es mir nicht übel, wenn ich Dich allein lasse. Deine Frau Gemahlin muß ja auch jeden Augenblick kommen, — ich habe mich zum Skat im Café Bismarck verabredet, und ich darf nicht auf mich warten lassen.”
Ich reichte ihm zum Abschied die Hand, begleitete ihn aber trotzdem noch die wenigen Schritte bis zum Restaurant. Schon wollte ich linksum Kehrt machen, als ich hinter der nur halb zugezogenen Gardine den Kopf meines Freundes Hameister entdeckte.
„Mein Gott, ist das nicht —?”
„Jawohl, das ist er,” unterbrach mich Blecken, „und Maltrahn ist auch drinnen. Soll ich Dir einen Vorschlag machen? Komm einen Augenblick mit herein und sage den Beiden guten Tag. Vom Fenster aus kannst Du die ganze Straße übersehen, und wenn Deine Frau Gemahlin aus dem Hause tritt, bist Du in weniger als einer halben Minute bei ihr.”
Zuerst wollte ich nicht — aber schon in dem Wort „zuerst” liegt, daß ich schließlich doch mitging. Ich war müde geworden von dem Auf- und Abgehen. Eine Minute später saß ich, nachdem ich die Freunde, die ich seit einer Ewigkeit nicht gesehen, begrüßt hatte, in einer Sophaecke am Fenster und labte mich an einem Glas Pilsener Bier, während meine Augen unverwandt an der Straße hingen.
Aber nicht für immer. Ich glaube, der Mensch muß erst geboren werden, der neben Skatspielern sitzen kann, ohne sich im Geringsten an dem Spiel zu betheiligen. Ich für meine Person erkläre mich einer solchen Enthaltsamkeit nicht für fähig, und so dauerte es nicht lange, bis ich nur noch mit dem rechten Auge auf die Straße, mit dem linken aber auf das Spiel sah.
Selbst von Natur schielende Menschen können nicht immer „verquer” sehen, um wie viel weniger Leute, die einen normalen Blick haben. Meine Augen fingen an zu schmerzen und zu thränen, mein Blick wurde verschleiert, und ich kämpfte einen schweren Kampf, wo ich hinsehen solle, ob auf die Straße oder auf die Karten. Beides zusammen konnte ich auf die Dauer nicht ertragen.
„Na, da hört denn doch wirklich verschiedenes auf!” rief da plötzlich Maltrahn unserem gemeinschaftlichen Freunde Hameister zu; „das Spiel mußte immer gewonnen werden, wenn Du statt der Treff–Zehn die Kareau–Dame spieltest und Du erst mal mit einem kleinen Treff vorfühltest: Ich hätte dann geschnitten und wir hätten glänzend gewonnen.”
Aber mit Entrüstung wies Maltrahn den ihm gemachten Vorwurf zurück — und, wenn Skatspieler sich zanken, einigen sie sich bekanntlich nie, denn Jeder ist nach seiner Meinung der beste Spieler, den es giebt. Die Wogen des Streites gingen hoch, bis ich mich schließlich ins Mittel legte und die Gemüther beruhigte, — bis mir dies aber gelungen war, mochten doch wohl fünf Minuten vergangen sein.
Und ich hatte in der ganzen Zeit nicht einmal auf die Straße gesehen, und als ich es schließlich that, war meine Frau noch nicht da, oder sie war schon dagewesen.
Schnell erhob ich mich von meinem Platz, aber die Freunde hielten mich zurück.
„Ist Deine Frau noch bei der Schneiderin, so kannst Du sie besser hier bemerken, als auf der Straße, ist sie aber, was doch sehr unwahrscheinlich ist, jetzt fortgegangen, so kannst Du ruhig noch hier bleiben, denn Deine Frau Gemahlin wird sicher annehmen, Du seiest nach Hause gegangen.”
Von dieser Rede leuchtete mir am meisten ein, daß es sehr unwahrscheinlich sei, daß meine Frau gerade in jenem Moment das Haus verlassen haben sollte, wo ich es zum ersten Mal seit mehr als anderthalb Stunden aus dem Auge gelassen hatte.
So blieb ich denn, offen und ehrlich gestanden, ich blieb gern: das Pilsener Bier war vorzüglich und die Skatpartie so interessant, daß ich endlich das Herzensgelüste nicht mehr bezähmen konnte und um Erlaubniß bat, als Vierter eintreten zu dürfen.
Als ich nach Hause kam, überlegten die Nachtwächter gerade, ob sie schon nach Hause gehen sollten, oder ob sie noch für eine Viertelstunde in den Thorwegen stehen bleiben müßten. Sie entschieden sich für das erstere und ich schloß mich ihnen auf dem Heimwege an.
Als ich nach Hause kam, wollte ich meine Frau nicht stören und legte mich auf der Chaiselongue nieder. Erst gegen acht Uhr Morgens sah ich sie wieder.
Sie hatte geweint, ich sah es auf den ersten Blick, doch that ich, als ob nichts vorgefallen wäre. Ich bot ihr meinen Guten Morgen–Gruß und setzte mich dann an den Frühstückstisch.
„Uebrigens, was ich noch sagen wollte, liebes Kind,” bemerkte ich im Laufe des Gespräches leichthin, „sei nicht böse, daß ich gestern Nachmittag nicht länger auf Dich gewartet habe. Leider aber war es mir unmöglich. Wie Du weißt, hat der Arzt mir strengstens verordnet, jeden Morgen um sechs Uhr aufzustehen. Dies kann man aber nur, wenn man vorher zu Bett gegangen ist. Da Du aber nicht kamst —”
Ich weiß nicht, welcher alte Grieche zuerst die Wahrheit ausgesprochen hat, daß man nie etwas thun und sagen dürfte, das man hinterher bereuen müßte. Leider habe ich den alten Herrn nicht persönlich kennen gelernt, sonst wäre mir seine Lehre vielleicht so in Fleisch und Blut übergegangen, daß ich sie auch befolgt hätte.
Wie ich nun bereute, dieses Wort gesprochen zu haben!
„Pfui, wie unfreundlich Du bist, aber das nicht allein, wie schlecht Du bist,” sprudelte meine kleine Frau nun hervor, „jawohl, schlecht,” betonte sie, als ich ein etwas erstauntes Gesicht machte, „aber wundern kann ich mich ja eigentlich nicht darüber, denn Ihr Männer taugt im Grunde genommen alle nicht viel. Nicht allein, daß Ihr Unarten und Unhöflichkeiten begeht, — uns macht Ihr noch dafür verantwortlich, wir haben natürlich immer die Schuld. Ich bin natürlich auch die Veranlassung, daß Du heute Morgen erst um vier Uhr nach Hause kamst — ich habe Deine Schritte wohl gehört — bis zwölf Uhr habe ich mit dem Abendbrod auf Dich gewartet und wohl eine Stunde bin ich auf der Straße auf- und abgegangen, um Dich zu treffen. Allerdings hätte ich es mir vorher sagen können, daß es vergeblich wäre — es wäre ja auch ein zu großes Opfer von Dir gewesen, wenn Du einen Augenblick auf mich gewartet hättest!”
„Halt ein,” bat ich. „Ein Augenblick ist zuweilen ein Nichts, ein Gedanke — oft aber auch, wie gestern eine endlose Spanne Zeit. Sei wahr, wie stets, wann bist Du gestern nach Haus gekommen?”
Ein dunkles Roth stieg in die Wangen meiner Frau: „Einen Augenblick, nachdem ich Dich vom Fenster aus hatte in das Café gehen sehen.”
„Und wie lange dauerte dieser Augenblick?”
„Höchstens — höchstens eine Viertelstunde.”
„Sagen wir also getrost eine halbe Stunde,” entgegnete ich; „und darf ich wissen, was Dich so lange aufgehalten hat?”
„Ach,” klagte meine kleine Frau, „die Schneiderin ist zu dumm und ungeschickt, sie hatte nichts wie Thorheiten gemacht, da gab es so viel zu besprechen —”
„Daß ich Dich darüber ganz vergaß,” ergänzte ich, als sie schwieg. Und nach einer kleinen Pause fügte ich hinzu:
„Was Gott zusamengeführt hat, soll eine Schneiderin nicht trennen. Laß uns wieder Freiden schließen und damit er „ewig” währet, schwöre mir, daß Du fortan bei unseren Spaziergängen nie wieder eine Besorgung machen willst, auch dann nicht, wenn sie nur einen Augenblick dauert.”
Feierlich erhob sie ihre Rechte, und treu hat sie ihren Schwur gehalten und sie wird ihn halten bis zu jenem Tage, da sie mit schmeichelnder Stimme zu mir sprechen wird: „Bitte, laß mich hier etwas bestellen — Du kannst ja so lange warten — nein, ganz gewiß nicht — es dauert höchstens einen Augenblick.”
„Nieuwsblad van het Noorden” vom 13.6. 1896: