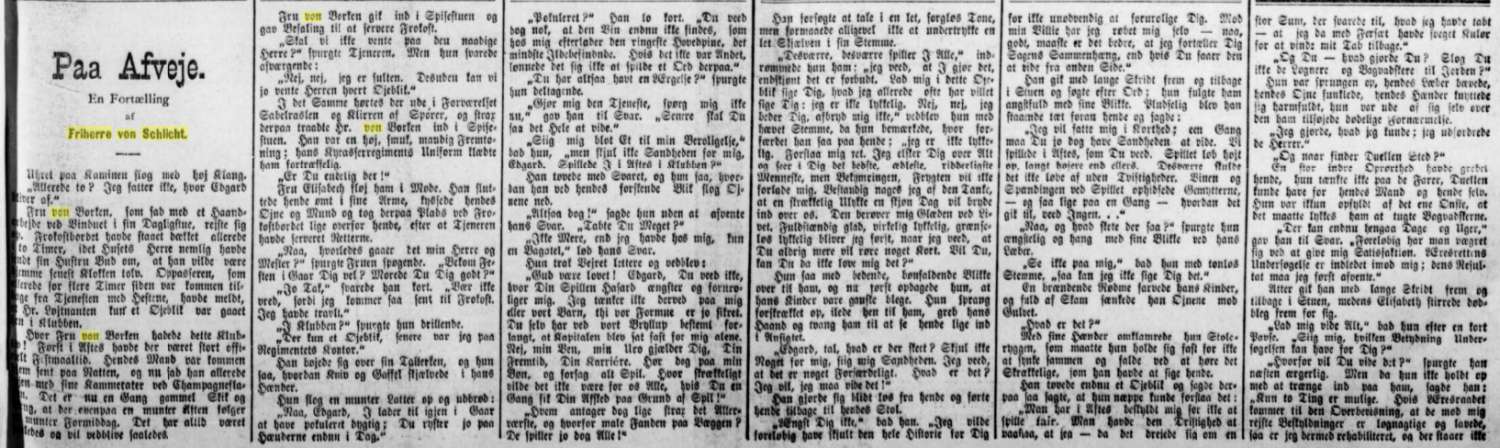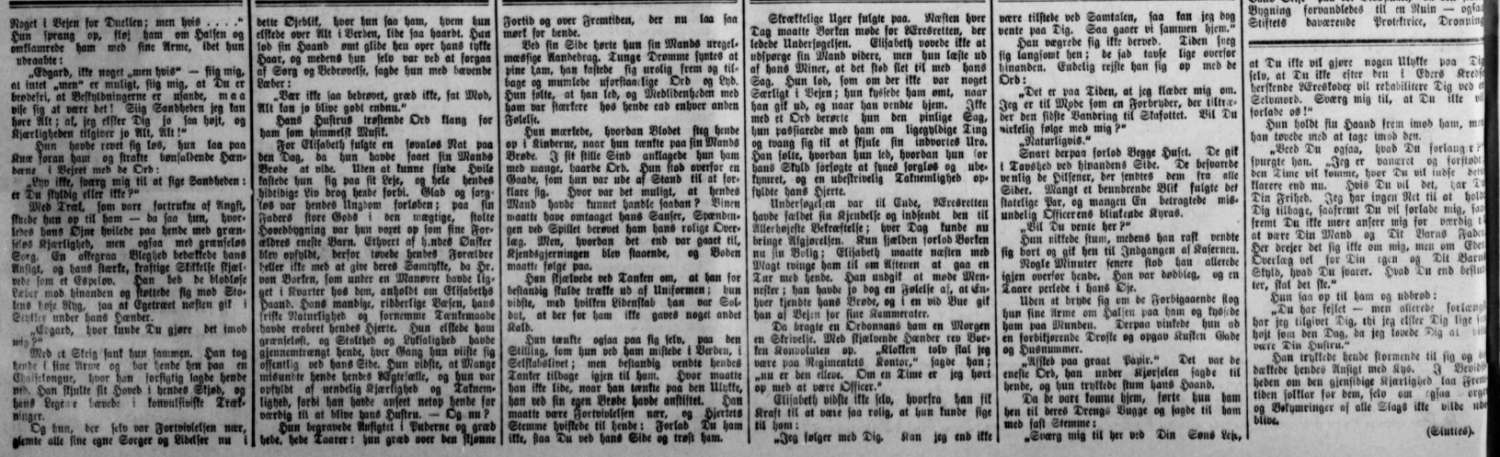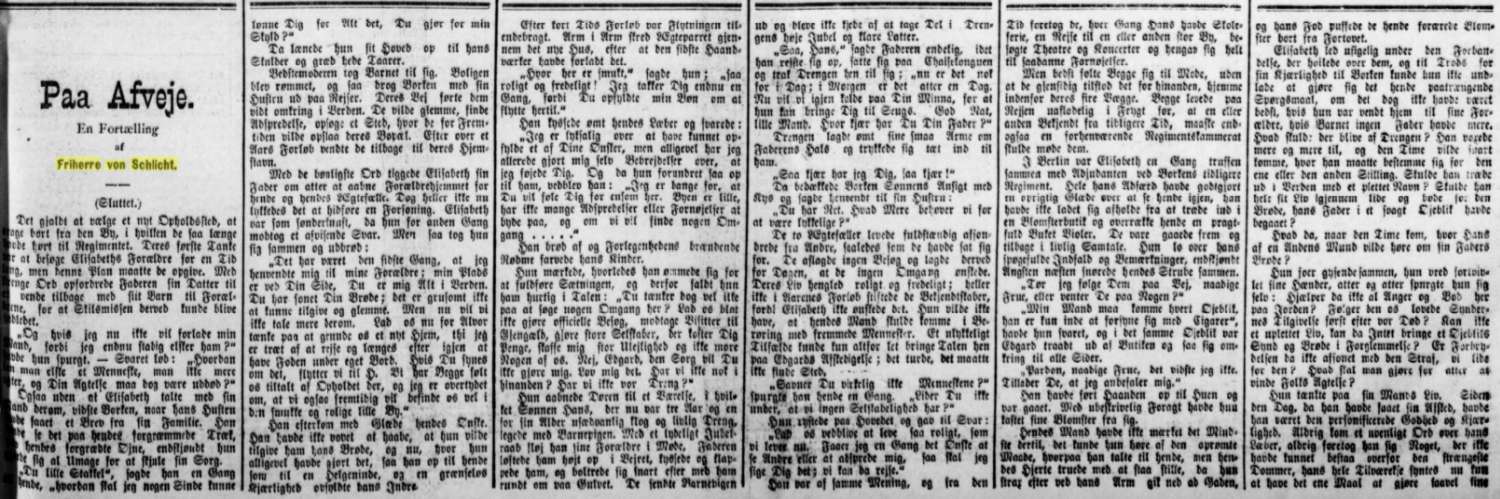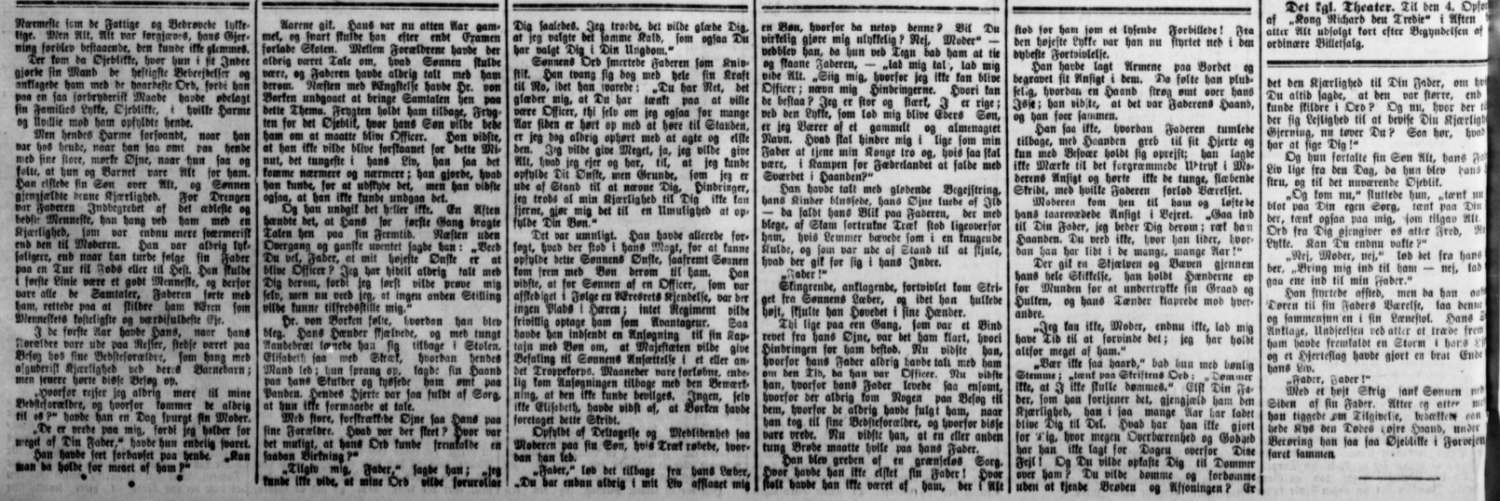Schreckliche Wochen folgten. Fast jeden Tag mußte Borken vor dem Ehrenrath erscheinen, der die Untersuchung führte. Elisabeth wagte nicht, ihren Gatten weiter zu befragen, aber aus seinen Mienen las sie, daß es schlecht um ihn stand. Sie that, als läge gar nichts Besonderes vor; sie küßte ihn zärtlich, wenn er fortging, und wenn er heimkehrte. Mit keinem Wort kam sie auf die Angelegenheit zurück, sie plauderte mit ihm über gleichgültige Sachen und zwang sich, ihre innere Unruhe zu verbergen. Er fühlte, wie sie litt, wie sie sich seinetwegen sorglos und unbefangen zu geben versuchte, und unermeßliche Dankbarkeit erfüllte sein Herz.
Die Untersuchung war beendet, das Ehrengericht hatte seinen Spruch gefällt und Allerhöchsten Ortes zur Bestätigung vorgelegt; jeder Tag konnte nunmehr die Entscheidung bringen. Selten nur noch verließ Borken seine Wohnung; fast mit Gewalt mußte ihn Elisabeth abends zu einem gemeinsamen Spaziergang bewegen. Er scheute sich Menschen zu begegnen; hatte er doch die Empfindung, als wisse jeder von seiner Schuld, und in weitem Bogen ging er den Kameraden aus dem Wege.
Da brachte eines Morgens eine Ordonnanz ein Schreiben. Mit zitternden Händen öffnete Borken das Couvert: „Um zwölf Uhr soll ich auf dem Regimentsbureau sein; jetzt ist es elf. Noch eine Stunde, dann bin ich Offizier gewesen.”
Elisabeth wußte selbst nicht, woher sie die Kraft nahm, so ruhig zu sein, als sie zu ihm sagte: „Ich begleite dich. Kann ich auch bei der Unterredung nicht zugegen sein, so werde ich auf dich warten. Wir gehen dann zusammen nach Haus.”
Er widersprach nicht. Langsam schlich die Zeit dahin, wortlos saßen sie einander gegenüber.
Endlich erhob er sich. „Es wird Zeit, daß ich mich umziehe. Mir ist zu Muthe wie einem Verbrecher, der den letzten Weg zum Schaffot antritt. Willst du mich wirklich begleiten?”
„Gewiß.”
Bald darauf verließen beide das Haus. Schweigend schritten sie nebeneinander her. Freundlich erwiderten sie die Grüße, die ihnen von allen Seiten geboten wurden. Manch bewundernder Blick folgte dem stattlichen Paar, und neidisch blickte gar mancher auf den blitzenen Küraß des Offiziers.
„Willst du hier warten?”
Sie nickte stumm, während er rasch abbog und dem Eingang der Kaserne entgegenschritt.
Wenige Minuten später stand er ihr schon wieder gegenüber, todtenblaß, eine Thräne im Auge.
Unbekümmert um die Vorübergehenden, schlang sie ihre Arme um seinen Hals und küßte ihn auf den Mund. Dann winkte sie einem vorüberfahrenden Wagen heran und nannte die Straße und Nummer ihres Hauses.
„Schlichter Abschied.” Es waren die einzigen Worte, die er während der Fahrt zu ihr sprach, und stumm drückte sie ihm die Hand.
Zu Hause angelangt, führte sie ihn an die Wiege des Knaben und sprach mit fester Stimme: „Schwöre mir hier angesichts deines Sohnes, daß du dir kein Leid anthun willst, daß du dich nicht durch einen Selbstmord nach dem in euren Kreisen herrschenden Ehrenkodex rehabilitiren willst. Schwöre es mir, daß du uns nicht verläßt!”
Sie hielt ihm ihre Hand hin, er aber zögerte, sie zu erfassen.
„Weißt du auch, was du forderst?” fragte er. „Ich bin geächtet und verstoßen; die Stunde wird kommen, in der du dies klarer einsehen wirst als jetzt. Wenn du es willst, bist du frei. Ich habe kein Recht, dich zu halten, wenn du mich verlassen willst, wenn du mich nicht mehr für würdig erachtest, dein Mann, der Vater deines Kindes zu sein. Nicht um mich handelt es sich, sondern um euch. Ueberlege dir wohl, um deiner selbst, um des Kindes willen, was du antwortest. Was du beschließest, das soll geschehen.”
Sie sah zu ihm empor, indem sie in die Worte ausbrach: „Du hast gefehlt — längst aber habe ich dir schon verziehen, denn ich liebe dich wie an dem Tage, da ich dir gelobte, dein Weib zu sein.”
Stürmisch preßte er sie an sich und bedeckte ihr Antlitz mit Küssen. In dem Bewußtsein der gegenseitiugen Liebe lag die Zukunft sonnig vor ihnen, mochten auch Sorgen und Trübsal aller Art nicht ausbleiben.
Es galt einen neuen Wohnsitz zu wählen, fortzuziehen aus der Stadt, in der sie so lange zum Regiment gehört hatten. Ihren ersten Gedanken, Elisabeth's Eltern für eine Zeit lang zu besuchen, mußten sie aufgeben. Mit strengen Worten forderte der Vater seine Tochter auf, mit dem Kinde zu den Eltern zurückzukehren, damit die Scheidung eingeleitet werden könne. „Und wenn ich nun meinen Mann nicht verlassen will, weil ich ihn noch liebe?” hatte sie gefragt. Die Antwort lautete: „Wie kann man jemanden lieben, den man nicht mehr achtet, und deine Achtung muß doch erstorben sein.”
Auch ohne daß Elisabeth mit ihm darüber sprach, wußte Borken, wann seine Frau einen Brief von den Ihrigen erhalten hatte. Er sah es an ihren vergrämten Zügen, an ihren verweinten Augen, obgleich sie sich Mühe gab, ihren Kummer zu verbergen.
„Arme Kleine,” sagte er ein mal zu ihr, „wie soll ich dir je alles das lohnen, was du für mich thust und für mich duldest?” Da schmiegte sie ihren Kopf an seine Schulter und weinte heiße Thränen.
Die Großmutter nahm das Kind zu sich, die Wohnung wurde geräumt, dann ging Borken mit seiner Gattin auf Reisen. Weit in der Welt umher führte sie ihr Weg. Sie wollten vergessen, sich zerstreuen, einen Ort suchen, an dem sie fortan ihren Wohnsitz nehmen konnten. Nach mehr als einem Jahr kehrten sie in die Heimat zurück. Mit flehenden Worten bat Elisabeth den Vater, ihr und ihrem Gatten das Elternhaus wieder zu öffnen. Aber auch jetzt gelang es ihr nicht, eine Versöhnung herbeizuführen. Elisabeth war wie zerschlagen, als sie abermals eine abweisende Antwort erhielt. Dann aber raffte sie sich auf und rief: „Das letzte mal soll es gewesen sein, Edgard, daß ich mich an die Meinen wandte; mein Platz ist an deiner Seite, du bist mir alles auf der Welt. Du hast die Schuld gesühnt; grausam ist es, nicht verzeihen und nicht vergessen zu können. Und nun wollen wir nie mehr darüber sprechen. Laß uns nun ernsthaft daran denken, ein neues Heim zu gründen, denn ich bin reisemüde und sehne mich wieder nach einem eigenen Haushalt. Wenn es dir recht ist, wollen wir nach H. übersiedeln. Uns beiden hat es dort so gut gefallen, und ich bin überzeugt, daß es uns auch fernerhin in dem schönen, ruhigen Städtchen behagen wird.”
Gern kam er ihrem Wunsche nach. Er hatte es nicht zu hoffen gewagt, daß sie ihm seine Schuld verzeihen würde, und nun sie es dennoch gethan, blickte er zu íhr wie zu einer Heiligen empor, und eine schrankenlose Liebe erfüllte sein Innerstes.
Nach kurzer Zeit war der Umzug beendet. Arm in Arm schritt das Ehepaar durch das neue Haus, nachdem es der letzte Handwerker verlassen hatte.
„Wie schön es hier ist,” sagte sie, „wie ruhig und friedlich! Ich danke dir nochmals, daß du meine Bitte, hierher zu ziehen, erfüllt hast.”
Zärtlich küßte er ihre Lippen. „Ich bin glücklich, daß ich dir einen Wunsch erfüllen konnte, aber dennoch habe ich mir schon Vorwürfe gemacht, daß ich es that.” Als sie verwundert zu ihm aufblickte, fuhr er fort: „Ich fürchte, daß du dich hier zu einsam fühlen wirst. Die Stadt ist klein, sie bietet keine Zerstreuungen und Vergnügungen, und ob wir Verkehr finden werden —”
Er stockte, und ein brennendes Roth der Verlegenheit färbte seine Wangen.
Sie merkte, wie er sich scheute, den Satz zu vollenden, deshalb fiel sie ihm schnell ins Wort: „Du denkst doch nicht etwa daran, hier Verkehr anzufangen? Nur keine offiziellen Besuche machen, Gegenbesuche empfangen, große Gesellschaften geben, die dir Geld kosten, mir viel Arbeit machen und niemand Vergnügen bereiten. Nein, Edgard, das wirst du mir nicht anthun. Versprich es mir. Haben wir nicht genug aneinander? Haben wir nicht unseren Jungen?”
Sie öffnete die Thür nach einem Zimmer, in dem Hans, der nunmehr dreijährige Sohn, ein für sein Alter ungewöhnlich kluger und lebhafter Knabe mit dem Mädchen spielte. Mit lautem Jubelschrei flog er seinen Eltern entgegen. Der Vater hob ihn hoch in die Luft, küßte und herzte ihn und balgte sich gleich darauf mit ihm auf dem Fußboden herum. Sie schickten das Mädchen hinaus und wurden nicht müde, in den hellen Jubel, in das fröhliche Lachen des Knaben mit einzustimmen.
„So, Hans,” sagte der Vater endlich, stand auf, setzte sich auf die Chaiselongue und zog den Knaben zu sich heran, „nun ist's genug für heute, morgen ist auch noch ein Tag. Jetzt wollen wir deine Minna wieder hereinrufen, damit sie dich zu Bett bringt. Gute Nacht, kleiner Mann. Wie lieb hast du deinen Vater?”
Zärtlich legte der Knabe seine kleinen Arme um den Hals des Vaters und schmiegte sich fest an ihn.
„So lieb habe ich dich, so lieb.”
Da bedeckte Borken das Gesicht des Sohnes mit Küssen, und zu seiner Frau gewandt, sagte er: „Du hast recht. Was brauchen wir noch mehr, um glücklich zu sein?”
Die beiden Gatten lebten ganz abgeschlossen, wie sie es sich vorgenommen hatten. Sie machten keine Besuche und zeigten damit, daß sie keinen Umgang wünschten. Ruhig und friedlich spielte sich ihr Leben ab; auch im Laufe der Jahre bahnte sich kein Verkehr an, weil Elisabeth es nicht wünschte. Sie wollte nicht, daß ihr Mann mit fremden Menschen in Berührung käme. Ein unglücklicher Zufall konnte nur zu leicht das Gespräch auf Edgard's Verabschiedung bringen; das durfte, das sollte nicht sein.
„Entbehrst du wirklich die Menschen nicht?” fragte er einmal. „Leidest du nicht darunter, daß wir keine Geselligkeit haben?”
Sie schüttelte den Kopf. „Laß uns ruhig so weiter leben wie jetzt. Habe ich einmal den Wunsch, etwas anderes zu sehen, mich zu zerstreuen, so werde ich es dir sagen, dann können wir ja reisen.”
Er stimmte ihr bei, und von da ab unternahmen sie, so oft Hans Schulferien hatte, eine Reise in irgendeine große Stadt, besuchten die Theater und Concerte und gaben sich ganz den Vergnügungen hin.
Am wohlsten aber fühlten sich beide, ohne daß sie es sich gegenseitig gestanden, zu Hause in den eigenen vier Wänden. Beide lebten während der Reise beständig in der Furcht, daß ihnen ein Bekannter aus der früheren Zeit, vielleicht gar ein ehemaliger Regimentskamerad begegnen könne.
In Berlin war Elisabeth einmal mit dem Adjutanten des ehemaligen Regiments zusammengetroffen. Sein ganzes Benehmen hatte die aufrichtige Freude sie wiederzusehen ausgedrückt; erhatte es sich nicht nehmen lassen, in einen Blumenladen zu gehen und ihr einen prachtvollen Veilchenstrauß zu überreichen. Plaudernd waren sie auf- und abgegangen. Sie lachte über seine Scherze und lustigen Bemerkungen, obgleich die Angst ihr fast die Kehle zuschnürte.
„Darf ich Sie begleiten, gnädige Frau, oder erwarten Sie jemand?”
„Mein Mann muß jeden Augenblick kommen, er versieht sich nur mit Cigarren,” hatte sie geantwortet, und in demselben Augenblick war Edgard aus dem Laden getreten und hielt nach ihr Umschau.
„Pardon, gnädige Frau, das wußte ich nicht. Gestatten Sie mir, mich zu empfehlen.”
Er hatte die Hand an die Mütze gelegt und war gegangen. Mit unaussprechlicher Verachtung hatte sie seine Blumen weggeworfen.
Ihr Mann hatte nichts von allem gemerkt, das hörte sie aus der heiteren Art, mit der er sie begrüßte, aber ihr Herz drohte stillzustehen, als sie gleich darauf an seinem Arm dahinschritt und sein Fuß die ihr geschenkten Blumen vom Trottoir herabstieß.
Elisabeth litt entsetzlich unter dem Fluch, der auf ihnen ruhte, und trotz der Liebe zu ihrem Gatten konnte sie die sich ihr nun aufdrängende Frage nicht zurückhalten, ob es nicht doch besser gewesen sein würde, wenn sie zu ihren Eltern zurückgekehrt wäre, wenn das Kind keinen Vater mehr hätte. Was sollte aus dem Knaben werden? Immer mehr wuchs er heran, und die Stunde würde bald kommen, in der er sich für einen Beruf entscheiden mußte. Sollte er mit einem makelbehafteten Namen in die Welt hinaustreten? Sollte er sein ganzes Leben lang leiden und büßen für die Schuld, die der Vater in einer schwachen Stunde begangen hatte?
Was dann, wenn die Stunde käme, in der Hans aus dem Munde anderer von dem Vergehen seines Vaters erfahren würde?
Sie schauderte zusammen, sie rang verzweifelt die Hände, immer und immer wieder fragte sie sich: Hilft denn alle Reue und Buße hier auf Erden nichts? Erfolgt erst nach unserem Tode die uns verheißene Vergebung der Sünden? Kann nicht ein fleckenloses Leben, kann denn nichts die Schuld und die Sünde eines Augenblicks vergessen machen? Ist mit der Strafe, die wir für unser Vergehen erleiden, die That denn nicht gesühnt? Was soll man thun, um wieder geachtet dazustehen?
Es kamen dann Augenblicke, da sie ihrem Gatten innerlich die heftigsten Vorwürfe machte und ihn mit den härtesten Worten anklagte, daß er das Lebensglück der Seinen in so frevelhafter Weise zerstört hatte, Augenblicke, da Zorn und Unmuth gegen ihn sie erfüllte.
Aber ihr Zorn schwand dahin, wenn er bei ihr war, wenn er sie mit seinen großen dunkeln Augen zärtlich anblickte, wenn sie sah und empfand, daß sie und das Kind sein ganzes Denken und Empfinden ausmachten. Er liebte seinen Sohn über alles, und der Sohn erwiderte diese Liebe. Für den Knaben war der Vater der Inbegriff des edelsten und besten Menschen, er hing an ihm mit Liebe, die fast noch schwärmerischer war als die zu seiner Mutter. Nie war er glückseliger, als wenn er seinen Vater auf einem Spaziergange oder einem Spazierritt begleiten durfte. Ein guter Mensch sollte Hans in erster Linie werden, und so waren alle Gespräche, die der Vater mit ihm führte, darauf gerichtet, ihm die Ehre als den köstlichsten und werthvollsten Besitz des Menschen zu schildern.
In den ersten Jahren war Hans, wenn seine Eltern reisten, stets zum Besuch bei seinen Großeltern gewesen, die mit abgöttischer Liebe an dem Enkel hingen; später aber unterblieben diese Besuche.
„Warum fahre ich nie mehr zu den Großeltern, und warum kommen sie nie zu uns?” hatte er seine Mutter einmal gefragt
„Sie sind mir böse, weil ich deinen Vater zu lieb habe,” hatte sie endlich zur Antwort gegeben.
Verwundert hatte er sie angesehen: „Kann man ihn denn zu lieb haben?”
Die Jahre gingen dahin. Hans war nun achtzehn Jahre alt, und bald sollte er nach Ablegung des Abiturientenexamens die Schule verlassen. Nie war zwischen den Eltern die Rede gewesen, was der Sohn werden solle, nie hatte der Vater mit ihm darüber gesprochen. Fast ängstlich hatte Herr von Borken es vermieden, das Gespräch auf dieses Thema zu bringen. Die Furcht hielt ihn davon zurück, die Furcht vor dem Augenblick, in dem sein Sohn ihn bitten würde, Offizier werden zu dürfen. Er wußte, daß diese Minute, die schwerste seines Lebens, ihm nicht erspart bleiben würde, er sah sie näher und näher kommen; er that, was er konnte, um sie hinauszuschieben, aber er wußte auch, er konnte ihr nicht entgehen.
Und er entging ihr nicht. Eines Abends geschah es, daß Hans zum ersten mal das Gespräch auf seine Zukunft brachte. Fast ohne Uebergang und unerwartet sagte er: „Weißt du wohl, Papa, daß es mein sehnlichster Wunsch ist, Offizier zu werden? Ich habe bisher nie mit dir darüber gesprochen, weil ich mich erst selbst prüfen wollte, aber nun weiß ich es, daß kein anderer Beruf mich befriedigen würde.”
Herr von Borken fühlte, wie er erblaßte. Seine Hände zitterten, schwer athmend lehnte er sich in seinen Stuhl zurück. Mit Schrecken sah Elisabeth, wie ihr Mann litt, sie sprang auf, legte ihre Hand auf seine Schulter und küßte ihn zärtlich auf die Stirn. Ihr Herz war so voll Trauer und Gram, daß sie nicht zu sprechen vermochte.
Mit großen, erschrockenen Augen blickte Hans auf seine Eltern. Was war geschehen? Wie war es möglich, daß seine Worte solche Wirkung hervorrufen konnten?
„Verzeih, Papa,” bat er, „ich konnte nicht wissen, daß meine Worte dich so beunruhigen würden. Ich glaubte, es würde dich freuen, daß ich denselben Beruf wähle, den auch du in deiner Jugend gewählt hast.”
Wie Messerstiche schmerzten den Vater die Worte seines Sohnes. Er zwang sich aber mit aller Gewalt zur Ruhe, als er antwortete: „Du hast recht, mich freut es, daß du daran gedacht hast, Offizier zu werden, denn wenn ich auch seit vielen Jahren dem Stande nicht mehr angehöre, so habe ich doch nie aufgehört, ihn zu achten und zu lieben. Ich gäbe viel darum, ich gäbe alles, was ich habe, wenn ich dir deinen Wunsch erfüllen könnte, aber Gründe, die ich dir nicht anzugeben vermag, Hindernisse, die ich bei aller Liebe zu dir nicht beseitigen kann, machen es mir unmöglich, deine Bitte zu erfüllen.”
Es war unmöglich. Er hatte bereits versucht, was in seinen Kräften stand, um seinem Sohn, falls dieser mit der Bitte an ihn herantreten würde, den Wunsch erfüllen zu können. Er wußte, für den Sohn des ehrengerichtlich verabschiedeten Offiziers war in der Armee kein Platz; kein Regiment würde ihn freiwillig als Avantageur aufnehmen. Da hatte er sich in einem Gnadengesuch an seinen König mit der Bitte gewandt, die Einstellung des Sohnes in irgendeinen Truppenteil befehlen zu wollen. Monate waren vergangen, endlich kam das Gesuch zurück mit dem Vermerk, daß demselben nicht stattgegeben werden könne. Niemand, selbst Elisabeth nicht, hatte um diesen Schritt gewußt.
Voll Theilnahme und Mitleid blickte die Mutter auf den Sohn, dessen Züge verriethen, wie er litt.
„Vater,” klang es von seinen Lippen zurück, „noch nie in meinem Leben hast du mir eine Bitte abgeschlagen, warum nun gerade diese? Willst du mich wirklich unglücklich machen? Nein, Mutter,” fuhr er fort, als sie ihn durch Zeichen bat zu schweigen, den Vater zu schonen, „laßt mich sprechen, laßt mich alles wissen. Sagt mir, warum ich nicht Offizier werden kann; nennt mir die Hindernisse. Worin können sie bestehen? Ich bin groß und stark, ihr seid reich; durch das Glück, das mich eueren Sohn werden ließ, bin ich der Träger eines alten, in der ganzen Welt geachteten Namens. Was soll mich hindern, ebenso wie der Vater meinem Kaiser treu zu dienen und, wenn es sein soll, im Kampfe für das Vaterland mit dem Schwert in der Hand zu fallen?”
Mit glühender Begeisterung hatte er gesprochen, lebhaft färbten sich seine Wangen, feurig leuchteten seine Augen — da fiel sein Blick auf den Vater, der mit fahlen, vor Schmerz verzerrten Zügen ihm gegenübersaß, dessen Glieder im Schüttelfrost erbebten, der nicht im Stande war zu verbergen, was in seinem Inneren vorging.
„Vater!”
Gellend, anklagend, verzweifelt kam der Schrei von den Lippen des Sohnes, und laut aufschluchzend barg er den Kopf in die Hände.
Denn mit einem mal, als sei die Binde von seinen Augen genommen, war ihm klar, worin das Hinderniß für ihn bestand. Nun wußte er, warum sein Vater nie mit ihm über die Zeit gesprochen hatte, da er Offizier gewesen war. Nun wußte er, warum die Eltern so einsam lebten, warum nie ein Besucher zu ihnen kam, warum sie ihn nie begleitet hatten, wenn er die Großeltern aufsuchte, warum diese zürnten. Nun wußte er, daß irgendeine schwere Schuld auf dem Vater lasten müsse.
Grenzenlose Trauer überfiel ihn. Wie hatte er seinen Vater geliebt! Wie stolz war er auf ihn gewesen, der ihm in allem ein leuchtendes Vorbild war! Aus dem höchsten Glück war er nun hinabgestürzt in die tiefste Verzweiflung.
Er hatte die Arme auf den Tisch gelegt und sein Gesicht in ihnen vergraben. Da fühlte er plötzlich, wie eine Hand zärtlich über seinen Scheitel strich; er wußte, es war die Hand des Vaters, und er zuckte zusammen.
Er sah es nicht, wie der Vater zurücktaumelte, mit der Hand nach dem Herzen griff und sich mühsam aufrecht hielt; er bemerkte nicht den gramvollen Ausdruck in dem Gesicht der Mutter und hörte nicht den schweren, schleppenden Schritt, mit dem der Vater das Zimmer verließ.
Die Mutter trat zu ihm und richtete sein thränenfeuchtes Antlitz in die Höhe: „Gehe hin zu deinem Vater, ich bitte dich darum; gib ihm die Hand. Du weißt nicht, wie er leidet, wie er gelitten hat die vielen, vielen Jahre!”
Ein Zittern und Beben ging durch seine Gestalt, er hielt die Hände vor den Mund, um sein Weinen und Schluchzen zu unterdrücken, seine Zähne schlugen aufeinander: „Ich kann nicht, Mutter, noch nicht; laß mir Zeit, es zu überwinden, ich habe ihn zu lieb gehabt.”
„Sei nicht so hart,” bat sie mit flehender Stimme, „gedenke des Wortes: »Richtet nicht, auf daß ihr nicht gerichtet werdet.« Liebe deinen Vater, wie er es verdient, vergilt ihm die Liebe, die er dir so viele Jahre erzeigt hat. Was hat er alles für dich gethan, wieviel Güte und Nachsicht hat er stets deinen Fehlern gegenüber gezeigt. Und du wolltest dich aufwerfen zum Richter über ihn? Wolltest urtheilen und verdammen, ohne die Schuld und die Sühne zu kennen? Ist das die Liebe zu deinem Vater, von der du stets sagtest, sie sei größer, als daß du sie in Worten schildern könntest? Und jetzt, da sich dir Gelegenheit bietet, deine Liebe durch die That zu beweisen, zögerst du? Höre mich an!” Und sie erzählte ihrem Sohn alles, das ganze Leben seines Vaters von dem Tage an, da sie die Seine ward, bis zu der heutigen Stunde.
„Und nun komm, denke nicht nur an dein eigenes Leid, denke an deinen Vater, denke auch an mich, die ich alles verzieh. Ein Wort von dir gibt uns die Ruhe, den Frieden und das Glück wieder. Kannst du noch schwanken?”
„Nein, Mutter, nein,” rang es sich von seinen Lippen, „bringe mich zu ihm, nein, laß mich allein zu meinem Vater gehen.”
Er stürzte davon, aber als er die Thür zu dem Zimmer seines Vaters öffnete, lag dieser todt in seinen Lehnstuhl zusammengesunken. Die Anklage seines Sohnes, die Scheu, ihm wieder gegenüberzutreten, hatten einen Sturm in seinem Inneren heraufbeschworen, und ein Herzschlag hatte seinem Leben ein jähes Ende bereitet.
„Vater, Vater!”
Mit lautem Aufschrei fiel der Sohn neben dem Vater nieder. Wieder und wieder bedeckte er, Verzeihung erflehend, mit heißen Küssen die Rechte des Todten, unter deren Berührung er vorhin zusammengezuckt war.
„Nationaltidende” vom 16. und 17.11.1900: